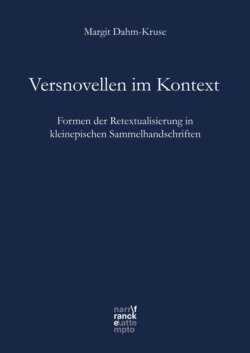Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 Das ‚Herzmaere‘ im Kontext I: Der Cgm 714 6.1 Die Handschrift
ОглавлениеDer Münchner Codex Cgm 714München, Bayerische Staatsbibliothek›Cgm 714‹ [m] ist eine ca. 500 Blatt starke Papierhandschrift in nordbairischer Mundart aus dem dritten Viertel des 15. Jahrhunderts.1 Die Handschrift ist vermutlich im Nürnberger Raum entstanden, was zum einen durch die enthaltenen Fastnachtspiele von Hans RosenplütRosenplüt, Hans, zum anderen durch einen Eintrag auf dem alten Vorsatzblatt des hinteren Einbanddeckels nahegelegt wird, das einen Michael Geyswurgel als Besitzer vermerkt, bei dem es sich möglicherweise um den Erstbesitzer, vielleicht sogar den Auftraggeber der Handschrift handelt. Geyswurgel besaß nach Urkundenbelegen ein Haus in Nürnberg und ist vermutlich 1499 gestorben. Nähere Informationen zur Person sind nicht verfügbar, wahrscheinlich gehörte er nicht dem Patriziat, wohl aber dem gehobenen Nürnberger Bürgertum an.2
Der Codex ist in zwei Teilen angelegt, die auch durch das vorangestellte Register deutlich voneinander geschieden sind. Der erste Teil (fol.1–288) führt eine für kleinepische Kompilationen typische Mischung verschiedener Verserzählungen und Redetexte auf, während der zweite Teil (fol.289–490) eine Sammlung von Fastnachtspielen Hans Rosenplüts tradiert, die im zwei Seiten umfassenden Register des Spieleteils mit der Überschrift Vasnacht Spil (IIIr) und Schnepers (IIIv) überschrieben sind.3 Die Anzahl der enthaltenen Texte ist in beiden Teilen in etwa gleich groß, das Register führt für den ersten Teil 45, für den zweiten Teil 49 Texte auf.4
In der äußeren Gestaltung und der Textpräsentation unterscheiden sich die beiden Teile nicht wesentlich, allerdings gibt es Divergenzen im Schriftbild. Während Brandis auf einen abweichenden Duktus im zweiten Teil der Handschrift verweist, der auf zwei wechselnde Schreibhände hindeute, ist der Codex nach Schneider wegen der großen Übereinstimmung der Buchstabenform von einer identischen Schreibhand gefertigt;5 lediglich der erste Text des Fastnachtspielcorpus (‚Narrenfastnacht‘, 48, fol. 284v-287r) ist eindeutig einer zweiten Hand zuzuordnen.6
Es gibt keine Schriftspiegelbegrenzung im Codex, entsprechend stehen die Versanfänge nicht immer gerade untereinander und die Seitenränder variieren in der Breite. Der Text ist einspaltig angelegt und umfasst im ersten Teil meist 19–20 Verse, im zweiten Teil in den Partien mit kleinerem Schriftbild gelegentlich bis zu 26 Verse pro Blatt. Die Texte sind durch leicht eingerückte rote Titulaturen deutlich voneinander getrennt, die bei kürzeren Texten zum Teil etwas kleiner ausfallen, weiterhin sind die Anfangsbuchstaben der Verse zumeist durchgängig rot gefüllt. Textanfänge sind mit leicht verzierten und vergrößerten Anfangsinitialen versehen, gelegentlich finden sich auch innerhalb der Texte verzierte Initialen, dies aber ohne Regelmäßigkeit. Im ersten Teil der Sammlung finden sich häufig Alinea-Zeichen am linken Blattrand. Überwiegend stehen diese an Versen, die Sprechhandlungen oder Sprecherwechsel beinhalten und zumeist mit der Präteritumform sprach markiert sind. Die Kennzeichnung wird aber nicht konsequent angewandt, das Gros der Texte ist mit wenigen oder gar keinen Alinea-Zeichen versehen, während einzelne Dichtungen eine sehr große Zahl an Markierungen aufweisen.7 Im zweiten Teil des Codex fehlen diese Markierungen vollständig; eine zusätzliche Kennzeichnung von Sprechpartien bzw. Sprecherwechseln dürfte schon auf Grund der strophischen Struktur der Fastnachtspiele obsolet sein. Der Codex enthält diverse Korrekturen und Streichungen, zum Teil in roter Schrift, wobei im zweiten Teil eine höhere Frequenz an korrigierten und durchgestrichenen Wörtern und Textpartien fassbar ist. Die mit 210x150 mm verhältnismäßig kleine Handschrift vermittelt insgesamt das Bild einer zwar sorgfältig, aber mit moderatem Aufwand gefertigten Gebrauchshandschrift ohne besondere repräsentative Funktion, die den typischen Gestaltungsmodalitäten spätmittelalterlicher Papiercodices entspricht.8
Das Register ist durch eine in roter Tinte gehaltene Titulatur überschrieben: Das ist das register des buchs darynn vindt man durch dy czal alle dy spruch und alle dy vasnachtspil die in disem buch geschriben sind (Ir). Die Überschrift macht durch die Trennung von spruch und vasnachtspil eine klare, auch gattungsmäßige Geschiedenheit der aufgeführten Textkorpora deutlich, die außergewöhnlich für die Überlieferung des frühen Fastnachtspiels ist. Der RosenplütRosenplüt, Hans-Teil im Cgm 714 gehört damit nicht nur zu den umfangreichsten und bedeutendsten Überlieferungsträgern der frühen Nürnberger Fastnachtspiele, er hat auch in seiner Homogenität ein Alleinstellungsmerkmal in der Überlieferungsgeschichte der Textsorte. Keine andere Handschrift führt die Fastnachtspiele in einer klaren generischen Trennung von anderen Textsorten auf, üblich ist eine Verschriftlichung im Wechsel mit anderen, zumeist kleinepischen Texttypen.9
Der Cgm 714 verweist durch verschiedene äußere Merkmale auf eine planvolle Anlage der Sammlung. So macht die durchgängige Fertigung von vermutlich nur einer Hand die Annahme einer geschlossenen Konzeption und durchdachten Gesamtstruktur per se plausibler, als es bei einer Erstellung durch mehrere Schreiberhände der Fall wäre. Der Codex ist gleichmäßig in Sexternionen angelegt, was auf eine planvolle und einheitliche Anlage der Handschrift schließen lässt, zumal gerade spätmittelalterliche Sammelhandschriften sonst häufig durch eine unregelmäßige Lagenstärke gekennzeichnet sind.10 Die Lagen sind mit alphabetischen Kustoden gekennzeichnet, im ersten Teil werden die Kustoden a-z, im zweiten Teil b-t verwendet.11 Die Annahme einer geschlossenen Anlage der Sammlung, die nicht durch das nachträgliche Zusammenfügen verschiedener, voneinander unabhängiger Teile entstanden ist, wird gestützt durch eine praktisch durchgängig die Lagen überschreitende Anlage der Texte; nur in wenigen Fällen fallen Lagenwechsel und der Beginn eines neuen Textes zusammen. Weiterhin kann die Verwendung von fünf unterschiedlichen für den Codex verwendeten Papiersorten, die nicht sukzessive eingesetzt wurden, sondern sich jeweils über den ganzen Codex verteilen, als Indiz einer zusammenhängenden Entstehung der Handschrift gesehen werden.12 Vor allem ist die klare Trennung zwischen den Sammlungsteilen und die homogene Zusammenstellung der Fastnachtspiele Indiz einer planvollen Konzeption des Cgm 714.
Zu fragen ist, wieweit eine konzeptionelle Zusammenstellung der Texte auch über die Einteilung in zwei Corpora hinaus wirksam ist, wobei vor allem der erste Teil der Sammlung im Fokus der Betrachtung steht. Mihm charakterisiert diesen Teil des Codex als ein Beispiel für eine gemischte Kleinepiksammlung, die keinen besonderen Schwerpunkt oder eine bevorzugte Gedichtart erkennen lässt und die durch das Zusammentragen aller verfügbaren Reimpaardichtungen entstanden sei.13 Tatsächlich ist das Textkorpus im ersten Teil ausgesprochen heterogen und scheint keine spezifische thematische Gewichtung zu haben oder in besonderer Anordnung zu stehen. Es finden sich verschiedene Minnereden, pragmatisch-didaktische Stücke, Texte mit unterschiedlicher Ständethematik, geistliche Texte und verschiedene Verserzählungen, darunter insgesamt acht Versnovellen. Der Cgm 714 verwendet breit gestreutes Material, dabei zeigt sich in Textauswahl und Arrangement ein Nebeneinander von länger tradiertem und neuerem literarischen Material. Es gibt Texte mit einer breiten Tradition, wie zum Beispiel das ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘, die auch in verschiedenen anderen Handschriften überliefert sind. Auch Auszüge aus umfangreicheren bekannten Texten und Sammlungen sind eingebunden, so finden sich Teile aus Boners ‚EdelsteinUlrich Boner›Der Edelstein‹‘ oder Konrads von Würzburg ‚TrojanerkriegKonrad von Würzburg›Trojanerkrieg‹‘. Daneben stehen jüngere Texte, die häufig in einer Nürnberger Lokaltradition stehen, dazu zählen unter anderem einige Spruchdichtungen RosenplütsRosenplüt, Hans.
Neben bekanntem Textgut überliefert der Codex auch eine ungewöhnlich große Zahl unikaler Texte und Textfassungen, etwa die Hälfte der insgesamt 47 Dichtungen des ersten Teils haben keine Entsprechung in anderen Überlieferungsträgern. Der Cgm 714 zeigt sich auf verschiedenen Ebenen als sehr spezifisch in der Gestaltung der einzelnen Texte und in deren Zusammenstellung, auch die Textpräsentation weist markante Eigenheiten auf. Bei genauerer Analyse lassen sich innerhalb der zunächst lose konzipiert erscheinenden Sammlung immer wieder gattungsübergreifende Textgemeinschaften erkennen, die auf unterschiedliche Weise miteinander verklammert sind und thematische Korrespondenzen zwischen Einzeltexten sowie zwischen Textgruppen gestalten.
Am Beginn der Sammlung steht eine Gruppe von kurzen Texten mit gesellschaftlich-ständischer Thematik (1–10). Dieser Sammlungsteil korrespondiert mit den Fastnachtspielen im zweiten Sammlungsteil, mit denen er das durchgängige Thema der Verkehrung ständischer Ordnung und gesellschaftlicher Normativität gemeinsam hat.
Darauf folgt eine längere Reihe von Texten, in der Minnereden, geistliches Textgut sowie verschiedene, auch schwankhafte Verserzählungen zusammen geführt werden, die ebenfalls auf den Minnediskurs rekurrieren (11–35). Innerhalb dieser Reihe lassen sich verschiedene Textgruppen unterscheiden, in denen die Verhandlung von Minne unterschiedlich gestaltet wird. Das ‚HerzmaereKonrad von Würzburg›Das Herzmaere‹‘ bildet dabei mit seinen unmittelbaren Co-Texten eine besonders markante und hervorstechende Textformation, die zentrale thematische Akzente setzt.
Die dritte und abschließende thematische Gruppe des ersten Teils kennzeichnet ein deutlich belehrender Impetus, indem durchgängig moralisierende und geistliche Texte aufgeführt werden, die religiöse Normativität und Tugendlehre verhandeln (36–47).
Auch der zweite Teil des Codex wird in die Betrachtung einbezogen. Zwar ist das Fastnachtspielkorpus klar vom ersten Sammlungsteil getrennt, dennoch kann von einer gemeinsamen Konzeption der Sammlungsteile ausgegangen werden; in jedem Fall prägt die Überlieferungssymbiose einen zusammenhängenden Rezeptionsmodus für die beiden Korpora.14 Die Fastnachtspiele des zweiten Sammlungsteils werden deshalb nach möglichen thematischen und poetischen Parallelen zum kleinepischen Textkorpus des ersten Teils befragt.