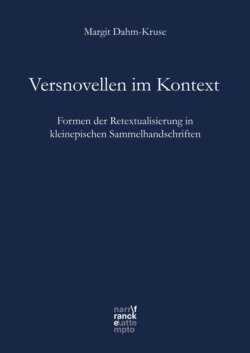Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеDie Kleinepik gehört zu den einflussreichsten und langlebigsten Erscheinungen der volkssprachigen Literatur des Spätmittelalters. Die Entstehung verschiedener, auch neuer Kleinformen der Versdichtung1 stellt eines der markanten Phänomene des Übergangs von der hochmittelalterlichen Periode zum spätmittelalterlichen Literaturbetrieb dar. Der Typus der kleinen Reimpaardichtung mit seinen heterogenen Formen zumeist paargereimter Verserzählungen etabliert sich als ‚Supergattung‘, die das Profil der volkssprachigen Literatur bis in das 16. Jahrhundert hinein entscheidend prägt.2
Unter den vielfältigen Formen der kleinen Reimpaardichtung kommt den mittelhochdeutschen Versnovellen ein besonderer Stellenwert zu.3 Es gehört zu dem markanten poetischen Merkmalen der Textsorte, tradierte Motive und literarische Muster anderer Gattungen wie dem höfischen Roman aufzunehmen, wobei konventionalisierte Erwartungen an die verhandelten Schemata immer wieder konterkariert und in andere Sinnsetzungen überführt werden. Die sprachlich und im Handlungsverlauf meist einfach gestalteten Texte erzeugen durch die Kombination verschiedener, auch gegenläufiger Muster Ambiguität und entziehen sich eindeutigen Sinnstiftungen. In den Erzählinhalten und der narrativen Struktur verweisen insbesondere die frühen Vertreter der Textsorte deutlich auf ihre exemplarische Texttradition. Den Versnovellen ist häufig ein lehrhafter Impetus eigen, der sich in der argumentativen Struktur und in den verhandelten Thematiken manifestiert, die zumeist auf Geschlechter- und Sozialbeziehungen und die damit verbundenen Ordnungsvorstellungen rekurrieren. Gleichzeitig unterlaufen die Texte eindeutige exemplarische Sinnsetzungen, indem sie die thematischen Bezugnahmen und exemplarischen Geltungsbehauptungen oft widersprüchlich darstellen und so Mehrdeutigkeit und Fragwürdigkeit von normativen Geltungskonzepten produzieren. Den Versnovellen ist damit ein hohes Maß an diskursiver und literarischer Reflexion eigen,4 sie stehen beispielhaft für eine literarische Entwicklung, in der tradierte Schemata und etablierte normative Verbindlichkeiten aufgegriffen und kontrovers diskutiert werden.
In der Forschung basieren Verstehens- und Interpretationsansätze zu den Versnovellen bislang nahezu ausschließlich auf der Analyse der Einzeltexte. Tatsächlich ist die Überlieferung aber überwiegend durch Sammelhandschriften geprägt: Die maßgeblich durch den StrickerStricker begründete Tradition der kleinen Reimpaardichtung hat einen eigenen Typus von Handschriften generiert,5 die zumeist verschiedene kleinepische Textformen inkorporieren und in denen die Texte in unterschiedlicher Auswahl, Zusammenstellung und mit divergenten Co-Texten erscheinen. Gleichzeitig variieren die Versnovellen in den verschiedenen Handschriften zum Teil deutlich in ihrem Textbestand.
Während die germanistische Forschung insbesondere im Bereich der höfischen Epik längst die Bedeutung von Überlieferungsgemeinschaften in den Handschriften herausgestellt hat, gibt es für die mittelhochdeutschen Versnovellen nur wenige Untersuchungen, die sich detailliert mit der Möglichkeit planvoller Zusammenstellungen der Codices sowie mit den Interferenzen zwischen Einzeltexten und Sammlungen auseinandersetzen. Insbesondere gibt es keine systematische Untersuchung, die für ein umfangreicheres Korpus an kleinepischen Sammelhandschriften die Prinzipien der Textauswahl und -zusammenstellung betrachtet und nach den daraus resultierenden Sinnstiftungen fragt.
Unabhängig von der Frage planvoller Kompositionen ist der Sammlungskontext in mehrfacher Hinsicht wesentliches Element der Sinnkonstitution des versnovellistischen Einzeltextes. Jede Sammlung fügt den Einzeltext in den übergeordneten Sinnhorizont ihrer Gesamtkonzeption ein und beeinflusst, indem sie je neue, individuelle Lektürezusammenhänge gestaltet, dessen Rezeption. Der Text wird auch über seinen Gebrauch, über seine Funktion und Stellung in der Textgemeinschaft semantisiert. In der Zusammenstellung wird die den versnovellistischen Texten immanente Ambiguität gesteigert, indem mögliche Geltungsansprüche des Einzeltextes durch die Relation zu seiner Sammlungsumgebung unterlaufen werden können; gerade in der Zusammen- oder Gegenüberstellung divergenter Texte kommt die Situationsgebundenheit und Variabilität normativer Geltungen als wesentlichem Moment versnovellistischen Erzählens zum Tragen.6 Gleichzeitig kommt den Versnovellen in den kleinepischen Sammlungen eine wichtige Funktion zu. Sie stellen besondere Markierungen der offenen Sinnpotentiale des Erzählens dar, indem sie durch ihre Poetik relativierender Sinnkonstitution auch für ihre Co-Texte einsinnige Lektüren konterkarieren und zum Hinterfragen von Geltungsbehauptungen auffordern können.
Die Sammlung stellt aber nicht nur den Rezeptions-, sondern auch den Produktionsrahmen des versnovellistischen Einzeltextes dar und kann wesentliches Movens für seine konkrete Gestaltung, für seine individuelle Form sein. Divergente Textzustände können nicht allein mit den Gegebenheiten einer semioralen Kultur erklärt werden, sondern entspringen vielfach geplanter redaktioneller Arbeit am Text. Die spezifische Form des Textes entsteht in einem Spannungsfeld von normativem ‚Werk‘-Status und individueller Realisierung, die auch durch den Kontext der jeweiligen Verwendung geprägt sein kann. Eine Analyse individueller Textgestaltungen im Zusammenhang mit ihren jeweiligen handschriftlichen Kontextualisierungen sucht die Überlieferungsgemeinschaft als greifbaren Parameter für die konkrete Ausformung des Textes fruchtbar zu machen. Sie kann die Prinzipien der Veränderbarkeit von Texten erhellen und Aufschluss darüber geben, wieweit die Form des Textes und seine Überlieferung miteinander verbunden sind.
Mit der Frage nach intentionalen Textarrangements und nach der Entstehung varianter Textgestaltungen wird die Konzeption der kleinepischen Sammelhandschriften als poetischer Prozess fassbar.7 Die Kompilationen sind nicht (nur) im Kontext eines systematischen Zusammenführens von Textgut zu verstehen, das dem Bewahren der literarischen Tradition dient. Ihre Herstellung ist ein poetisches Verfahren, das auf einer Auseinandersetzung mit literarischen Traditionen und den verhandelten Geltungskonzepten und Epistemen basiert. Dabei muss in Rechnung gestellt werden, dass die Sammlungen in nicht klar abgrenzbaren Schichtungen und Genesen aus Vorlagenbeziehungen, tradierten Textsymbiosen, Interessen von Auftraggebern und den spezifischen Profilierungen durch die Schreiber/Kompilatoren als unmittelbaren Produzenten der Sammlungen entstehen, deren literarisches Selbstverständnis in seiner Überschneidung mit und Abgrenzung von Autorschaft Bestandteil der Überlegungen ist.
Konrad von WürzburgKonrad von Würzburg als der vielleicht herausragendste Repräsentant der volkssprachigen Literatur des 13. Jahrhunderts hat kein breites versnovellistisches Œuvre hinterlassen, er ist aber gleichfalls ein wichtiger Vertreter für die sich etablierenden neuen Formen kleinepischer Dichtungen.8 Das ‚Herzmaere‘Konrad von Würzburg›Das Herzmaere‹ als eine der prominentesten und am breitesten tradierten Versnovellen, die außerdem signifikante Divergenzen im Textbestand aufweist, ist ein geeignetes Beispiel, um das Verhältnis von Retextualisierung des Einzeltextes und seiner Kontextualisierung in den Sammlungen exemplarisch in den Blick zu nehmen. Mit dem über das ‚Herzmaere‘ als Modellfall einer vergleichenden Text-Kontext-Analyse gebildeten Untersuchungskorpus wird ein repräsentativer Ausschnitt aus dem kleinepischen Sammelschrifttum in den Blick genommen, darunter einige der Haupthandschriften der kleinen Reimpaardichtung. In der vergleichenden kontextualisierenden Lektüre, die den philologischen Abgleich mit einer hermeneutischen Betrachtung verbindet, ergeben sich neue Perspektiven auf textkritische Fragestellungen wie das Nebeneinander der unterschiedlichen Epilogfassungen.
Die Untersuchung fokussiert zunächst den Cgm 714München, Bayerische Staatsbibliothek›Cgm 714‹ [m], der unter den Überlieferungsträgern des ‚Herzmaere‘ in besonderem Maße durch eine konzeptionelle Gestaltung hervorsticht, die sowohl auf der Ebene der spezifischen Form der Einzeltexte als auch bei der Auswahl und Anordnung des Korpus fassbar ist. Die Textzusammenstellung der Münchner Sammlung wird systematisch abgebildet und nach übergeordneten diskursiven Zusammenhängen und inhaltlichen Relationen zwischen den inserierten Dichtungen befragt. Die kontextualisierende Lektüre zeigt, wie die einzelnen Texte in das thematische Profil der Sammlung eingefügt und spezifisch funktionalisiert werden. Dabei wird überprüft, inwieweit die konkrete Textform einzelner Dichtungen, insbesondere des ‚Herzmaere‘, sinnstiftend mit seinen Co-Texten korreliert und ob die ermittelten Relationen als Indiz einer unmittelbar gestalteten Anpassung der Textgestalt an den Sammlungskontext profiliert werden können.
Im zweiten Untersuchungsteil werden die weiteren Überlieferungsträger des ‚Herzmaere‘ in ihren jeweiligen thematisch-diskursiven Profilen und in den Ausformungen des Referenztextes skizziert. Die Zusammenschau der Codices bildet ein breites Spektrum möglicher Sammlungstypen ab, die den gleichen Einzeltext durch verschiedene Verfahren der Inkorporierung integrieren können. Der Überlieferungsvergleich zeigt, wie der gleiche Text in divergenten Kontexten unterschiedlich semantisiert und funktionalisiert werden kann und welchen Einfluss die Textumgebung auf seine Rezeption hat.
Zusammenstellungen volksprachiger Kleinepik treten auch in Form buchliterarisch konzipierter Autor-Sammlungen in Erscheinung. Frühes Beispiel und zugleich ein wichtiger Referenztext innerhalb der europäischen kleinepischen Erzähltradition ist Boccaccios ‚Decameron‘Boccaccio, Giovanni›Das Decameron‹, das verschiedenes literarisches Material zusammenführt und in einen narrativen Zusammenhang integriert. Das ‚Decameron‘ als eigentlich kontemporäre Vergleichskonstellation wird oft als Schwellentext gelesen, an dem ein signifikanter Paradigmenwechsel sowohl in der Poetik des novellistischen Einzeltextes als auch in der Gesamtkonzeption der Sammlung festgemacht wird. Durch die vergleichende Betrachtung können sowohl die gattungsästhetischen Parameter, die für das versnovellistische Erzählen bestimmt wurden, als auch die Kompilationsprinzipien der untersuchten kleinepischen Sammlungen aus einer komparatistischen Perspektive beleuchtet und die Alterität des untersuchten Sammlungstyps genauer profiliert werden. In die vergleichende Reflexion werden auch die frühneuzeitlichen Schwanksammlungen als ein verbreiteter Buchtyp eingebunden, der durch die Rekurrenz auf vergleichbare Erzähltraditionen sowie durch ähnlich heterogene Sammlungsprinzipien Parallelen zu den mittelalterlichen Sammelcodices hat, aber dennoch einen anderen, durch die veränderten Paradigmen des Medienwandels geprägten Kompilationstyp darstellt. Ähnlich wie das ‚Decameron‘ stellen die frühneuzeitlichen Schwanksammlungen dem heterogenen tradierten Material Strategien der Homogenisierung und Autorisierung gegenüber, die sich deutlich von der Kompilationspraxis der kleinepischen Sammelhandschriften abheben.