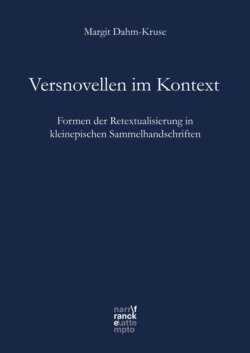Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Varianz im Forschungsdiskurs
ОглавлениеDie variante Überlieferung mittelalterlicher Texte war in der Germanistischen Forschung zunächst kaum Gegenstand einer hermeneutischen Verhandlung, sondern primär ein Arbeitsfeld der Editorik. Die durch Lachmann begründete Tradition der Textkritik, die den Beginn einer systematischen Editionswissenschaft markiert, fasste mit ihrer Fokussierung der Rekonstruktion eines Autor- oder Urtextes die textuelle Varianz vor allem als Überlieferungsverschlechterung und Störfaktor bei der Herstellung eines einheitlichen kritischen Textes.
Die Frage nach der semantischen Relevanz von textueller Varianz und der Unterscheidung von Werkfassungen ist maßgeblich für die editorische Praxis:
alle handschriftliche Kultur teilt jedoch das Varianz-Phänomen. Mit der Varianz in rechter Weise umzugehen, stellt vielleicht das entscheidende, grundlegende Problem aller (mediävistischer) Editionswissenschaft dar.1
Die methodischen Einschränkungen und problematischen Vorannahmen der klassischen Textkritik, insbesondere die Subjektivität des Verfahrens und die primär ästhetischen Prinzipien folgenden Entscheidungen über bessere oder originale Textzustände, waren frühzeitig Gegenstand der Kritik und Anlass von Forschungsdiskussionen und Neujustierungen in der Editionspraxis. Nicht nur bedingt eine das ‚originale Dichterwort‘ rekonstruierende Editionspraxis letztlich das philologische Paradox der Negierung der Handschriften,2 für die meisten Bereiche mittelalterlicher Textualität ist es auch längst offensichtlich, dass die Überlieferungsbedingungen die Anwendung der textkritischen Methode nach Lachmann gar nicht gestatten.3
In der Diskussion des mittelalterlichen Textbegriffs hat sich angesichts des nicht hierarchisierbaren Nebeneinanders unterschiedlicher Redaktionen eine grundsätzlich geänderte Perspektivierung von Varianz etabliert:
mit der fortschreitenden Erschließung umfangreicher, in zahllose Varianten und Parallelfassungen verzweigter volkssprachlicher Überlieferungsgeflechte hat sich in den mediävistischen Philologien eine deutliche Skepsis gegenüber den Zielen und Methoden der klassischen Textkritik und Edition entwickelt, weil es sich oft als unmöglich erwies, die Komplexität der Manuskriptkultur auf einen ursprungs- und autornahen Text zu reduzieren.4
Cerquiglinis 1989 erschienene Streitschrift ‚Éloge de la variante‘,5 die wesentlich auf Zumthors Konzept der ‚mouvance‘ basiert,6 intensivierte die Debatte, indem Varianz nicht nur als ein zentraler Aspekt mittelalterlicher Textualität gefasst, sondern als deren eigentliches Wesen verabsolutiert wird, das in in dem viel diskutierten Diktum zusammengefasst wird, dass mittelalterliche Schrifttexte nicht Varianten haben, sondern Varianz seien. Cerquiglini und der an ihn anschließenden und unter dem Begriff der ‚New Philology‘ verschlagworteten Debatte ist verschiedentlich vorgeworfen worden, nichts genuin Neues zu vermitteln, sondern im Wesentlichen die bereits etablierte Einsicht zu verhandeln, dass der mittelalterliche Text in seinem Variantenreichtum durch die herkömmliche Philologie nicht adäquat abgebildet wird.7 Eine Neuakzentuierung stellt aber die Verbindung der Thesen mit postmodernen Theorien dar, die sich vor allem in der Kritik des traditionellen Autor- und Werkbegriffs und der Negation jeglichen Originalitätsanspruchs manifestiert. Die Negierung subjekthafter Kategorien wie Autor oder Schreiber, an die sich Varianz bzw. der Text an sich rückbinden lässt, bedingt letztlich eine Absage an jede fassbare Intentionalität bei der Textgestaltung.8 Damit macht die von einigen Vertretern der New Philology postulierte völlige Regellosigkeit und Permanenz der Varianz nicht nur jedweden Versuch einer Analyse von deren Genese obsolet,9 sie führt auch hinsichtlich einer Semantisierung von Varianz in den gleichen Stillstand wie die klassische Textkritik. Wird die Sinnhaftigkeit und Intentionalität von Varianz von der klassischen Textkritik negiert, indem sie diese als zu vernachlässigenden Bestandteil eines überlieferungsgeschichtlichen Verfallsprozesses fasst, bedingt die New Philology durch das gegensätzliche Diktum verabsolutierter Varianz eine rein phänomenologische Betrachtung, die gleichfalls weder eine hermeneutische noch eine funktionale Perspektivierung ermöglicht:
The monolithic view of medieval vernacular textuality as an uncontrolled, amorphous, and procrustean verbal mass is both a postmodern critical manoeuvre and a serious obstacle to our understanding of the sheer variety of scribal behaviour.10
Seit den 1990er Jahren erschienen verschiedene Arbeiten vor allem zur höfischen Epik als dem zentralen Bereich der klassischen Textkritik, die stattdessen Varianz im Kontext des Textgebrauchs und als Ausdruck literarischer Interessenlagen analysierten.
So sieht Bumke die verschiedenen Fassungen von Texten als Ausdruck eines individuellen Gestaltungswillens.11 Ähnlich Henkel, der insbesondere in den aus der Perspektive moderner, normativer Ästhetik als ‚literarische Minderware‘ eingestuften Kurzfassungen nicht sekundäre Textverschlechterungen, sondern das Ergebnis literarischer Urteilsfähigkeit und einer produktiven Auseinandersetzung mit den Texten sieht. Für Henkel manifestiert sich in der Koexistenz divergenter Textfassungen eine vielschichtige literarische Interessenbildung, innerhalb derer sich die reproduzierenden Instanzen die Texte aneignen und in der Adaption einem Wandel unterziehen.12 Löser beschreibt die variable Gestaltung von Texten als eine unmittelbare Verschränkung von Rezeption und Produktion, in der sich ein Wissen um die Möglichkeit ausdrückt, Texte verschieden zu lesen.13
Strohschneider sieht die variierende Gestaltung von Texten als Resultat einer prinzipiellen Einbindung der Literatur in kommunikative Situationen: „Schriftliche Kommunikation bleibt vielmehr im Mittelalter weithin an interaktive Verständigung unter Anwesenden, an deren Funktion und Modalitäten gebunden.“14 Der Text als aktualisierte Kommunikation von tradierten Texten und dem dort bewahrten Wissen ist eine funktional determinierte Größe, die Varianz erscheint als Ausdruck einer offenen literarischen Kommunikation, in der der Text noch nicht „an die stabile soziale Institution des Autors sowie an generalisierte und anonymisierte Kommunikationsverhältnisse“ gebunden ist.15 Baisch wendet gegen Strohschneiders kommunikationspragmatische Perspektive ein, dass diese durch die Anbindung des Textes an den situativen Rahmen den kommunikativen bzw. performativen Aspekt verabsolutiert und damit letztlich die Bedeutung von Skripturalität und auch der materiellen Komponente unterminiert.16 Die Auffassung des Textes als kommunikative Handlung ist dennoch produktiv im Sinne eines prozesshaften Textverständnisses, das die unterschiedlichen Redaktionen von Texten als Ausdruck einer Interaktion von Tradition und individuellem Textverständnis bzw. -gebrauch sieht und damit das „Moment der Aktualisierung des Werkes, der Adaptation an einen gewandelten Sinnhorizont als das entscheidende Charakteristikum von Überlieferung grundsätzlich betont.“17
Varianz als Ausdruck der Gebrauchs- und Verstehenszusammenhänge des Textes bedingt ein anderes Verständnis von dessen Interpretierbarkeit: Der Text kann nicht nur als klar umrissener Autortext, sondern auch in der Summe seiner varianten Gestaltungen interpretiert und nach Verfahren der Banalisierung, Harmonisierung, Komplexitätssteigerung und der Anpassung an Kontexte untersucht werden: „statt eines Einzeltextes ist ein Ensemble von Texten und der Spielraum seiner Variation zu interpretieren.“18
Gerade im Bereich der Kleinepik, in der variante Textgestaltungen schon durch die Kürze der Texte besonderes Potential für Sinnveränderung haben, bietet eine hermeneutische Analyse, die mit einer philologischen Betrachtung der unterschiedlichen Redaktionen des Textes verbunden ist, die Möglichkeit, nicht nur den Text an sich im Spektrum seiner Überlieferungsvielfalt zu interpretieren, sondern daraus auch Textgebrauch und -verständnis zu erschließen.