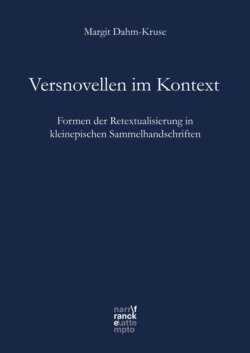Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Die Sammlung als Kontext 4.1 Kleinepische Sammelhandschriften
ОглавлениеMit dem Beginn des 14. Jahrhunderts ist ein Quantitätssprung in der Überlieferung versnovellistischer Texte fassbar, die zunehmend in großen Sammelhandschriften überliefert werden, die nur oder überwiegend Verspaarerzählungen enthalten und in denen die Texte in unterschiedlicher Auswahl und Zusammenstellung erscheinen.1
Es finden sich unter den kleinepischen Sammelhandschriften praktisch keine homogenen versnovellistischen Kompilationen, sondern die Versnovellen sind in den Sammlungen stets eingebunden in andere Textsorten. Vornehmlich werden sie mit weiteren Formen der kleinen Reimpaardichtung überliefert, vor allem mit den generisch nahestehenden Bîspeln und Exempla, häufig auch mit Minnereden.2 Weiterhin finden sich in der Mitüberlieferung verschiedene Formen der Spruchdichtung, geistliche Lehrgedichte und großepische Dichtungen, gelegentlich sind auch historiographische oder pragmatische Prosatexte eingebunden.3 Die Sammlungen setzen unterschiedliche Schwerpunkte in der Textauswahl und der Mitüberlieferung, teilweise finden sich gattungsmäßige Gruppierungen; aber auch andere Prinzipien sind fassbar, etwa Autorbezüge oder thematische Schwerpunkte wie die Fokussierung auf religiöse oder schwankhafte Inhalte.4 Die Sammlungen treten aber zumeist nicht als kohärente Zusammenstellungen hinsichtlich der Textsorten, der thematischen Bezüge, der Autoren oder anderer vereinheitlichender Gesichtspunkte in Erscheinung. Die Anordnung der Texte basiert selten auf homogenen inhaltlichen oder strukturellen Verfahrensweisen, sondern in unterschiedlichen Teilen der Sammlung können divergente Prinzipien wirksam sein:5
Eine Sammelhandschrift bietet unterschiedliche Möglichkeiten, einzelne Texte und Textkorpora als zusammengehörig oder voneinander abgetrennt zu betrachten. Von Interesse können inhaltliche, kodikologische, überlieferungsgeschichtliche oder texttypologische Kriterien sein. Was unter einem bestimmten Blickwinkel als „Sammlung“ erscheint, kann aus einer anderen Perspektive ausgesprochen heterogen wirken.6
Diese zum Teil konzeptionslos wirkenden Zusammenstellungen haben die Annahme verstärkt, dass der Einzeltext aus sich selbst heraus verstanden werden müsse und der Codex als Verständnisrahmen nicht oder nur sehr bedingt herangezogen werden könne. Während für den Bereich der großepischen Dichtungen in der germanistischen Forschung schon früh auf die Bedeutung des Verbunds von Texten in Handschriften hingewiesen wurde,7 gibt es für die Versnovellen nur wenige Forschungsarbeiten, die sich mit der Möglichkeit einer planvollen Zusammenstellung der Texte oder einer intendierten Gesamtkonzeption der Codices auseinandersetzen und so zu ganz anderen Ergebnissen führen können als die Einzeltextanalysen.8
Die Zusammenstellung der Sammlungen kann nicht allein aus Überlieferungszufall und planloser Willkür erklärt werden, vielmehr ist davon auszugehen, dass diese auch Ergebnis intendierter, auf sekundärer Autorschaft beruhender Gestaltung ist.9 Pragmatische Faktoren wie die – selten lückenlos rekonstruierbare – Vorlagensituation sind zweifellos Teil der historischen Wirklichkeit der Handschriftenerstellung,10 schließen planvolle Konzeptionen aber nicht aus. Auch die Übertragung aus Vorlagen bedingt immer eine Auswahl, eine Entscheidung für bestimmte Ausschnitte des Materials sowie für die Anordnung und die Art der Realisierung.11 Selbst wenn eine Sammlung in ihrer Gesamtheit weitgehend unverändert reproduziert wird, so wurde doch die abgeschriebene Vorlage konzipiert. Es ist auch davon auszugehen, dass der Erstellung kleinepischer Sammlungen ein breiteres Repertoire an Texten zugrunde gelegen hat, als in die jeweilige Kompilation übernommen wurden. Viele der kleinepischen Kompilationen sind in arrivierten literarischen Zentren des Spätmittelalters wie Nürnberg oder Augsburg entstanden, in denen eine umfangreiche Produktion und Distribution von Handschriften stattfand. Ziegeler konstatiert genuin für die Erstellung kleinepischer Sammelhandschriften in Augsburg, dass „alles, mitunter doppelt und dreifach, zu erhalten war, was das Genre ‚kleine Reimpaardichtung‘ zu bieten hatte.“12 Anders als bei generisch homogenen Kompilationen wie zum Beispiel den Liederhandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts, bei denen die Auswahl vor allem texttypologisch motiviert war und die Anordnung einem klaren Ordnungsmuster (Autorencorpora) folgte, erfordern gerade heterogene Sammlungen gezielte Entscheidungen über die Auswahl und Anordnung der Texte; sie machen in besonderem Maße eine Reflexion über inhaltliche Relationen und gemeinsame Subtexte plausibel.
Die Auswahl und Anordnung der Texte in den kleinepischen Sammelhandschriften basiert in offenbar nicht wenigen Fällen auf intentionalen Prinzipien. Das häufigste und in nahezu allen kleinepischen Kompilationen fassbare Anordnungsprinzip ist die Gestaltung inhaltlich oder motivlich korrespondierender Textpaare und Kleingruppen,13 die wiederum unterschiedlich kombiniert und arrangiert werden können. Solche thematischen Analogien zwischen Texten stellen keine Ausnahme dar, sondern sind ein grundlegendes Gestaltungsprinzip im kleinepischen Sammelschrifttum.14 Häufig sind Textgruppen auch als feste Überlieferungseinheiten fassbar, die jeweils eine individuelle Überlieferungstradition haben und in verschiedenen Sammlungen in gleicher Zusammenstellung erscheinen.15
Die Anordnung in kleinen Textgruppen sieht Ziegeler als Indiz einer größeren thematischen Ordnung in älteren (nicht mehr vorhandenen) Vorlagen, die bei der Übernahme in die erhaltenen Sammlungen nicht beibehalten wurden.16 Zu fragen ist allerdings, wie sich ein solcher Paradigmenwechsel in der Komposition von Textsammlungen begründet. Bei stringent thematisch geordneten Vorlagen muss es Beweggründe geben, die auf breiter Ebene und binnen eines relativ kurzen Traditionszeitraumes zur Auflösung dieser Ordnung und zum sprunghafteren Arrangieren von Texten geführt haben.17
Eine Anordnung von Texten in Paaren und kleinen Gruppen ist als grundlegendes Gestaltungsprinzip und nicht (nur) als Auflösungsphänomen und Überrest einer stringenteren Ordnung zu fassen. Die Zusammenführung von Textpaaren und -gruppen, die aus verschiedenen Gründen als zusammengehörig empfunden werden, stellt die kleinste Ebene der Textorganisation in der Sammlung dar. Der Zusammenhang zwischen den Texten kann in unterschiedlichen, auch unverbindlich oder beliebig erscheinenden Verknüpfungen bestehen; die Zusammenstellung gestaltet sich oft als ein aggregatives und scheinbar assoziatives Erzählen von Text zu Text, das lose Analogien auf verschiedenen Ebenen herstellt, die sowohl auf Gemeinsamkeiten als auch auf Gegensätzen basieren können.18
Zum Vergleich sei auf die Prinzipien der Verknüpfung in Boccaccios ‚DecameronBoccaccio, Giovanni›Das Decameron‹‘ verwiesen. Die Überlieferung kleinepischer Texte im deutschsprachigen Raum unterscheidet sich zunächst signifikant von buchliterarisch konzipierten Sammlungen mit narrativem Rahmen, wie sie mit dem ‚Decameron‘ oder Chaucers ‚Canterbury talesChaucer, Geoffrey›The Canterbury tales‹‘ vorliegen. Die Sammlungen Boccaccios oder Chaucers stellen ihre Gesamtkonzeption narrativ heraus und fordern darüber eine Rezeption ein, die die einzelnen Texte als Bestandteil eines Erzählzusammenhangs wahrnimmt, während die kleinepischen Sammlungen keinen narrativen Kontext explizieren. Aber in der tatsächlichen thematischen Verbindung der Einzeltexte sind ‚Decameron‘ und ‚Canterbury tales‘ den kleinepischen Kompilationen vergleichbar, indem die Einzeltexte ebenfalls oft in paariger Konstellation erscheinen, deren inhaltliche Verklammerung ähnlich lose ist wie in den ungerahmten kleinepischen Sammlungen.19 Eine Verknüpfung erfolgt im ‚Decameron‘ vor allem durch die einleitenden Kommentare der Erzählerfiguren, die den Inhalt der vorgängigen Erzählung aufgreifen und die eigene Narration durch das Aufzeigen von thematischen Gemeinsamkeiten oder auch Oppositionen anschließen, wobei die Verknüpfungsmomente ganz divergent ausfallen können.20 Ähnlich verfährt auch Chaucer in den ‚Canterbury tales‘, wo die Geschichten inhaltlich ebenfalls nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, aber durch die Kommentare der Erzähler miteinander verbunden werden.21 Die ungerahmten kleinepischen Sammlungen unterscheiden sich damit weniger durch die inhaltliche Disparität der Texte, die auch die buchliterarisch konzipierten Novellensammlungen kennzeichnet, sondern durch die fehlende narrative Instanz, die die Anknüpfungsmomente offenlegt bzw. vorgibt.
Neben inhaltlichen Arrangements ist auch die Frage generischer Ordnungsmuster relevant. Während es für andere Typen der kleinen Reimpaardichtung durchaus Beispiele gattungsmäßig weitgehend kohärenter Zusammenstellungen gibt, dazu zählen Exempel- und Fabelsammlungen, aber auch die umfangreichen Bîspelreihen in zahlreichen kleinepischen Kompilationen wie dem Cpg 341Heidelberg, Universitätsbibliothek›Cpg 341‹ [H], gibt es kaum Zusammenstellungen von Versnovellen, die über Kleingruppen oder kurze Textreihen hinausgehen.
Die Heterogenität der Texte, die in den meisten kleinepischen Sammlungen fassbar ist, sollte aber nicht zu der Annahme verleiten, dass es keine konzeptionellen Strukturen und intendierten semantischen Effekte gibt. Ruh verweist auf einen besonderen utilitas-Gedanken in den mittelalterlichen Codices, der keine strikte Trennung von Textsorten kennt. Vielmehr ist die volkssprachige Überlieferung durch das Nebeneinander heterogener Textsorten aus religiösem, poetischem und pragmatischem Schrifttum bestimmt.22 Die mittelalterlichen Textzusammenstellungen verweisen dabei auf andere Vorstellungen von kompilatorischer Stringenz, als sie der modernen Textualität zugrunde liegen.23
Der vergleichende Blick auf die Enzyklopädik als einem Textbereich, der gleichfalls verschiedenes Material sammelt und zusammenfügt, lässt grundlegende Paradigmen erkennbar werden, nach denen Texte und das durch sie vermittelte Wissen organisiert sind.24 Poetische und enzyklopädische Textualität sind gerade in der mittelalterlichen Dichtungspraxis keine dichotomisch voneinander abgegrenzten Bereiche. Nicht nur lässt sich häufig eine narrative Integration enzyklopädischer Wissensbestände in poetischen Texten beobachten,25 literarische Texte können auch selber Medien einer Wissensdiskursivierung sein, wie es in kleinepischen Texten durch die häufige Rekurrenz auf Ordokonzepte und soziale Normierung fassbar ist. Hagby sieht eine Parallele zwischen kleinepischer Textsammlung und Enzyklopädie, indem letztere nur ein besonders vollständiges Beispiel sei für die verbreitete Vorstellung, eine Sammlung von Texten als Abbildung der Welt oder von Teilen der Welt zu betrachten.26 Nun unterscheiden sich die Enzyklopädien in ihrer Ausrichtung auf eine systematisierende und vollständige Wissensabbildung und durch ihre einheitlichen Autorinstanzen erheblich von den anonym kompilierten kleinepischen Sammlungen; der Vergleich dient primär als heuristisches Mittel, um die Prinzipien der mittelalterlichen Kompilationspraxis zu verdeutlichen, die offen für das Nebeneinander von divergentem Material ist.
Die im 13. Jahrhundert entstandene und unter dem Gesamttitel ‚Speculum maiusVinzenz von Beauvais›Speculum maius‹‘ zusammengefasste vierteilige Enzyklopädie des Vinzenz von Beauvais als größtem bekannten enzyklopädischem Werk des Mittelalters sucht das ‚Weltwissen‘ in einer systematischen Ordnung zusammenzustellen.27 Das zugrunde liegende Kompilationsprinzip basiert auf einer Mischung von historiographischen Texten mit kirchen- und geistesgeschichtlichen Exkursen sowie moralischem Schrifttum;28 neben christlichen Autoritäten wird auch auf pagane Autoren zurückgegriffen.29 Das Nebeneinander von Disparatem, auch Widersprüchlichem ist damit Bestandteil der kompilatorischen Arbeit des Enzyklopädikers.30
An der von Vinzenz praktizierten Art des Kompilierens solch divergenter Text- und Wissensbestände nahm die germanistische Forschung des frühen 20. Jahrhunderts Anstoß31 – in der zeitgenössischen Rezeption war das Nebeneinander von historiographischem, exegetischem und moralischem Schrifttum, das sich schon in den inhaltlichen Schwerpunkten der vier Teile des ‚Speculum maius‘ (historiale, doctrinale, naturale, morale) widerspiegelt, dagegen offenbar nicht Ausdruck mangelnder Stringenz, sondern wurde als genuiner Bestandteil der Konzeption akzeptiert. Gerade die Divergenz der Texte ermöglicht es, das Lernen der bzw. aus der Historie mit einer moralischen und heilsgeschichtlichen Dimension der Ereignisse zu verbinden.
Dieser Heterogenität und Fülle des Materials stehen nach verschiedenen Gesichtspunkten gestaltete Ordnungsprinzipien gegenüber: „Das Geschäft des Enzyklopädikers ist die Ordnung der Dinge“, aber diese Ordnung ist auch in der Enzyklopädie nicht vorgegeben, sondern sie wird durch den Enzyklopädiker erzeugt nach Parametern, die er selber setzt.32 Vor allem verlangt die Gesamtkonzeption einer systematischen Welt- und Wissensabbildung nicht die Verwendung homogener Textgrundlagen, sondern eine Interpretation der Zusammenhänge verschiedener Wissens- und Textbereiche.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich auch für die kleinepischen Textkollektionen eine andere Lesart. Die Heterogenität der im Codex inserierten Texte stellt keinen Widerspruch zu der Annahme einer stinnstiftenden Gesamtkonzeption dar, denn die Zusammenführung divergenten, auch nicht genuin literarischen Materials ist fester Bestandteil der mittelalterlichen Kompilationspraxis. Stephan Müller hat Inkohärenzen in Sammelhandschriften des 12. und 13. Jahrhunderts als eine Möglichkeitsbedingung der höfischen Kultur auf der Ebene der Textpraxis beschrieben, die Weltliches und Geistliches sowie Normatives und Absurdes in ein spezifisches Spannungsverhältnis bringt.33 Die Engführung von geistlichen und weltlichen, moralisch-exemplarischen und schwankhaften oder anderweitig divergierenden Texten stellt gerade in kleinepischen Sammlungen ein wichtiges Prinzip dar. Die Sammlungen zielen möglicherweise gar nicht auf eine kohärente Programmatik und Stringenz ab, sondern intendieren Brüche und ein konzeptionelles Nebeneinander unterschiedlicher Perspektiven. Das Nebeneinander divergenter Texttypen und konfligierender Sinnsetzungen bedeutet aber nicht, dass der Anspruch auf inhaltliche Stimmigkeit aufgegeben wird, sondern bezeugt, dass die kleinepische Kompilationspraxis eine repräsentative Gesamtheit der Texte intendiert, die ein dialektisches Nebeneinander und die wechselseitige Durchdringung unterschiedlicher Texttypen und Sinnsetzungen als Bestandteil ihrer Konzeption einschließt.
Dass die Sammlungen unabhängig von der Frage thematischer oder generischer Homogenität nach übergeordneten, planvollen Prinzipien erstellt wurden, legt die äußere Gestaltung der Handschriften nahe. In der Regel kennzeichnet die Codices eine vereinheitlichende Gestaltung der Einzeltexte, etwa durch die gleichförmige Verwendung von Initialen und anderen Gestaltungselementen, durch die häufig anzutreffende Formulierung gleich lautender Tituli oder Schlussverse, gelegentlich auch durch Register oder Gesamtüberschriften, wodurch auch heterogenen Zusammenstellungen der äußere Eindruck einer Geschlossenheit gegeben wird.34 Meyer spricht der Zusammenführung des disparaten Textmaterials in den deutschen volksprachigen Handschriften eine große Bedeutung zu: „obviously book production and manuscript transmission plays a much more important part in the German tradition than the cyclical organizing or framing work of an author.“35
Trotz generischer und thematischer Heterogenität können Sammlungen als zusammenhängende Gesamtkonzeptionen aufgefasst werden. Das macht die in Michaels de Leone ‚HausbuchMichael de Leone›Hausbuch‹‘ inkorporierte Mären- und Bîspelsammlung anschaulich, die in der Forschung unter dem Titel ‚Die Welt›Die Welt‹ (siehe auch Michael de Leone ‚Hausbuch‘)‘ verschlagwortet wurde. Das 19. Kapitel des ‚Hausbuches‘ überliefert ein Korpus von 57 kleineren Reimpaardichtungen, vorrangig Bîspel sowie zwölf Versnovellen. Übereinstimmende Textzusammenstellungen in anderen Sammlungen legen nahe, dass diese Kollektion auf der Vorlage einer älteren, bereits vor 1260 entstandenen Sammlung basiert. Das ‚Hausbuch‘ führt dieses Korpus explizit als Sammlung von Bîspeln und Exempeln ein, indem die Überschrift ‚Hie hebt sich an daz buoch daz do heizet die werlt. Daz sagt von bispel vnd von mern‘ (fol.68v) vorangestellt wird, der als einer der ersten Gesamtüberschriften einer Handschrift in der mittelhochdeutschen Literatur besondere Signifikanz zukommt.36 Auch die dem Codex Bodm. 72Cologny-Genf, Bibl. Bodmeriana›Cod. 72‹ [K] vorangestellte Überschrift ‚Daz buche heiset gesampt habentewer‘ (fol.IIr) zielt auf eine Rezeption, die für die Summe der aufgeführten Texte den Status eines Gesamtkonzepts beansprucht.37