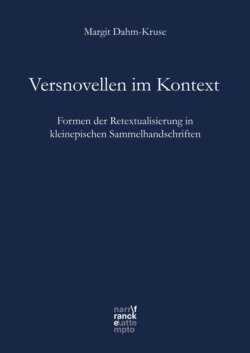Читать книгу Versnovellen im Kontext - Margit Dahm-Kruse - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5.2 Schreiber und Kompilator
ОглавлениеDas Nebeneinander verschiedener Ausformungen von Texten erfordert eine gezielte Auseinandersetzung mit der Institution der Schreiber als Produzenten der unterschiedlichen Redaktionen. In der Forschungsdebatte steht vorrangig der Autorbegriff im Fokus,1 aber faktisch kommt auch dem Schreiber eine enorme Relevanz im mittelalterlichen Literaturbetrieb zu:
Der Größe Schreiber war man sich im lateinischen wie im volkssprachigen Literaturdiskurs als entscheidende Mittlerinstanz zwischen Autor und Rezipient bewußt. Er sorgte für den Transport der Texte. Er zeichnete für die Verbreitung der Werke verantwortlich. Er war Garant von Textqualität und Textintegrität.2
Für die kleinepischen Sammlungen ist die Institution der Schreiber von besonderem Interesse, weil diese nicht nur die spezifische Ausformung der Einzeltexte gestalten, sondern auch die Sammlung als Gesamtkonzept prägen. Die Art und Weise, wie die Schreiber die Manuskripte zusammenstellen und gestalten, stellt einen wichtigen Schlüssel sowohl zum Verständnis der Texte als auch zum literarischen Selbstverständnis der Zeit dar. Die Perspektivierung der produktionspraktischen Verhältnisse verdeutlicht, dass unter den Bedingungen der Manuskriptkultur von einem erweiterten Textmodell auszugehen ist, das verschiedene Funktionen und auch Institutionen umfasst. Der Schreiber einer Sammlung ist zugleich als Editor und als Akteur eines kreativen Prozesses fassbar, der die Texte auswählt und positioniert, aufbricht und zusammenfügt.3 Die Erstellung der Sammelhandschriften ist zwar durch Vorlagen und Traditionen geprägt, dennoch ist sie ein poetisches Verfahren, bei dem sich in besonderem Maße die strikten Distinktionen zwischen Autor und Schreiber sowohl auf der Ebene der Form des Einzeltextes als auch der Zusammenstellung der Texte auflösen. Fragt man nach den Prinzipien der Veränderbarkeit von Texten, insbesondere im Kontext der Anpassung an die Sammlungsumgebung, steht zwangsläufig die Institution des Schreibers in ihrer Überschneidung mit und Abgrenzung von Autorschaft im Fokus der Überlegungen.
Die Schreiber stellen als Institution, in ihrem Zugriff auf die Texte sowie in ihrem Selbstverständnis ein heterogenes und historisch variables Phänomen dar. Sie demonstrieren auf institutioneller Ebene die enge Verbindung der volkssprachigen Schriftlichkeit mit der lateinisch-klerikalen Bildungswelt: Bis in das 12. Jahrhundert existierten sowohl Skriptorien als auch Bibliotheken fast ausschließlich in klösterlichen und bischöflichen Institutionen, entsprechend wurden Manuskripte überwiegend durch Geistliche gefertigt; schreibende Laien waren im frühen und hohen Mittelalter die Ausnahme. Zwar treten ab dem 12. Jahrhundert zunehmend weltliche Fürstenhöfe als literarische Zentren und Produktionsorte der volkssprachigen Literatur in Erscheinung, aber auch hier sind die Schreiber zumeist in klerikale Strukturen eingebunden, zumal die schulische Bildung in geistlichen Institutionen verortet bleibt.4 Erst ab dem Ende des 13. Jahrhunderts treten im Zuge des immensen Anstiegs vor allem der pragmatischen Schriftproduktion zahlreiche neue, auch weltliche Kanzleien in Erscheinung, die vorrangig der Produktion von Rechts- und Verwaltungsschrifttum dienten und dabei keinesfalls nur volkssprachiges Textgut produzierten, sondern weiterhin wesentlich von der lateinischen Schriftlichkeit geprägt waren.5 Ein wichtiger Faktor sowohl für den Aufschwung der Buchproduktion an sich als auch für die Etablierung einer Laienschriftlichkeit waren die Universitäten und zunehmend auch die städtischen Bildungseinrichtungen.6 Erst mit dem 15. Jahrhundert ist neben dem Kanzleischrifttum auch vermehrt eine Produktion literarischer Texte durch Stadt- und Ratsschreiber, Notare, Sekretäre und professionelle Kopisten fassbar,7 weiterhin etablierten sich professionelle Schreibschulen und Schreibwerkstätten, die den Bedürfnissen einer größer werdenden und sich diversifizierenden Rezipientenschicht nachkamen. Namentlich fassbar ist die Werkstatt Diebold LaubersDiebold Lauber, in der zwischen 1425 und 1467 gewerbsmäßig deutsche Handschriften für den Verkauf produziert wurden.8 Auch treten zunehmend Privatpersonen aus der städtischen Oberschicht als Schreiber in Erscheinung, die Bücher für den Eigenbedarf kopierten.XX
Während die klassische Textkritik den Schreiber noch als ein ‚notwendiges Übel‘ angesehen hat, von dessen störenden und verderbenden Eingriffen die Texte zu reinigen waren, hat sich in der Mediävistik mit der Einstellung zum Text und der handschriftlichen Überlieferung auch die Betrachtung des Schreibers geändert.9 Dennoch ist die Kenntnis von der Arbeit der Schreiber immer noch rudimentär,10 insbesondere gibt es bislang wenige Forschungsbeiträge, die diese nicht primär unter dem Aspekt der handwerklichen Buchproduktion, sondern auch in ihrer poetologischen Funktion reflektieren.11
Bedeutet die Schreibtätigkeit theoretisch die genaue Wiedergabe der Vorlage, bedingt schon die Anpassung an individuelle und regionale Schreibgewohnheiten Veränderungen des Textes, denen gezielte Entscheidungsprozesse der Schreiber zugrunde liegen können.12 Faktisch zeigt das Nebeneinander zum Teil sehr divergenter Redaktionen, dass insbesondere die volkssprachigen Schreiber ihre Funktion breiter fassten; Abschrift und Umarbeitung des Textes sind vor allem für die spätmittelalterlichen Schreiber oft untrennbar miteinander verbunden.13 Auch wenn sich eine Intentionalität in der gestaltenden Texttradierung nicht verbindlich nachweisen lässt, sind die unterschiedlichen Redaktionen und Fassungen von Dichtungen längst nicht immer Ausdruck von Willkür und entstellenden Kopiervorgängen. Oft zeugen sie von einer produktiven Auseinandersetzung, die ein hohes Maß an literarischer Kenntnis und Urteilsfähigkeit voraussetzt,14 und machen die Umgangsweisen mit (literarischer) Autorität fassbar:
Yet it is of the utmost importance to try and establish how they [the scribes] behaved with respect to what they were copying, for this can tell us much about the medieval attitude to language and authority.15
In der Forschung hat die Arbeit der Schreiber eine gegensätzliche Beurteilung erfahren, die durch die Pole detailgenauer Übernahme der Vorlage und intentionaler Gestaltung oder sogar eigenständiger Dichtung markiert wird. Wurde der gestaltende Einfluss der Schreiber in der traditionellen Textkritik vielfach auf die Vorstellung einer Verschlechterung des vermeintlichen Originals reduziert, haben unter anderem die Arbeiten Bumkes auf die Überschneidung von Schreiber und Autor hingewiesen. Bumke koppelt, indem er den Werkbegriff vom Original auf die Fassungen verschiebt, die unterschiedlichen Redaktionen weitgehend von der Autorinstanz ab, womit die Schreiber als Produzenten der Fassungen auch zu werkschaffenden Instanzen werden.16
Die Überlieferungswirklichkeit wird weder durch generalisierende Vorstellungen von Schreibern als pragmatisch-mechanischen oder sogar nachlässigen Kopisten noch von dem gegenteiligen Extrem der Vorstellung als grundsätzlich kreativen Produzenten eigenständiger Textfassungen adäquat abgebildet,17 vielmehr machen „beide Extreme wie alle Nuancen dazwischen erst in ihrer Gesamtheit die mittelalterliche Schrift- bzw. Schreibkultur aus“, wobei „so verschiedene Faktoren wie Textsorte, Intentionalität, Auftraggeberwille, Schreiberintelligenz und Mode“ über die genaue Relation zwischen beiden Momenten entscheiden.18
Die genaue Zuweisung der konkreten Textform zum Autor oder Schreiber und damit eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Ebenen der Textproduktion ist kaum rekonstruierbar, zumal die Schreiber oft eine anonyme Institution darstellen, die Art und Umfang der Textveränderung in der Regel nicht kennzeichneten,19 aber zweifellos sind die Schreiber eine zentrale Instanz, die im mittelalterlichen Textmodell mitgedacht werden muss.
Eine der wenigen Quellen, aus denen Kenntnis über die Schreiber gewonnen werden kann, sind Kolophone, in denen neben Informationen zu Entstehungsort und –zeit der Handschrift und zum Auftraggeber auch die Schreibernamen vermerkt werden konnten.20 Waren Selbstnennungen von Schreibern bis zum 13. Jahrhundert selten,21 treten Schreibersignaturen in spätmittelalterlichen Codices häufiger in Erscheinung.22 Diese Entwicklung kann als Co-Evolution zu der stärker werdenden Tradition der Selbstnennung von Autoren verstanden werden,23 sie verweist auf ein sich änderndes Selbstverständnis der verschiedenen textproduzierenden Instanzen, auf einen Prozess sich ausweitender und differenzierender Kompetenzen, in dem die Schreiber nicht mehr selbstverständlich hinter der Autorität eines Textes zurücktreten, sondern die gestalterischen Möglichkeiten und die poetische Signifikanz ihrer eigenen Tätigkeit deutlicher herausstellen.
Während in der volkssprachigen Schriftlichkeit nur wenige theoretische Aussagen zu den verschiedenen Kategorien der Textherstellung fassbar sind, kennt die mittellateinische Schriftkultur Reflexionen über die Unterscheidung zwischen Autor, Schreiber und Kompilator. So formuliert Bonaventura in der ‚Opera omniaBonaventura›Opera omnia‹‘ vier Arten, ein Buch zu schreiben, die nach dem Verhältnis von eigenem (sua) und fremdem (aliena) Gedankengut geschieden werden und die mit klaren Distinktionen zwischen den Instanzen scriptor, commentator, compilator und auctor einhergehen. Während der scriptor als Kopist gefasst wird, der Fremdes abschreibt und dabei nichts verändert, fügt der commentator dem Fremden etwas Eigenes hinzu. Dazwischen wird die Tätigkeit des compilators angesiedelt, der gleichfalls Fremdes aufschreibt, dieses aber verändert, indem er Anderes, aber nichts Eigenes hinzufügt: „Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur.“24 Das Schreiben von vorrangig Eigenem ist die Domäne des auctors, der zwar ebenfalls Fremdes hinzufügen kann, das aber den deutlich geringeren Anteil des Geschriebenen ausmacht.25
In der mittellateinischen Theoriebildung spielt die Abgrenzung der verschiedenen Formen reproduzierender Textherstellung von ‚originärer‘ Autorschaft und die damit verbundene Selbstentlastung eine wichtige Rolle.26 Vinzenz von Beauvais etwa reflektiert im einleitenden Prolog zum ‚Speculum maiusVinzenz von Beauvais›Speculum maius‹‘ die Kategorie der Verantwortung für das Geschriebene, die nur den ursprünglichen Autor kennzeichne, wogegen Vinzenz zwar für die Anordnung des Materials in seiner Enzyklopädie verantwortlich zeichnet, nicht aber für die dargebotenen Inhalte – eine Differenzierung, die besonders als Legitimation für die präsentierten paganen Autoren wichtig ist.27 Die Verwendung von christlichen und paganen Autoren, von biblischen und apokryphen Schriften wird jeweils gesondert erläutert, weiterhin werden die Autoren und exzerpierten Werke, auf die Vinzenz in den einzelnen thematischen Kapitel rekurriert, zumeist explizit benannt.28
Diese strikten Distinktionen sind als idealtypische Klassifikationen zu fassen, die vielleicht weniger konkrete Institutionen als vielmehr verschiedene Funktionen oder Ebenen der Textproduktion beschreiben. Auch sind die Reflexionen explizit auf lateinische wissenschaftliche bzw. theologisch-enzyklopädische Texte bezogen; in der volkssprachigen Schriftlichkeit werden die Unterschiede zwischen kopierenden, kommentierenden und kompilierenden Funktionen bei der Tätigkeit der Schreiber kaum in systematisierenden Reflexionen festgehalten.29 Die verschiedenen Funktionen der beteiligten Akteure und die Genesen der Textwerdung sind in der Regel nicht vollständig rekonstruierbar, insbesondere die Funktionen von Schreiber und Kompilator können schwer voneinander abgegrenzt werden; entsprechend werden die Begriffe in der germanistischen Forschung oft in enger Überschneidung gebraucht.30 Das Ineinandergreifen von schreibender und kompilierender Tätigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Erstellung kleinepischer Sammelhandschriften, so dass hier einheitlich die Begrifflichkeit des Schreibers verwendet wird, diese aber immer die erweiterte Funktion als Kompilator einschließt. Die kleinepischen Sammlungen sind keine Kompilationen im engeren Wortsinne eines geordneten Thesaurus bestimmter Wissensbereiche,31 dennoch stellt die Gestaltung von Sammlungen ein Kompilationsverfahren dar, das gleichermaßen auf der Einzeltext- als auch der Sammlungsebene wirksam ist: Zunächst formt die Auswahl und das Zusammenfügen von Texten und Texteinheiten die Sammlung als Ganzes;32 aber auch die Gestaltung des Einzeltextes, der zwar als etwas Fremdes wiedergegeben, dabei aber möglicherweise verändert wird, kann als kompilatorisches Verfahren gefasst werden. Der Autor bleibt zwar, unabhängig davon, ob er namentlich fassbar oder eine anonyme Kohärenzfigur ist, die zentrale, ‚Werk‘-bestimmende Instanz, gegenüber der der Schreiber nachgeordnet ist. Aber indem die Schreiber verändernd in die Texte eingreifen, indem sie etwa die Titulaturen bestimmen oder die Pro- und Epimythien (um)gestalten, werden sie zu Kompilatoren des Einzelwerkes. Diese Vermischung der Funktionen hat für die kleinepischen Kompilationen, in denen eine bearbeitende Zusammenstellung einer Vielzahl von kurzen Texten erfolgt, besondere Relevanz.