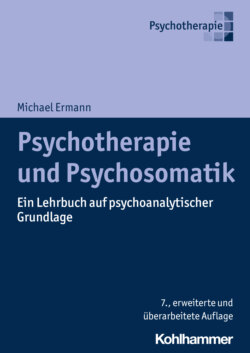Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 95
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.1 Die frühe intentionale Entwicklung
ОглавлениеIm ersten Lebenshalbjahr ist die psychische Entwicklung des Menschen von intentionalen Grundbedürfnissen nach Bezogenheit, Sicherheit und Geborgenheit geprägt. In der engen psychischen Verbundenheit mit der Pflegeperson drängen sie zur Befriedigung. Es besteht die Entwicklungsaufgabe, Nähe und Distanz zu regulieren und Beziehung herzustellen. Diese Zeit ist vom Grundkonflikt zwischen Nähewunsch und Fragmentierungs- bzw. Verschmelzungsangst geprägt.88 Für dieses frühe dyadische Erleben wird traditionell die Bezeichnung Symbiose89 verwendet, als könne nicht zwischen dem auftauchenden Selbst und den anderen unterschieden werden.
Aus der Säuglingsforschung90 ( Kap. 2.2.1) weiß man aber, dass Säuglinge »kompetent« geboren werden und schon sehr früh zwischen sich selbst und dem Anderen unterscheiden. Es besteht aber sicher ein nur sehr rudimentäres Bewusstsein für die eigene Person und eine selbstverständliche Verbundenheit mit der Bezugsperson als Objekt, das die Bedürfnisse stillt und das Selbst vor Reizen schützt.
Tab. 2.1: Positionen der prägenden Kindheitsentwicklung
Den intentionalen Bedürfnissen nach Sicherheit durch Nähe, Fürsorge, Kommunikation und Geborgenheit wird eine triebhafte Qualität zuerkannt, d. h. sie beruhen auf einer konstitutionellen Grundlage. Die passende Beantwortung und Befriedigung ist der Kern der selbstreflexiven Funktion, die für die Entwicklung des Selbst bzw. der Strukturierung der Persönlichkeit unerlässlich ist. Sie erweckt ein Gefühl basaler Sicherheit und bestätigt früheste Bindungsbedürfnisse, sodass ein »Urvertrauen« als Basis für das Kontaktverhalten und das aufkeimende Selbstgefühl entstehen kann. Störungen der Beziehungsregulation rufen Selbstzustände der Leere, Lähmung oder Erregung hervor, die auf Fragmentierungsangst, d. h. existenzielle Ängste vor dem Selbst- und Strukturverlust, als spezifische Ängste dieser Entwicklungsstufe schließen lassen.
Das innere Erleben hat in dieser Zeit noch wenig Kontur und kaum Kontinuität. Es ist noch weitgehend instinktgesteuert, lässt aber erste gezielte Reaktionen erkennen, die auf ein beginnendes Selbstbewusstsein und erste Unterscheidungen zwischen dem auftauchenden Selbst und dem Anderen schließen lassen. Die Beziehung ist ganz auf die zentrale Pflegeperson ausgerichtet, in der Regel auf die Mutter. Sie wird von wechselnden affektiven Zuständen und Bedürfnissen und der zugehörigen Verwendung des mütterlichen Objektes91 zur Bedürfnisregulation beherrscht: Bei Hunger in der Selbstwahrnehmung »bedeutet« die Pflegeperson »fütterndes Objekt«, bei Angstspannung »schützendes Objekt« usw. Diese funktionsbezogenen Arten des Beziehungserlebens haben noch keinen inneren Zusammenhang. Die Pflegepersonen werden erlebt und verwendet, als handele es sich um vielfältige Teilobjekte mit verschiedenen Funktionen, die mit den entsprechenden Bedürfnissen in Verbindung gebracht werden.
In dieser Entwicklungsphase des Erlebens von Teilobjektbeziehungen bestehen zwar bereits Grundmuster der sensorischen Beziehungsregulation: Über instinktive Grundmuster der Verarbeitung von optischen, akustischen, Berührungs- und Geruchsreizen werden Kommunikation und Beziehungen zu der Pflegeperson hergestellt. Es gibt aber noch keine Repräsentanzen, d. h. keine erinnerbare Vorstellung von Beziehungserfahrungen. Die Beziehungsregulation ist darauf angewiesen, dass konkrete Personen real anwesend sind und sofort und genau passend auf die Bedürfnisse reagieren.
Störungen durch emotionale Mangelerlebnisse, z. B. durch schwere psychische Störungen der Bezugspersonen, die nicht angemessen reagieren, durch Vernachlässigung oder durch überwältigende Verlust- und Verlassenheitserlebnisse, führen zu schwerwiegenden Entwicklungsschäden. Sie manifestieren sich in Defiziten von strukturellen Fähigkeiten und Störungen des Selbst- und Körpergefühls, des Gefühls der Daseinsberechtigung, des Interesses am Leben und der Welt, des Realitätsbezuges, der Kontaktfähigkeit (Näheregulation), des Nähe-Distanz-Konflikts und der Bindungssicherheit. Daraus resultieren später Strukturstörungen, insbesondere schizoide Persönlichkeitsstörungen und Erlebnismodi. Es wird angenommen, dass solche Störungen in der frühen Entwicklung auch den psychischen Anteil bei der Entstehung von Psychosen ausmachen.