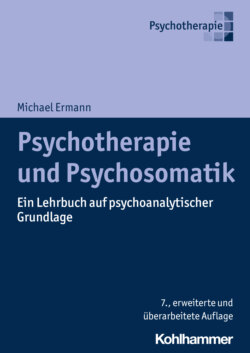Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 99
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Autonomiekomplex
ОглавлениеDer Grundkonflikt dieser Entwicklungsphase ist der Autonomiekomplext96. Er wird auch als Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt beschrieben. Er ist durch die unauflösbare Widersprüchlichkeit (Antinomie) zwischen Unabhängigkeit und Kontinuität in den Primärbeziehungen gekennzeichnet. Er bestimmt das dritte Lebensjahr und entsteht mit dem Zuwachs an Funktionsreifung. Die Objektabhängigkeit der vorangehenden Entwicklung beginnt sich zu überleben und wird dem heranwachsenden Kleinkind immer weniger gerecht. In dieser Zeit vollzieht sich die Reifung motorischer und kognitiver Funktionen. Das Kind lernt planend zu denken, zu handeln und zu begreifen, was im anderen vorgeht, und sich eine Theory of Mind zu bilden. Es vollzieht sich ein Wechsel von der Dominanz der passiven Versorgungswünsche hin zu selbstbehauptend-expansiven oral-aggressiven und anal-aggressiven Bedürfnissen.97 Der Wille zur Abgrenzung und Selbstbehauptung manifestiert sich nun als Trotz (Stuhlverhaltung) und räumliches Distanzschaffen (Weglaufen).
Dem Trennungs- und Autonomiewunsch stehen aber Trennungs- und Verlustängste entgegen. Daraus entsteht das Konflikthafte des Autonomiestrebens. Es ist mit der Phantasie verbunden, von der Bezugsperson entweder festgehalten oder fallengelassen zu werden, auf jeden Fall aber in der noch unsicheren Autonomie bedroht zu sein. Auf diese Weise entsteht ein Konflikt zwischen dem Impuls, sich zu trennen, um Autonomie zu erringen und sie zu verteidigen, und der Angst, damit endgültig Versorgung und Unterstützung zu verlieren oder das versorgende Objekt durch Trennung zu vernichten.
Die Aufgabe des Kleinkindes im dritten Lebensjahr besteht vor allem in der Überwindung dieser Trennungs- und Selbstbehauptungsambivalenz, in der Stabilisierung der Regulation des Selbstwertgefühls und in der Überwindung der passiven Versorgungswünsche der frühen Entwicklung. Diese Aufgabe ist mit der Entwicklung der Fähigkeit verbunden, während des Alleinseins die Erinnerung an den abwesenden Anderen aufrechtzuerhalten. Sie setzt eine Erziehung voraus, in der die Familie Toleranz für die Ambivalenz der Verselbstständigungsprozesse aufbringt.
Wenn der Autonomiekomplex gut verarbeitet wird, entsteht die Fähigkeit zum Alleinsein. Sie beruht darauf, dass das heranwachsende Kind nun eine innere Beziehung zur Bezugsperson bewahren kann, wenn es verlassen worden ist. Pathologische Lösungen führen dagegen zu einer Regression und Fixierung des Abhängigkeitserlebens und zur selbstverleugnenden Anpassung an die Bedürfnisse der anderen. Die Identität wird dabei nicht genügend entwickelt. Es entsteht die für narzisstische und depressive Patienten typische Objektabhängigkeit und ein falsches Selbst98.
Die Objektabhängigkeit zeigt sich darin, dass die Betroffenen sich nicht mehr geliebt oder in ihrem Selbst bedroht fühlen, wenn der Andere nicht da ist. Das falsche Selbst äußert sich in dem vorbewussten Gefühl, gar nicht das eigene Leben, sondern das eines anderen zu leben. Aber statt einen eigenen Weg zu wagen, wählen Menschen mit gescheiterter Autonomieentwicklung immer wieder Partner, die sie nach dem Vorbild der bevormundend erlebten Mutter der Autonomieentwicklung für ihre Stabilität einsetzen können. Diese Konfigurationen bilden die Basis für die präödipale Pathologie auf dem mittleren Strukturniveau ( Kap. 4.3).