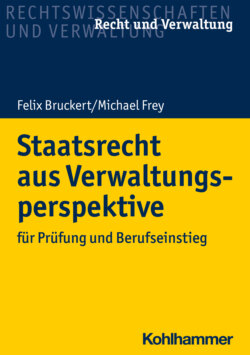Читать книгу Staatsrecht aus Verwaltungsperspektive - Michael Frey - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.Rechtssicherheit
Оглавление42Das Rechtsstaatsprinzip umfasst ferner den Grundsatz der Rechtssicherheit. Dahinter verbergen sich der Bestimmtheitsgrundsatz und der Vertrauensgrundsatz.
43Der Bestimmtheitsgrundsatz besagt, dass staatliche Rechtsakte derart klar sein müssen, dass der Betroffene erkennen kann, was von ihm verlangt wird. Für Gesetze (im materiellen Sinn; also auch Rechtsverordnungen und Satzungen der Verwaltung) bedeutet dies, dass für den Betroffenen das Verwaltungshandeln voraussehbar und berechenbar aus den Normen hervorgeht.25 Dabei dürfen unbestimmte Rechtsbegriffe und sog. Generalklauseln verwendet werden, solange sie mit den anerkannten Auslegungsmethoden angewendet werden können.
44Für Verwaltungsakte wurde das Bestimmtheitsgebot in § 37 Abs. 1 LVwVfG normiert. Demnach müssen vor allem „vollständig, klar und unzweideutig“ die erlassende Behörde, der Adressat und das vom Adressaten geforderte Verhalten aus dem Verwaltungsakt hervorgehen.26 Die Anforderungen sind höher als für abstrakte Gesetze, weil ein konkreter Einzelfall geregelt wird.27 Noch höher sind die Anforderungen, wenn es sich um vollstreckbare Verwaltungsakte handelt.28 Ist der Verwaltungsakt zu unbestimmt, kann er nicht vollstreckt werden – auch nicht, wenn er bereits bestandskräftig ist.29 Das Bestimmtheitsgebot richtet sich hierbei hauptsächlich an den Tenor der Verwaltungsaktes, der jedoch im Lichte der Begründung des Verwaltungsaktes gelesen wird.30 Die konkreten Anforderungen sind einzelfallabhängig, etwa kann es sich anbieten, die konkret durchzuführende Maßnahme (Einbau einer Feuerschutztür T30 lichter Durchgang 2,00 m) anzuordnen. Je nach Fall kann auch dem Adressaten die Wahl der Maßnahme überlassen werden (ab 22:00 Uhr maximal 70 dB(A)31).
45Eng mit der Bestimmtheit verwandt ist die Begründungspflicht. Sie wird teilweise ebenfalls aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet32 und ist für Verwaltungsakte ausdrücklich in § 39 LVwVfG normiert. Die Begründung dient jedenfalls der Legitimation des Verwaltungshandelns und hat auch den Rechtsschutz des Adressaten im Blick: Der Adressat soll verstehen, weshalb der Verwaltungsakt ihm gegenüber erlassen wird und er soll ggf. das Risiko eines Rechtsbehelfs abwägen können.33 Insofern kann man sie als Ausdruck des Rechtsstaates verstehen.
46Bestimmtheit und Begründung verwirklichen letztlich die Abkehr von willkürlichem Verwaltungshandeln. Willkürliches Staatshandeln mag heute in Deutschland kein akutes Problem darstellen. Gleichwohl sollte diese Situation nicht zu einer Selbstverständlichkeit führen, die Bestimmtheit und Begründung abdingbar machen. Schon die bloße Möglichkeit, dass der Adressat eine staatliche Handlung als willkürlich empfindet, soll – auch heute noch – vermieden werden.34 Beides dient daneben der Bürgerfreundlichkeit und Akzeptanz des Verwaltungshandelns. Vor diesem Hintergrund ist es als gravierender und einfach vermeidbarer Fehler anzusehen, dass in der Praxis wie auch in Klausuren häufig erhebliche Begründungsdefizite bestehen.
47Der Vertrauensgrundsatz wird insb. relevant bei Rechtsakten, die Rückwirkung haben. Das kommt im Verwaltungshandeln etwa vor, wenn Steuersatzungen für ein noch nicht abgeschlossenes Steuerjahr erlassen werden, siehe → Fall 1. Er kommt auch bei der Rücknahme und dem Widerruf von Verwaltungsakten (§§ 48 f. LVwVfG) zum Tragen, siehe → Fall 10.
Bei der Rückwirkung von Rechtsnormen wird allgemeinhin unterschieden zwischen der sog. echten und der unechten Rückwirkung oder – quasi synonym – der rechtsfolgenanknüpfenden und der tatbestandsanknüpfenden Rückwirkung. Bei der jeweils erstgenannten Rückwirkung wird eine Rechtsnorm erlassen, die einen vollständig abgeschlossenen Vorgang nachträglich anders regelt. Bei der letztgenannten Rückwirkung werden bereits begonnene aber noch nicht abgeschlossene Sachverhalte geregelt.
In beiden Fällen muss eine Abwägung des Vertrauens der Betroffenen mit dem Interesse an der Rückwirkung erfolgen. Dabei können etwa die Vorhersehbarkeit der neuen Regelung sowie eine zuvor unsichere Rechtslage eine Rolle spielen (wenn die neue Norm nur Unklarheiten beseitigen soll ist eine Rückwirkung eher unproblematisch). Auch muss unterschieden werden zwischen Begünstigung und Belastung. Eine rückwirkende Begünstigung der Bürger ist einfacher möglich als eine rückwirkende Belastung. Die Abwägung wird bei der echten/rechtsfolgenanknüpfenden Rückwirkung regelmäßig zugunsten des Betroffenen (grundsätzlich unzulässig) und die unechte/tatbestandsanknüpfende Rückwirkung regelmäßig zugunsten des öffentlichen Interesses ausfallen (grundsätzlich zulässig).
48Beispiel:
Hundebesitzer H hat seit Jahren einen Hund. Die Gemeinde G, in der H wohnt, beschließt im Juni eine Hundesatzung. Darin wird geregelt, dass für das aktuelle Jahr sowie für das vergangene Jahr eine Hundesteuer zu entrichten ist.
Bezugspunkt für Steuern ist das gesamte Kalenderjahr. Der besteuerte Vorjahreszeitraum ist also mit Ablauf des 31. Dezembers vollkommen abgeschlossen. Der aktuell besteuerte Zeitraum ist bei Erlass der Satzung hingegen erst zur Hälfte vorüber. Soweit die Satzung also das Hundehalten des Vorjahres besteuert, liegt eine sog. echte oder rechtsfolgenanknüpfende Rückwirkung vor. Sie ist grundsätzlich unzulässig. Soweit die Satzung an das aktuelle Steuerjahr anknüpft, liegt eine unechte oder tatbestandsanknüpfende Rückwirkung vor. Sie ist grundsätzlich zulässig.35
49Bei Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten stehen sich Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit durch Vertrauensschutz gegenüber.36 Die Abwägung dieser Belange hat der Gesetzgeber in §§ 48 f. LVwVfG relativ genau vorgegeben. Der Vertrauensschutz gilt aber schon vor Bestandskraft, also vor dem eigentlichen Anwendungsbereich von §§ 48 f. LVwVfG. Daher ist insb. die sog. Verböserung im Widerspruchsverfahren (reformatio in peius) umstritten37, denn sie erfolgt im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens, sprich: vor Eintritt der Bestandskraft eines Verwaltungsaktes. Überwiegend wird für die Verböserung ebenfalls auf die Abwägungsgrundsätze der §§ 48 f. LVwVfG zurückgegriffen.38