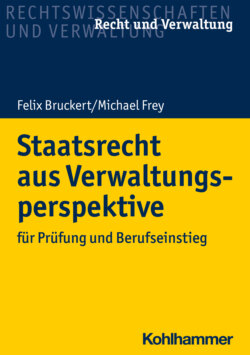Читать книгу Staatsrecht aus Verwaltungsperspektive - Michael Frey - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
Оглавление1Als Staatsrecht werden diejenigen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtssätze angesehen, die die Grundordnung des Staates regeln. Dies sind in Deutschland im Wesentlichen die Regelungen des Grundgesetzes. Staatsrecht wird typischerweise in die Bereiche Staatsorganisationsrecht (Staatsrecht I) und Grundrechte (Staatsrecht II) unterteilt.
Zum Staatsorganisationsrecht gehören im deutschen Staatsrecht die Regelungen über die Staatszielbestimmungen, die Verfassungsorgane und die Staatsfunktionen, außerdem die hier nicht behandelten Verfahren vor dem BVerfG (z. B. die Verfassungsbeschwerde).
Grundrechte beinhalten zentrale Vorgaben für staatliches Handeln. Sie gewährleisten Freiheit und Gleichheit, begrenzen in ihrer Funktion als Abwehrrecht das Ausmaß staatlichen Handelns und umfassen in ihrer Funktion als Leistungs- und Teilhaberechte Ansprüche des Einzelnen gegen den Staat. Im Grundgesetz stehen sie im I. Abschnitt, den Artikeln 1 bis 19. Es finden sich auch ähnliche Rechte außerhalb dieses Abschnittes, sie heißen „grundrechtsgleiche Rechte“.1
Daneben befasst sich das Staatsrecht III mit der Verzahnung von Verfassungs- und Völker- sowie Unionsrecht. Also bspw. mit der Frage, wann Europarecht in Deutschland anzuwenden ist, oder inwiefern Unionsrecht Vorrang vor nationalem Recht genießt.
2Im Zentrum des Staatsrechts stehen typischerweise die Verfassungsorgane und Verfahren vor dem BVerfG. Auswirkungen des Staatsrechts auf Einzelmaßnahmen der Verwaltung werden häufig nur am Rande erörtert. Daher gestaltet es sich für die Verwaltung oft schwierig, sich die konkreten Auswirkungen der staatsrechtlichen Vorgaben für ihr Verhalten abzuleiten.
Der Staatsaufbau, Gesetzgebungskompetenzen, Staatszielbestimmungen (etwa der Tierschutz, Art. 20a GG) wie auch Grundrechte können aber maßgeblich das Handeln der öffentlichen Verwaltung beeinflussen. Das betrifft in etwa den Hauptfall der Begrenzung eines Ermessenspielraums der Verwaltung, aber auch die Auslegung gesetzlicher Tatbestandsmerkmale oder die Frage, ob die Verwaltung einschreiten muss oder nicht. Gleichwohl ist die Perspektive der Verwaltung in zentralen Punkten von denen der Gesetzgebung und Rechtsprechung zu unterscheiden. Daher ist es für die Arbeit in der Verwaltung wichtig, das Staatsrecht auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
3Unterschiede machen sich schon im Prüfungsschema etwa einer grundrechtlichen Prüfung bemerkbar. Grundrechte werden typischerweise aus der dreistufigen Schutzbereichs-Eingriffs-Rechtfertigungs-Prüfung aus Sicht des BVerfG erörtert. Hierbei kommen die Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts nur selten und nur inzident zur Sprache. Die Verwaltung geht jedoch zunächst von der Anwendung des einfachen Rechts aus und muss grundrechtliche Einflüsse dann inzident in dieser Prüfung abarbeiten.
Ferner darf die Verwaltung (formelle) Gesetze nicht einfach unangewendet lassen, selbst wenn sie das Gesetz als verfassungswidrig anerkennt (fehlende Normverwerfungskompetenz). Die Prüfung von Gesetzen spielt aus Praxissicht daher keine oder allenfalls eine stark untergeordnete Rolle.
4Weitere Unterschiede ergeben sich aus der Stellung der Verwaltung als Teil der Exekutive: Als ausführende Gewalt sieht sich die Exekutive den Vorgaben des Gesetzgebers und der Kontrolle durch die Gerichte gegenüber.
Der Gesetzgeber konkretisiert die abstrakten Vorgaben des Grundgesetzes für bestimmte Lebensbereiche durch einfache Gesetze. Er regelt jedoch keine Einzelfälle, sondern erlässt abstrakte Normen, die für eine Vielzahl von Fällen gelten. Ohne Gesetz darf die öffentliche Verwaltung grundsätzlich nicht handeln (sog. Vorbehalt des Gesetzes: „kein Handeln ohne Gesetz“).2 Ferner darf sie nur innerhalb der Gesetze handeln (sog. Vorrang des Gesetzes: „kein Handeln gegen das Gesetz“).
Die Rechtsprechung nimmt hingegen eine Kontrolle des Verwaltungshandelns im Nachhinein vor. Sie prüft das Verwaltungshandeln grundsätzlich vollumfänglich, in bestimmten – gesetzlich angeordneten – Fällen bleiben der Verwaltung gerichtlich nicht oder nur teilweise überprüfbare Spielräume. Dazu zählen insb. Beurteilungs- und Ermessensspielräume.
5Während der Gesetzgeber die wesentlichen Regelungen für eine unbestimmte Anzahl an Fällen vorgibt und Richter Maßnahmen prüfen, die bereits erlassen wurden, müssen sich Verwaltungsmitarbeiter damit auseinandersetzen, wie Gesetze auf den Einzelfall anzuwenden sind, welche Maßnahmen im konkreten Fall möglich und rechtmäßig wären und welche von diesen Maßnahmen die zweckmäßigste darstellt.
Staatsrechtliche Vorgaben beeinflussen diese Entscheidung. Die Verwaltung muss insb. alle betroffenen Grundrechte und Staatszielbestimmungen erfassen, in nachvollziehbarer Weise für den konkreten Fall gewichten und zueinander ins Verhältnis setzen. Dazu ein einleitendes
6Beispiel: E beantragt für sein Eiscafé eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis nach § 16 Abs. 1, 2 StrG BW zur Außenbewirtung mit 20 Sitzplätzen inkl. Tischen. Das Eiscafé befindet sich am Beginn einer Fußgängerzone. Dort ist die Straße noch nicht so breit wie im späteren Verlauf der Fußgängerzone.
7Im Beispielsfall darf die Verwaltung handeln, weil der Gesetzgeber mit § 16 Abs. 1, 2 StrG BW eine Rechtsgrundlage für den Erlass der Sondernutzungserlaubnis geschaffen hat. Die abstrakten tatbestandlichen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber dort normiert hat („Sondernutzung einer Straße“), liegen vor. Für den Fall, dass die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, hat der Gesetzgeber der Verwaltung Ermessen eingeräumt (§ 16 Abs. 2 S. 1 StrG BW: „nach pflichtgemäßem Ermessen“). Im Rahmen dieses Ermessens muss die Verwaltung alle Handlungsmöglichkeiten berücksichtigen und alle konkret betroffenen Interessen, insb. Grundrechte, ermitteln.
8Als Handlungsmöglichkeiten kommt von der Versagung der Erlaubnis über eine nur beschränkte Erlaubnis (bspw. nur 14 Sitzplätze) über eine Erlaubnis mit Nebenbestimmungen (bspw. befristet auf drei Monate) bis hin zur antragsgemäßen Erteilung eine Vielzahl an Maßnahmen in Betracht, die der Verwaltung vom Gesetzgeber ermöglicht wurden. Es liegt nun an der Verwaltung, die zweckmäßige Maßnahme zu finden. Sie kann dabei der Berufsfreiheit einen hohen Stellenwert einräumen und eine Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen von 20 Stühlen inkl. Tischen erlassen. Sie kann aber einzelfallabhängig auch der Bewegungsfreiheit den Vorrang einräumen und nur eine Erlaubnis für 16 Plätze erlassen.
9Hat sie sich etwa für den Erlass der Erlaubnis für nur 16 Plätze entschieden, kann das Verwaltungsgericht auf eine Klage hin nur überprüfen, ob die Behörde ihr Ermessen gar nicht, zweckwidrig oder unter Missachtung der gesetzlichen Grenzen ausgeübt hat.3 Begeht die Verwaltung keiner dieser drei Ermessensfehler, kann sie sowohl die eine als auch die andere Entscheidung erlassen.
10Diese Überlegungen spiegeln sich in der Erstellung eines Gutachtens sowie dem Schreiben eines Bescheides wider. In Gutachten, in denen ähnlich der Richterperspektive nach der Rechtmäßigkeit einer konkreten Maßnahme gefragt wird, sind Grundrechte und Staatszielbestimmungen nur als Grenze der Entscheidung zu prüfen.
In der Praxis bzw. in praxisorientierten Fallgestaltungen ist hingegen nach der zweckmäßigen Entscheidung gefragt. Dann müssen nicht nur die Grenzen des Handelns ermittelt, sondern auch der Ermessensspielraum „mit Leben gefüllt“ werden. Hierbei können Elemente des Staatsorganisationsrechts (bspw. Vertrauensschutz) oder Grundrechte die Entscheidung beeinflussen.
11Auf der anderen Seite befassen sich viele der „klassischen“ staatsrechtlichen Fälle mit Problemen der Verfassungsorgane oder betreffen hauptsächlich die Gesetzgebung. Sie sind für die Verwaltung nur von untergeordneter oder mittelbarer Relevanz.