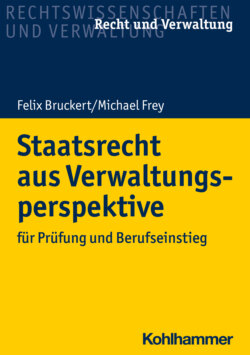Читать книгу Staatsrecht aus Verwaltungsperspektive - Michael Frey - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C.Die Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht als Grundlage des Prüfprogramms
Оглавление57Wie oben erläutert, werden die Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung maßgeblich durch den Gesetzgeber bestimmt und begrenzt. Das folgt aus der Bindung der „vollziehende[n] Gewalt […] an Gesetz und Recht“ (Art. 20 Abs. 3 GG). Aus dieser Bindung lassen sich die grundlegenden Prüfungspunkte des Verwaltungshandelns (insb. für den Erlass eines Verwaltungsaktes) herleiten.
58Zunächst besagt der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, dass die Verwaltung nicht ohne Gesetz handeln darf. M. a. W. benötigt die Verwaltung eine Rechtsgrundlage, um handeln zu dürfen. Das ist für die Eingriffsverwaltung (belastende Verwaltungsakte) unstreitig. Für die Leistungsverwaltung (begünstigende Verwaltungsakte) wird überwiegend vertreten, dass jedenfalls kein formelles Parlamentsgesetz notwendig ist, sondern jeder parlamentarische Akt genügt.52 Es ist daher ausreichend, wenn Leistungen im Haushaltsplan (der durch das Haushaltsgesetz festgestellt wird) vorgesehen sind.
Unter diesem ersten Prüfungspunkt der Klausur beschränkt sich die Prüfung in der Regel auf die Nennung der einschlägigen Rechtsgrundlage. Kommen mehrere Rechtsgrundlagen in Betracht, müssen alle genannt und voneinander abgegrenzt werden. Sodann muss entsprechend des Konkurrenzverhältnisses die für den Fall einschlägige Norm herausgearbeitet werden.53
Zwar muss die Rechtsgrundlage rechtmäßig bzw. verfassungsmäßig sein, das wird von der Verwaltung im Grundsatz aber nur selten geprüft. Denn erstens fehlen ihr die zeitlichen Ressourcen und zweitens die sog. Verwerfungskompetenz. Allein die Gerichte können Gesetze für unwirksam erklären („verwerfen“).54 Von diesem Grundsatz gibt es zwei wichtige Ausnahmen55: (1) Wenn Rechtsnormen der Verwaltung (Bebauungspläne, Polizeiverordnungen, Steuersatzungen, …) die Rechtsgrundlage darstellen und (2) wenn Unionsrecht entgegensteht. In ersterem Fall kann nämlich die Verwaltung selbst die rechtswidrige Norm ändern oder beseitigen, dazu → Online-Fall 556, → Fall 1. In letzterem Fall darf die Verwaltung ggf. die nationale Norm unangewendet lassen.57
59Der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes besagt sodann, dass die Verwaltung nicht gegen das Gesetz handeln darf. Sie muss also die Voraussetzungen der Rechtsgrundlage einhalten und darf nicht über das hinausgehen, was ihr gesetzlich ermöglicht wird. Diese Prüfung wird aufgeteilt in die materielle Rechtmäßigkeit und die formelle Rechtmäßigkeit des Handelns. In der materiellen Rechtmäßigkeit müssen die Tatbestandsvoraussetzungen und die Rechtsfolge der Rechtsgrundlage (und ggf. verbundener Normen) geprüft werden.
Der Tatbestand ist auszulegen, wenn nicht vollkommen offenkundig58 ist, dass er erfüllt ist. Dabei sind die Auslegungsmethoden Wortlaut, Systematik, Sinn, Historie sowie die verfassungs- oder unionsrechtskonforme Auslegung anzuwenden.
In der Rechtsfolge ist zu prüfen, ob die zu prüfende Maßnahme noch von der Rechtsgrundlage gedeckt ist oder gegen sonstiges (höherrangiges) Recht verstößt. Bei sog. gebundenen Entscheidungen („ist“) wird Adressatenwahl, Bestimmtheit sowie (rechtliche und tatsächliche) Möglichkeit geprüft. Bei Ermessensentscheidungen sind zusätzlich die Vorgaben des § 40 LVwVfG zu beachten: Ausübung des Ermessens, keine zweckfremden Erwägungen, Einhaltung der gesetzlichen Grenzen. Wichtigste gesetzliche Grenzen stellen die Grundrechte und die europäischen Grundfreiheiten dar.
Materielle Fehler können nur in begrenztem Umfang nachträglich „ausgebessert“ werden, etwa durch die sog. Umdeutung gem. § 47 LVwVfG oder durch eine neue Ermessensentscheidung im Widerspruchsverfahren.59 Letzteres ist nur möglich im Rahmen der sog. Fachaufsicht. Im Gegensatz zur gerichtlichen Prüfung, prüft im Widerspruchsverfahren die nächsthöhere Behörde (§ 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VwGO)60, also ein Teil der Exekutive.61 Ist sie Fachaufsichtsbehörde – was gem. §§ 20 f. LVG BW beim Handeln als Verwaltungsbehörde stets der Fall ist –, kann sie auch die Zweckmäßigkeit und nicht nur die Rechtmäßigkeit überprüfen. Folglich kann sie auch eine andere Ermessensentscheidung treffen.
60Auch die Vorgaben der formellen Rechtmäßigkeit ergeben sich aus dem Gesetz und sind von der Verwaltung einzuhalten. Diese sind Zuständigkeit, Verfahren und Form.
Einen Verstoß kann der Betroffene aber nicht immer geltend machen. Das deutsche (Verwaltungs)Rechtssystem ist gem. Art. 19 Abs. 4 GG auf den Individualrechtsschutz ausgelegt.62 Im Fokus stehen subjektive Rechte, wie sie sich etwa aus den Grundrechten ergeben. Verfahrensvorschriften haben nur „dienende Funktion“ und vermitteln selten ein subjektives Recht.63 Das ist Grund dafür, warum formelle Fehler im Gegensatz zu materiellen Fehlern grundsätzlich heilbar (§ 45 LVwVfG) oder unbeachtlich (§ 46 LVwVfG) sein können.
Eine Verletzung von Form- und Verfahrensvorschriften kann aber auch andere Sanktionen als die mögliche Aufhebung des Verwaltungsaktes mit sich bringen.64 Daher steht es auch im Interesse der Verwaltung, die formellen Voraussetzungen einzuhalten.
61Die Zuständigkeit folgt aus den oben erörterten Grundzügen des Staatsaufbaus und ergibt sich deswegen fast ausschließlich aus Landesrecht, konkret aus Landesgesetzen oder Zuständigkeitsverordnungen. Die sachliche Zuständigkeit ist dabei stets in den Fachgesetzen oder dazugehörigen Verordnungen geregelt. Nur die örtliche Zuständigkeit ergibt sich zumeist aus § 3 LVwVfG.
Ausgangspunkt der sachlichen Zuständigkeit ist zwingend (!) eine Norm, die sagt „sachlich zuständig ist […]“. In der Regel lautet die Norm in etwa „Sachlich zuständig ist die untere […]behörde, soweit nichts anderes bestimmt ist“.65 Manchmal wird nicht direkt die untere Verwaltungsbehörde angesprochen, sondern eine andere untere Behörde, etwa die untere Baurechtsbehörde. Dann ist eine weitere Norm zu suchen, die definiert welches die (in diesem Fall) untere Baurechtsbehörde ist. Für gewöhnlich ist dies die untere Verwaltungsbehörde. Wer untere Verwaltungsbehörde ist, definiert § 15 Abs. 1 LVG BW. Hier kommt es darauf an, ob sich der Sachverhalt in einem Stadtkreis, einer Großen Kreisstadt oder einer sonstigen Kreisangehörigen Gemeinde abspielt. In letzterem Fall ist fast immer das Landratsamt zuständig.
62Beispiele zur Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit
1. Allgemeine Gewässeraufsicht gem. § 75 Abs. 1 WG BW, § 100 WHG im Gebiet eines Stadtkreises:
Sachlich ist gem. § 82 Abs. 1 S. 1 WG BW die untere Wasserbehörde zuständig. Untere Wasserbehörden sind gem. § 80 Abs. 2 Nr. 3 WG BW die unteren Verwaltungsbehörden. Untere Verwaltungsbehörden sind in den Stadtkreisen die Gemeinden, § 15 Abs. 1 Nr. 2 LVG BW.
2. Erteilung einer Baugenehmigung gem. § 58 Abs. 1 LBO BW im Gebiet einer kreisangehörigen Gemeinde:
Sachlich ist gem. § 48 Abs. 1 LBO BW die untere Baurechtsbehörde zuständig. Untere Baurechtsbehörden sind gem. § 46 Abs. 1 Nr. 3 LBO BW die unteren Verwaltungsbehörden und die in § 46 Abs. 2 LBO BW genannten Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. Ein Fall des Abs. 2 liegt nicht vor.66 Untere Verwaltungsbehörden sind gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 LVG BW in den Landkreisen insb. die Landratsämter. Der Sachverhalt spielt sich hier auf dem Gebiet einer kreisangehörigen Gemeinde ab, sodass das Landratsamt zuständig ist.
3. Erlass eines Platzverweises gem. § 30 Abs. 1 PolG BW durch eine kreisangehörige Gemeinde:
Sachlich zuständig für den Platzverweis sind gem. § 105 Abs. 1, 3 PolG BW sowohl die Polizeibehörden wie auch der Polizeivollzugsdienst. Hier kommt das Handeln der Gemeinde, einer Polizeibehörde i. S. d. § 105 Abs. 1 PolG BW, in Betracht. Gem. § 111 Abs. 2 PolG BW sind grundsätzliche die Ortspolizeibehörden zuständig. Das sind nach § 107 Abs. 4 S. 1 PolG BW die Gemeinden.
4. Schließung eines Gewerbes gem. § 15 Abs. 2 GewO auf dem Gebiet einer Großen Kreisstadt:
Sachlich zuständig für die Schließung des Gewerbes sind gem. § 1 GewOZuVO BW die unteren Verwaltungsbehörden. Untere Verwaltungsbehörden sind in den Landkreisen insb. die Großen Kreisstädte. Eine Ausnahme gem. § 19 LVG BW liegt für gewerberechtliche Angelegenheiten nicht vor.
63Beim Verfahren sind im Regelfall alle Vorschriften der §§ 9 ff. LVwVfG zu beachten. Wichtig sind hier insb. der Ausschluss bestimmter Personen (§§ 20 f. LVwVfG), der Untersuchungsgrundsatz (§ 24 LVwVfG) sowie die Beratung, Auskunft und Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 25 LVwVfG). In der Klausur wird allerdings regelmäßig nur die Anhörung der Beteiligten (§ 28 LVwVfG) relevant. Sie ist unmittelbarer Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips.67 Obwohl die §§ 9 ff. LVwVfG unmittelbar nur für Verwaltungsakte und öffentlich-rechtliche Verträge gelten (§ 9 LVwVfG), sind einzelne Vorschriften – als Ausprägung allgemeiner Verfahrens- und Rechtsstaatsgedanken – analog auch auf Realakte anzuwenden, dazu zählt insb. die Anhörung.68
64Hinsichtlich der Form bestehen im Gutachten nur selten Probleme. Es ist auf eine besondere Formvorschrift im Fachgesetz zu achten, ansonsten kann ein Verwaltungsakt schriftlich, mündlich oder ggf. auch konkludent erlassen werden, § 37 Abs. 1 LVwVfG. Im Regelfall wird er schriftlich erlassen und ist sodann auch zu begründen, § 39 Abs. 1 LVwVfG. Im Bescheid sollte – aus oben dargelegten Gründen – der Begründungspflicht sorgsamer nachgekommen werden, als dies zumal geschieht und gelehrt wird. Die Begründung dient nicht zuletzt auch der Selbstkontrolle: Wenn Sie einen Verwaltungsakt nicht überzeugend begründen können, sollten Sie ihn eventuell nicht erlassen.
65Letzter Verfahrensschritt ist sodann die Bekanntgabe. Sie kann per Telefax, E-Mail, Brief, Telefon, persönlich oder auf andere Weise geschehen. Regelfall dürfte noch immer der einfache Postbrief oder – aus Beweisgründen über den Bekanntgabezeitpunkt – die Zustellung durch die Post nach § 3 Abs. 1 LVwZG BW (Postzustellungsurkunde, PZU) sein.
Anmerkung zur Bekanntgabe
Die Bekanntgabe an sich ist keine formelle Voraussetzung im engeren Sinn, sie ist vielmehr Voraussetzung für die Existenz des Verwaltungsaktes schlechthin, § 43 Abs. 1 S. 1 LVwVfG. Verwaltungsgerichte würden die erfolgte Bekanntgabe daher etwa in der Zulässigkeit der Klage prüfen, nicht (mehr) in den formellen Voraussetzungen in der Begründetheit. Verwaltungsbehörden prüfen hingegen alle Vorschriften und Verfahrensschritte, die zum Erlass notwendig sind. Dazu zählt auch die Bekanntgabe sowie die Frage, auf welchem Wege der Verwaltungsakt bekannt zu geben ist. Sie kann auch als letzter Schritt unter „Verfahren“ oder, insoweit es um die Frage geht wie bzw. in welcher Form eine Bekanntgabe zu erfolgen hat, unter „Form“ geprüft werden.69
66Zusammengefasst ergibt sich abgeleitet aus dem Staatsrecht folgendes allgemeines Prüfungsschema:
Prüfungsschema Verwaltungsakt
I. Rechtsgrundlage (kein Handeln ohne Gesetz)
Bei begünstigendem Handeln genügt entsprechender Posten im Haushalt
(ggf. Abgrenzung aller in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen)
(ggf. Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechtsgrundlage [wenn Rechtsgrundlage = Satzung oder Rechtsverordnung])
II. Materielle Voraussetzungen (kein Handeln gegen das Gesetz)
1. Tatbestand
Alle Tatbestandsvoraussetzungen, die sich ergeben aus:
– der Rechtsgrundlage
– der Struktur des Gesetzes (in der Gewerbeordnung stets „Gewerbe“, im Gaststättengesetz stets „Gaststätte“, im Versammlungsgesetz stets „Versammlung“)
– der Struktur des Rechtsgebietes
(im Ordnungsrecht ist bspw. der Rückgriff auf das PolG BW möglich, etwa zur Frage, ob gegen einen Nichtstörer i. S. d. § 9 Abs. 1 PolG BW vorgegangen werden kann)
Ggf. ist eine Auslegung der Tatbestandsmerkmale (= Definitionen) notwendig nach Wortlaut, Systematik, Sinn, Historie – sowie seltener auch eine verfassungs- oder unionsrechtskonforme Auslegung
2. Rechtsfolge
a) Adressatenwahl, wenn mehrere vorhanden
b) bei Ermessensvorschriften: Ausübung nach Vorgabe des § 40 LVwVfG
Selten: Entschließungsermessen
Stets: Auswahlermessen
Insb. Prüfung der Verhältnismäßigkeit, bei intensiven Eingriffen vollständige („große“) Grundrechtprüfung eines oder mehrerer Grundrechte, Grundfreiheiten oder der EMRK.
c) Bestimmtheit
d) Keine (rechtliche oder tatsächliche) Unmöglichkeit
III. Formelle Voraussetzungen (kein Handeln gegen das Gesetz)70
1. Zuständigkeit
a) sachlich, in der Regel in Verbindung mit § 15 LVG BW
b) örtlich, in der Regel aus § 3 LVwVfG
2. Verfahren
a) Beteiligte, §§ 11 ff. LVwVfG
(ggf. andere Behörden, § 13 Abs. 2 LVwVfG, § 35 Abs. 4 GewO, § 53 Abs. 3, 4 LBO BW, …)
b) Keine ausgeschlossenen oder befangenen Personen, §§ 20 f. LVwVfG
c) Anhörung, § 28 LVwVfG
3. Form
a) Form des Verwaltungsaktes, § 37 Abs. 2 LVwVfG
(in der Regel formfrei; ggf. Sondervorschriften, § 34 Abs. 1 S. 2 PolG BW, § 58 Abs. 1 S. 3 LBO BW, …)
b) Begründung, § 39 Abs. 1 LVwVfG
4. Bekanntgabe
§ 41 Abs. 1 LVwVfG; ggf. aus Beweisgründen per PZU, wenn belastender Inhalt, § 41 Abs. 5 LVwVfG, § 3 Abs. 1 LVwZG BW