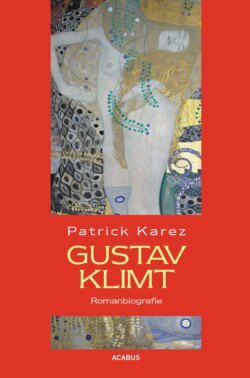Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 13
8
ОглавлениеUnd so inskribierte also der junge Gustav Klimt an der kürzlich erst eröffneten Kunstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, welches im Jahre 1864 durch Seine Apostolische Majestät, Kaiser Franz Joseph, gegründet worden war. Etwas eingeschüchtert. Betrat er die Aula. Wo für den heutigen ersten Studientag ein Informationstreffen anberaumt worden war. Einige der Professoren waren anwesend. Wobei sie sich zunächst den neuen Schülern vorstellen und später für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen wollten. Gustav Klimt entdeckte bald schon seinen Sitznachbarn von der Aufnahmeprüfung, Franz Matsch, in der Menge wieder und gesellte sich zu ihm. Zu zweit. War es dann doch besser. Als allein. Zu zweit. War man viel stärker. Als allein. Zumal. Wenn man das Umfeld nicht kennt. Wenn alles vollkommen neu ist. Und einschüchternd. (Und man selbst erst knapp vierzehn ist.)
„Servus!“, sagte er, etwas zögerlich.
„Ach, grüß dich!“, entgegnete Franz Matsch.
Dann trat eine längere Pause ein. Franz Matsch schien ebenfalls verunsichert zu sein. Kein Wunder. Denn er war ja kaum ein Jahr älter als Gustav. Zwei junge Burschen also, standen hier nun inmitten zahlreicher anderer Schüler, während weiter hinten, auf der Estrade, die Professoren saßen und sich untereinander austauschten. Sie schienen nicht einmal Notiz von den neuen Schülern zu nehmen. Doch plötzlich ging ein Raunen durch den Saal. Und dann wurde es still. Mucksmäuschenstill.
„Weißt du wer das ist?“, fragte Franz Matsch seinen neuen Studienkollegen.
„Nein. Keine Ahnung …“ Klimt schüttelte den Kopf.
„Das ist der Herr Professor Rudolf Eitelberger, Ritter von Edelberg. Der Gründer dieser Schule. Zumindest aber, gab er die Anregung dazu …“
„Ach so?“ Klimt mißfiel ein wenig, daß sein neuer Kommilitone ihn zunächst gefragt hatte, ob er diesen Mann kenne, obwohl er selbst ja nur allzu gut wußte, wer er war. Eine rhetorische Frage also. Eine scheinheilige obendrein. Ein wenig klugscheißerisch schien er zu sein. Ein wenig überheblich. Und überdies ziemlich ehrgeizig. Offensichtlich. War er sehr gut über alles informiert. Ob er wohl über Beziehungen hier hineingekommen war? Aber das getraute sich Gustav Klimt nicht zu fragen. Überhaupt fragte er nur wenig. Und sagte wenig. Das Reden. Das überließ er stets lieber anderen.
„Er ist übrigens Kunsthistoriker und Archäologe!“, fügte Matsch flüsternd hinzu. „Eine ganz große Gestalt hier in Wien …“
„Ach so?“
„Ja. Und das da vorn …“, Matsch deutete mit dem Kinn diskret nach vorn zur Estrade, „Der ganz links – das ist Professor Laufberger. Einer der bedeutendsten Ringstraßen-Decorateure überhaupt! Eine lebende Legende! Er leitet hier übrigens die Classe für Malerei und decorative Kunst. Aber das ist für uns zur Zeit noch tabu – wir müssen ja erst die Vorbereitungs-Classe besuchen …“
„Ach so?“ Klimt schaute etwas verzweifelt drein. Woher wußte dieser Knilch nur so viel über das, was hier ablief?
„Jaja!“ Matsch gefiel sich offensichtlich in der Rolle des allwissenden Dozenten. „Der Herr Professor Laufberger führt ja zur Zeit noch die Medaillons an der Fassade der Kunstgewerbe-Schule aus, also am neuen Gebäude, das scheinbar schon im kommenden Jahre vollendet wird. Dann können auch wir dorthin übersiedeln!“
„Ach so?“ Mehr fiel ihm nicht dazu ein. Aber er wußte, dieser Matsch hier, der war reines Gold wert! Er hatte all das, was er selbst nicht besaß: Er steckte in gutem Schuhwerk, trug gute und gepflegte Kleidung – doch vor allem war er sehr selbstbewußt. Und redegewandt. Offensichtlich. Redete er gern. Und viel. Genau das Gegenteil seiner selbst. Dachte Klimt. Aber gut. Um so besser. Denn Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Dieser Matsch. Der würde ihm hier noch von Nutzen sein. Das spürte er. Ganz deutlich.
Inzwischen hatten sich die Herren Professoren erhoben, um den hohen Gast mit einer Verbeugung zu begrüßen. Professor Eitelberger von Edelberg schüttelte ein paar Hände und begann dann umgehend mit seiner kurzen Ansprache:
„Sehr geehrte Herren, meine lieben Collegen, ich nutze hier nur kurz den günstigen Augenblick, um mich Ihnen vorzustellen und um Ihnen das Concept unserer Schule näherzubringen … Wie Sie ja vermuthlich alle wissen, wurde dieses Museum hier, das Österreichische Museum für Kunst und Industrie, vor gerade einmal zwölf Jahren, also im Jahre 1864, durch Seine Majestät, Kaiser Franz Joseph, gegründet. Es handelt sich hierbei übrigens um das erste Kunstgewerbe-Museum auf dem Continent … Nur drei Jahre späther, also im Jahre 1867 – das ist nunmehr neun Jahre her – da ward diese Kunstgewerbe-Schule, übrigens auf mein Anrathen hin, an das Museum angegliedert. Das Vorbild hierfür, ist in England zu finden, in London, und zwar im South-Kensington Museum. Auch die Structur und die Organisation dieser unserer Schule, wurde vom englischen Modell glatt-weg übernommen …“
Herr Professor Eitelberger, Ritter von Edelberg (den die Schüler übrigens mit „Hochwohlgeboren“ anzureden hatten), sprach nun ausführlich über das Konzept dieser Schule, sowie über jenes des South-Kensington Museums in London, dem heutigen Victoria and Albert Museum, mit dessen angegliederter Kunstgewerbeschule. Er war ein wenig zu ausführlich, woraufhin sich allmählich eine gewisse Unruhe unter den – teilweise noch sehr jungen – Schülern zu verbreiten begann.
„Mit der Errichtung unseres neuen Gebäudes, auf das wir alle sehr stolz sind …“, fuhr er fort, „hat man erst vor drei Jahren begonnen, Anno 1873 – und bereits im kommenden Jahre, Anno 1877 also, wird man endlich, mit Sack und Pack, in den Neubau übersiedeln können! Sie sehen – alles hier, ist noch neu, alles befindet sich noch in der Aufbruchs- und Anfangs-Phase – mögen Sie uns also dieses gewiße Durcheinander verzeihen, es aber auch als Chance für sich selbst nützen, da Sie ja hier in gewißer Weise Pioniere, also Wegbereiter für späthere Generationen, sind … Für nähere Informationen zu Ihrem Studium, übergebe ich die Rede nun an meinen lieben Kollegen, Herrn Professor Ferdinand Julius Laufberger … Und Ihnen allen wünsche ich von ganzem Herzen ein guthes Gelingen und frohes Schaffen! Vielen Dank.“
Applaus. Der war nett. Dieser ältere Herr. Dachte Klimt. Und so distinguiert. Na. Adel eben. Später erfuhr er (durch Matsch natürlich – wen sonst?), daß dieser Herr Professor Eitelberger von Edelberg aus Olmütz in Mähren (den alle Schüler, wenn sie untereinander sprachen, nur „Herr Professor Eitelberger“ nannten – bis auf Matsch, natürlich) bereits Anno 1817 geboren ist. Mein Gott. Dachte er. Das war ja fast noch im vorherigen Jahrhundert! Im Achtzehnten, also! Und trotzdem war dieser Mann bloß neunundfünfzig Jahre alt. (Und sah doch viel älter aus. Mit seiner Halbglatze. Und dem Rauschebart.) Wie schnell doch die Zeit vergeht. Dachte er. Auf der Ringstraße konnte man es schließlich sehen. Da schossen die Jahrhunderte nur so an einem vorbei. Zumindest die Illusion davon. Geschichte. Im Zeitraffer. Sozusagen.
Nun erhob der Herr Professor Laufberger sich – ein gebürtiger Böhme und eine nicht minder imposante Erscheinung. (Ebenfalls mit Halbglatze. Und Rauschebart.) All diese Professoren hier kleideten sich ausnehmend gut, wie Klimt auffiel. Allesamt in Schwarz. Wobei der schneeweiße, gestärkte Stehkragen umso deutlicher und kontrastreicher hervorblitzte. So würde er sich eines Tages ebenfalls kleiden. Kleiden müssen. Wenn er denn nur Erfolg haben würde. Beziehungsweise. Um überhaupt Erfolg haben zu können. Denn Kleider. Machen ja bekanntlich. Leute. Ihm selbst war es nicht so wichtig. Aber er wußte genau. Wie wichtig es den anderen war. Die Gesellschaft seiner Zeit. War in erster Linie eine. Die auf Oberflächlichkeiten beruhte. (Wie alle Gesellschaften eben. Aber das wußte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.) Auf visuellen Reizen. Wo mehr der Schein galt. Als das Sein. Die Ringstraße bewies es. Besser als alles andere. Wo plötzlich Prachtbauten der italienischen Hochrenaissance aus dem Boden schossen. Wo plötzlich antike Tempel aus dem Boden wuchsen. Wo sich gotische Kirchen aus dem Boden schraubten. Neben barocken Palais. Mitten in Österreich. Mitten in Wien. Zu Ende des Neunzehnten Jahrhunderts. Hier war alles mehr Schein. Als Sein. In diesen Tagen.
„Meine Herren!“, begann Herr Professor Laufberger seine Rede, „Nachdem uns der werthe Ordinarius und überdies Initiator dieser, unserer Schule ein wenig über die Historie unserer Institution erhellt hat, wofür wir ihm übrigens sehr dankbar sind …“, er verneigte sich seitlich vor Rudolf Eitelberger von Edelberg, „Möchte ich Ihnen nun einige Informationen practischer Natur geben … Sie alle haben ja Ihre Prüfungs-Aufgabe trefflich bestanden – nehmlich einen antiken Kopf zu zeichnen – und nicht nur zu zeichnen, sondern ihn zu übertragen. Ihn zu übertragen – nicht nur vom Drei-Dimensionalen ins Zwei-Dimensionale, sondern auch über die Jahrhunderte – ja, gar Jahrtausende – hinweg, nehmlich von der griechischen Antike, in unsere heutige Zeit hinein … Für die meisten von Ihnen wählte ich einen weiblichen Kopf, denn Sie sollen ja schließlich auch Freude empfinden, bei dem, was Sie hier thun!“, fügte er lächelnd hinzu.
Auch nett. Dachte Klimt. Und er dachte sowohl an den Herrn Professor. Als auch an die Frauenköpfe. Womöglich würden später sogar ganze Frauenkörper hinzukommen!? Echte. Lebendige. Frauenkörper … Weiche. Warme. Atmende. Bebende … Ihm schoß das Blut in den Kopf … Rote. Schwarze. Blonde. Brünette … Aber vor allem Rote. Ja. Das war es. Rote …
„Für Sie alle folgt nun die Classe préparatoire!“, fuhr Professor Laufberger fort, „Et elle est bien obligatoire!“, fügte er lächelnd hinzu.
Hm. Französisch spricht er auch noch. Dieser Laufberger. Dachte Klimt. Nicht ohne Respekt. Denn Fremdsprachen beherrschte er selbst keine. Bis auf die paar Brocken Tschechisch. Die in seiner Familie väterlicherseits kursierten. Eher als Gag. Als geflügelte Worte. Als Sprich-Wörter. Und Flüche. Ab. Und. An. Je. Nachdem. Beherrschte es der Vater noch. Kein Wunder. Denn er war ja schließlich dort geboren. Und aufgewachsen. In Böhmen. Aber die junge Brut sprach es nicht mehr. Sie kannte zwar den Klang. Und die Farbe. Und einige Brocken. Die hatten sie jedenfalls aufgeschnappt. Aber das war’s dann auch schon. Später erfuhr er übrigens (von Matsch natürlich – von wem sonst?), daß dieser Herr Professor Laufberger, im Jahre 1863 (denn Matsch wußte es scheinbar ganz genau!), im Atelier von Léon Cogniet in Paris Aktmalerei studiert hatte. Scheinbar war er auch sehr begabt darin. Also in der Aktmalerei. Und im Französischen auch.
„Nach der Vorbereitungs-Schule, werden Sie nun alle eine drei-jährige Ausbildung zum Zeichner vor sich haben …“, fuhr Professor Laufberger fort, „welche Sie dazu befähigen soll, Zeichenlehrer an einer Mittelschule zu werden … Sie sehen also, meine Herren, die Schüler von heute werden eines schönen Tages selbst zu Professoren werden!“
Es folgte spontaner Applaus. Motivation ist schließlich alles. Zumindest. Schon mal die halbe Miete.
„Wichtig wird für Sie vor allem das Studium antiker Vorbilder sein! Sie werden Gips-Abgüße abzeichnen – und noch einmal Gips-Abgüße abzeichnen! So lange, bis ein jeder Hand-Griff sitzt … Nehmlich um zu lernen, wie man einen voll-plastischen Gegenstand in die Fläche überträgt, ohne diesen jedoch flach oder gar ausdruckslos erscheinen zu lassen … Gleichzeitig wird, mit Hilfe dieser Antiken, der Sinn für edle und erhabene Proportionen vermittelt … Sie werden es sehen: Sie alle werden von dieser Grundausbildung ein Leben lang zehren! Die Gestaltungsprincipien der antiken Kunst sind zeitlos und somit von ewiger Bedeutung. Also werden sie auch während Ihres gesamten Lebens und Schaffens von Bedeutung bleiben …“
Erneuter Applaus. Warum, das wußte allerdings niemand so recht.
„Die Professoren, die Sie dabei anleiten und begleiten werden, sind – ich darf vorstellen …“, er deutete mit der Hand auf den jeweiligen Lehrer, der sich daraufhin kurz erhob – gefolgt von frenetischem Applaus, „Herr Professor Carl Hrachowina, zuständig für das Freihand- und Ornament-Zeichnen – neben dem bereits erwähnten, omnipräsenten Zeichnen nach antiken Repliken … Des weiteren Herr Professor Ludwig Minnigerode …“, erneuter Beifall, „für die Genre- und Portrait-Malerei … Daneben Herr Professor Michael Rieser …“, und wieder Applaus, „zuständig für die Historien- und Bildnis-Malerei …“
„Bildnis-Malerei? Portrait-Malerei?“, fragte Gustav Klimt etwas unsicher seinen Nachbarn, „Ich dachte, wir würden jetzt drei ganze Jahre ausschließlich zeichnen!?“
„Das werden wir auch!“, entgegnete Franz Matsch kurz angebunden, der jetzt, so lange die anderen Professoren vorgestellt wurden, ganz offensichtlich keine Unterredung führen wollte, „Aber auch als Zeichner muß man die Malerei doch schließlich kennen!?“
„Aha.“
„Wir reden späther darüber!“, flüsterte Matsch ihm kurze Zeit später zu, „Oder frag’ am besten gleich die Professoren! Dazu sind sie ja schließlich da!“
Na. Das kann ja heiter werden. Dachte Klimt. Mit diesem neunmalklugen Naseweis. Aber noch war ihm nicht klar, wie wichtig dieser neunmalkluge Naseweis für seine eigene Karriere werden sollte. Denn dieser neunmalkluge Naseweis, der sollte sich bald schon als ein ungemein geschäftstüchtiger herausstellen. Etwas, das Gustav Klimt selbst völlig abging.