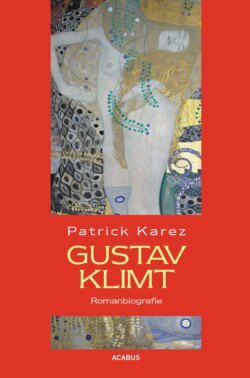Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 17
12
ОглавлениеAngespornt von diesem wahrhaftigen „Makart-Rausch“, von dem ganz Wien, samt Kronländern, während des fulminanten Festzuges auf der Wiener Ringstraße geradezu angesteckt worden war, beschlossen die drei Burschen, den Meister höchstpersönlich in dessen Atelier in der Guß-hausstraße, gleich hinter der prächtigen barocken Karlskirche gelegen, aufzusuchen. Professor Laufberger hatte sie, im Rahmen der Planungen bezüglich der Gestaltung der Festwagen, dem Meister zwar bereits kurz vorgestellt, aber dies war nur eine Angelegenheit von wenigen Sekunden gewesen, die der Meister sicherlich inzwischen bereits wieder vergessen hatte. Und genau das wollten die drei Kunststudenten nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Sie verehrten diesen nämlich dermaßen, daß sie ihn irgendwie dazu verführen wollten, sie ebenfalls – nun, „zu verehren“ wäre wohl zu viel gesagt, da sie ja zu dieser Zeit noch gar nichts darstellten – aber daß er zumindest Notiz von ihnen nehmen würde. Daß er in Zukunft genau wüßte, wer diese drei jungen und angehenden Künstler denn waren. Denn sie waren sich ganz sicher, daß sie sehr bald schon von sich reden machen würden.
Während ihrer Mittagspause brachen sie also auf. Die Gußhausstraße war nicht allzuweit von der Kunstgewerbeschule entfernt, weshalb sie zu Fuß gingen. Einfach die Ringstraße entlang. Vorbei am Stadtpark. Und bis zum Schwarzenbergplatz. Dann links. Und dann gleich wieder rechts. Es war nichts Ungewöhnliches, Meister Makart in dessen Atelier zu besuchen – schließlich tat ganz Wien es! Der Meister wünschte dies sogar ausdrücklich. Denn während er oben, im oberen Geschoß, eine Rückzugsmöglichkeit hatte, konnten die Besucher, die in der Regel einen Obolus dafür entrichten mußten, unten im Atelierraum in Ruhe seine Werke bestaunen. Und die hatten es in sich. Es war ja noch eine Zeit vor der Erfindung des Cinematographen. Also der bewegten Bilder. Bewegte Bilder, zumal realistische, kannte der Mensch damals noch nicht. Und genau diese Lücke füllten die Maler aus. Ein Maler war damals eine Art Regisseur. Drehbuchautor. Beleuchter. Ausstatter. Et cetera. In einem. Zumal einer wie Makart. Der seine Bilder extrem groß dimensionierte – weshalb sie manchmal sogar die zehn Meter Leinwandbreite überstiegen, also einer späteren Kinoleinwand bereits recht nahe kamen. Und was man dann schließlich auf diesen riesigen Bildern zu sehen bekam, das waren opulente historische Kostümfeste, die sich allerdings kaum an die Historie hielten. Und das war völlig neu. Das war anders. Zumal in Wien. Im Atelier des Meisters waren stets einige dieser großformatigen Werke ausgestellt – und genau die wollten die drei Studenten heute etwas genauer unter die Lupe nehmen.
In einem Hinterhof gelegen, etwas abgerückt von den es umfangenden Wohnbauten, lag das zweigeschoßige Gebäude, welches sich – zumal angesichts der es umschließenden, sehr hohen und neuen Architektur – beinahe wie ein Gartenhäuschen, oder gar ein kleineres Landhäuschen ausnahm. Vor allem Gustav Klimt war begeistert. Von diesem Haus. Im Haus. Inmitten von Häusern. Er war verzaubert. Von dieser Oase. Der Stille. Und Ruhe. Während nur ein Stückchen weiter vorn – am Schwarzenbergplatz, am Karlsplatz – sowie auf der diese beiden Plätze miteinander verbindenden neuen Ringstraße – als auch am benachbarten Naschmarkt – der Verkehr nur so brandete. Es vor Menschen nur so wimmelte. Und wo Wien am allerlebendigsten war. (Und das nicht nur in jenen Tagen.) Von Außen absolut unsichtbar, und nur Eingeweihten zugänglich, lag da also plötzlich dieses Garten- und Dorf-Idyll, dieser verborgene Musen-Tempel, inmitten der Großstadt. Und das gefiel Gustav Klimt sehr. So ein Atelier-Häuschen würde er eines Tages ebenfalls besitzen wollen. Um dort in Ruhe schaffen zu können. Auf dem Lande. Und doch mitten in der Großstadt. Und er sollte dies auch. Alle seine späteren Ateliers, sollten genau diesen Charakter aufweisen. Nämlich einer bezaubernden Mischung. Aus Stadt. Und Land.
Der Meister selbst war zu dieser Stunde nicht anwesend. (Kein Wunder, denn es war ja schließlich Mittagszeit – und ein bedeutender und erfolgreicher Künstler, zumal der Malerfürst höchstpersönlich! – würde ganz sicher nicht daheim, bei einer Dose Öl-Sardinen, herumsitzen, das war den Dreien klar.) Vermutlich speiste er soeben in einem der noblen Wiener Restaurants, umringt von wichtigen Persönlichkeiten der hohen Wiener Gesellschaft, die alle um seine Gunst buhlten, in der Hoffnung, er würde sich dazu herablassen, ein Portrait von ihnen zu malen. Denn der Malerfürst Makart war eine der wichtigsten Künstler-Persönlichkeiten im damaligen Wien. Nein: Er war die wichtigste Künstler-Persönlichkeit im damaligen Wien. Die drei konnten sich sicherlich gut vorstellen, wie er nun gerade dasaß, der selbsternannte Fürst, und den Normalsterblichen gnädigst eine Audienz gewährte. Im Café Griensteidl. Oder doch eher im brandneuen Café Central. Oder anderswo. Vermutlich mit einem purpurfarbenen Wams aus Panne-Samt angetan. Mit einer neckischen Weste aus Gold-Brokat darüber. Und über dem allen. Dies alles noch überragend. Dem Ganzen die Krone aufsetzend. Wie das Sahnehäubchen. Auf der Torte. (Nein: Wie die Kirsche. Auf dem Sahnehäubchen. Auf der Torte!) Ein überdimensionierter, breitkrempiger Hut. À l’allure baroque. Mit riesiger weißer Straußenfeder. (Die abwechselnd ihm selbst sowie seinen Gästen ins Gesicht hing.)
Nachdem sie (beziehungsweise Franz Matsch) angeklopft hatten, öffnete ihnen ein Diener in Livrée die Tür. (In roter sogar!) Der Meister sei nicht daheim. Der Maler. Der Fürst. Der Malerfürst. Zumindest die rote Livrée nahm sich schon einmal sehr fürstlich aus. Dachten die drei. Und waren schwer beeindruckt davon. Es war zweifelsohne dekadent. Aber genau das machte den Malerfürsten schließlich aus. Der hier, in seinem Ateliergebäude in der Gußhausstraße, sein ganz persönliches Reich erschaffen hatte. Sein Fürstentum. Sein Malerfürstentum. Nun galt es also, die Grenze zu passieren. Die Reichsgrenze. Zum Makartschen Fürstentum. Und das gab es nicht umsonst. Denn der Diener blieb beharrlich. Und hartnäckig. Er war ein guter Diener. Und bewachte das Heiligtum seines Meisters und Brotgebers wie ein Cerberos. Also zückten die drei ein paar Münzen. Einen Obolos. Für den Cerberos. Denn selbst der allerbeste Diener war in den meisten Fällen bestechlich. Und schließlich diente ihr unlauteres Eindringen ja einem höheren Zwecke. Denn sie wollten sich die Arbeiten des Meisters nur ansehen. Zu Studienzwecken. Versteht sich. (Wenn auch heimlich. Und gegen Vor-Kasse.)
Das Innere des Ateliergebäudes, das von Außen so unscheinbar wirkte, verschlug ihnen regelrecht den Atem. Was für eine Opulenz! Was für eine Extravaganz! Quelle allure! Knapp an der Grenze des Irrsinns. Beziehungsweise. Diese Grenze bereits überschreitend. Die Grenze des guten Geschmacks zumindest. Jetzt erst verstanden sie, warum man überall in Wien von einem Makart-Stil sprach! Dies hier. War der Keim. Die Saat. Der Urquell. Dieser Geschmacks-Verirrung. Und Geschmacks-Verwirrung. Die heilige Quelle. Der Arethusa. Aus der alles schrille und quirlige Leben nur so herausströmte. Heraussprudelte. Und sich über ganz Wien ergoß. Ja. Man sprach tatsächlich vom Makart-Stil. In Wien. In diesen Tagen. Also im späten Neunzehnten Jahrhundert. Vor allem bei der Wohnungseinrichtung. Die sich durch großen Pomp auszeichnete. Und Plüsch. Wohin das Auge reichte. Durch schwere Wandbehänge. Tapisserien. Gobelins. Dunkle Holz-Vertäfelungen. Und opulente, mittelalterlich-renaissance-barockhaft anmutende Kronleuchter. Ja. Alle historischen Stile. Wurden hier wild zusammengemischt. Zusammengekocht. Der Meister selbst, präferierte zwar zweifelsohne die Dürerzeit. Aber er streute und mischte auch ganz gern einmal andere Ingredienzien. Unter diesen bunten Salat. Vor allem gerne Barock-Elemente. Ganz einfach. Weil die nun mal viel üppiger waren. Also kalorienhaltiger. Also nahrhafter. Als die schnöde Dürerzeit. Sein fulminanter Festzug auf der Ringstraße hatte es ja bereits gezeigt: Dürer und Rubens. Wild zusammengemischt. In einer insalata mista. Beziehungsweise. Insalata eclettica. Einer macédoine éclectique. Die nur schwerlich zu verdauen war. Zumal für Puristen. (Und das waren nicht wenige in Wien. In diesen Tagen. Weshalb Makart durchaus auch Feinde hatte. Beziehungsweise. Gourmet-Kritiker. Vor allem. Unter seinesgleichen.)
Aber diese wilde Zusammenmischung, die völlig unhistorisch, beziehungsweise unwissenschaftlich, war, stellte für ihn überhaupt kein Problem dar. Wie gesagt: Seine Kunst war die Vorstufe zum Kino. Und wenn man sich einen Hollywood-Film ansieht, der im Mittelalter oder gar in der römischen Antike spielt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn plötzlich reine Phantasie-Kostüme auftauchen, die mit der jeweiligen Epoche nicht das geringste zu tun haben – und wenn überdies die Hälfte der (kaugummiknatschenden) Komparsen noch immer ihre Armbanduhr trägt, wenn irgendwo im Hintergrund ein Handy klingelt (am besten noch mit einer billigen Techno-Melodie), oder wenn am Himmel über dem römischen Colosseum, wo soeben pseudo-historische Tier- und Menschen-Hatzen stattfinden, plötzlich Kondensstreifen von Flugzeugen zu sehen sind. Da darf man eben nicht so kleinlich und spießig sein! Schließlich geht es dabei um die Gesamtwirkung! Um die Illusion. Und darauf verstand sich Makart zweifelsohne. Und trieb es geradezu zur Perfektion. Auf die Spitze. Und genau dieser historistisch-ahistorische Mischmasch, dieses Spektakel für die Sinne, unter Vorgaukelung einer Geschichte, die niemals so ausgesehen hatte und die in ihrer wilden und unverschämten Kopie noch um ein vieles prachtvoller – und vor allem lebenswerter – war als das Original, erfreute sich beim Wiener Großbürgertum der Gründerzeit größter Beliebtheit.
Um dieses theatralisch-präcineastische Ambiente auch wirklich perfekt zu machen, ging Makart schwer in die Details. Und so trat er denn tatsächlich auch als Innenausstatter und Dekorateur auf, insbesondere für seinen Mäzen, den Großindustriellen Nikolaus Dumba, von Kaiser Franz Joseph in den Adelsstand erhoben, wie so viele, dessen Palais auf der Ringstraße Makart in einen historistischen Traum verwandelte (welcher in späteren Jahrzehnten zu einem regelrechten Alb-Traum und zu einer Schreckensvision des modernen, technokratischen Menschen werden sollte). Sein üppig dekoriertes Atelier diente ihm dabei als (für jedermann begeh- und erlebbare) Mustervorlage. Sogar eigene Krägen wurden nach seinem Entwurf gestaltet. Und fortan Makart-Krägen genannt. Und Hüte entwarf er auch. Makart-Hüte. Verrückte, historistisch anmutende Gebilde, die einiges an Mut von seiten ihrer Träger erforderten. Dem Ideal des Gesamtkunstwerkes, welches damals allerorts propagiert wurde, kam er damit sehr nahe. Kein Wunder, denn ihn verband, unter anderem, eine enge Freundschaft mit Richard Wagner – dem ersten, der diesen Gedanken wirklich konsequent verfolgt und sogar verwirklicht hatte. Und in Wien fiel dieser auf äußerst fruchtbaren Boden. Auch in der post-makartschen Ära. Denn da nahm Josef Hoffmann diesen Gedanken wieder auf. (Doch dazu später.)
Außer Innenausstattungen, Krägen und Hüten, lancierte Makart auch den sogenannten Makart-Strauß, woraufhin eine regelrechte Manie in Wien ausbrach. Von seinen Reisen hatte Makart nämlich allerhand exotische Pflanzen mitgebracht, deren Geäst, Geblüht und Geblätt er, in getrockneter Form, zu opulenten – ja, geradezu überbordenden – Gebinden (vielmehr waren es Gebilde) arrangierte. Diese Monströsitäten aus getrockneten Blumen, Palmwedeln und anderem Blattwerk sowie Binsen und Gräsern eroberten mit einem Schlag alle großbürgerlichen Salons. Es war ja auch praktisch, denn so mußte man nicht jeden Tag frische Blumen arrangieren lassen. Und chic war es auch. Denn jeder hatte es. Viel schicker noch als frische Blumen. Die hatten schließlich selbst die Bauern daheim! Nein. Wohin man in Wien auch kam, in diesen Tagen, da raschelte und knisterte es. Da bröselte und bröckelte es. Da staubte und rieselte es. Da röchelte und hustete es. Denn diese Makart-Kapriolen – also die Makart-Wand-, Fenster- und Möbel-Draperien, diverse Behänge aus schwerem Samt, aber allem voran die Makart-Strauß-Monstren – waren wahre Staubfänger. Doch wozu hatte man damals schließlich Personal? Wer sich einen Makart-Strauß zulegte, der hatte auch eine „Perle“ in petto, die ihn tagtäglich abstauben mußte.
Und natürlich führte der Meister auch Gebäude-Dekorationen aus. Wobei die meisten Aufträge jedoch an seinen völlig überzogenen Honorarforderungen scheiterten. Denn der Meister war eine Diva. Eine Zicke. Ein Superstar. Ein Fürst eben. So konnte zum Beispiel erst knapp zwei Jahre später, nämlich im Jahre 1881, nach langem Hin und Her, mit der Ausgestaltung seiner Entwürfe für das imposante, zentrale Stiegenhaus des Kunsthistorischen Hofmuseums in Wien begonnen werden. Diese Gemälde würden Allegorien der Malerei und der Plastik zeigen. Sowie zehn Darstellungen von berühmten Malern. Natürlich mit ihren Modellen. Denn Makart polarisierte gern durch nackte Haut. Die natürlich vornehmlich weiblicher Natur war. Genau das hatte ihn auch so berühmt gemacht. (Und Gustav Klimt sollte es später ganz genauso halten. Der handfeste Skandal war nämlich immer schon die beste Publicity. Auch im Neunzehnten Jahrhundert.) Und doch sollte Makart seinen Auftrag nicht vollenden können. Da er drei Jahre später plötzlich verstarb. Dies war dann übrigens auch die ganz große Chance für die drei jungen Künstler hier. (Doch auch dazu später.)
Nach Makarts frühem und völlig unerwartetem Tode herrschte allgemein das Gefühl vor, daß mit ihm eine ganze Epoche zu Ende gegangen sei. Und dem war auch so. Tatsächlich sollte es nicht lange dauern, bis er für viele Jahrzehnte geradewegs zur Spott- und Schimpf-Figur wurde. Zu einer Art Schießbudenfigur. Des schlechten Geschmacks. Stand er bald schon für alles Übertriebene. Rückwärtsgewandte. Unmoderne. Und dabei übte er – und das auch noch lange über seinen Tod hinaus – einen überaus starken Einfluß auf andere Künstler aus. Vor allem auf jüngere Maler. Und zu diesen zählte nun auch ein Gustav Klimt. Nicht nur, daß dieser Makarts großdimensioniertes Projekt für das Treppenhaus im Kunsthistorischen Hofmuseum vollenden sollte, er ließ sich vor allem, und wie bereits erwähnt, von dessen untrüglichem Gespür für Skandale beeinflussen und leiten. Und womit hätte man damals in Wien wohl einen größeren Skandal verursachen können als mit nackter Haut? Die menschliche Nacktheit, der entblößte menschliche Körper an sich, das war damals „Pfui-gack!“. Das war triebhaft. Und animalisch. Das war etwas für diesen verrückten Darwin. Und seine Affen. Aber wohl ganz sicher nicht für den Menschen. Der ja eher ein Abbild Gottes sei. Als ein naher Verwandter der Primaten. So zumindest sah man es. Damals. Im späten Neunzehnten Jahrhundert. Und auch Gustav Klimt sollte sich diesen Rummel um die Nacktheit zunutze machen. Deren unmotivierte Darstellung in der Kunst ja damals noch als Pornographie galt. Und als Perversion.
Demnach lösten Makarts erste Ausstellungen, im Jahre 1868 in München, nicht nur großes Aufsehen, sondern vor allem sehr heftig geführte Debatten aus. Aber wie gesagt: Sex sells. Skandale. Und Negativ-Propaganda. Sind immer noch die beste Werbung. Zumindest aber. Sind sie besser. Als gar keine Werbung. Und diese heftig geführten Debatten und Diskussionen um seine Kunst, waren wohl auch der Grund, weshalb der damals erst achtundzwanzigjährige Salzburger Künstler, nur ein Jahr später, vom Kaiser höchstselbst nach Wien berufen wurde. Denn ganz so konservativ war man in Wien doch nicht. Zumindest. Noch nicht. Zumal. Was die Kunst anbelangte. Schließlich waren die Habsburger immer schon große Förderer und Gönner der Kunst gewesen. (Die ja schließlich, zu ihrer jeweiligen Epoche, als sie nämlich vom Kaiserhaus angekauft wurde, ebenfalls „modern“ gewesen war. Also „zeitgenössisch“.) Außerdem hatten die Habsburger immer schon ein großes Faible für Skurrilitäten gehabt. Man denke da nur an Rudolf. Den Zweiten. Und seine geniale Kunstkammer. Angefüllt mit Verrücktheiten. Und Wahnvorstellungen. Eines Arcimboldo. Oder Bosch. Oder Breughel. Oder an die spanische Linie. Der Habsburger. Die selbst einen El Greco förderte. Den alle anderen für verrückt hielten. Und für unfähig sowieso. Und aus einem Dürer. Wäre nichts geworden. Ohne Kaiser Maximilian. Und so wurde auch Kaiser Franz Joseph, der sich stets mit seiner Meinung bezüglich der Kunst sehr stark zurückhielt (und von dem man jedoch weiß, daß er für Modernes nicht viel übrig hatte), seiner familiären Tradition entsprechend, zu einem der größten Gönner und Förderer der modernen Kunst überhaupt. Und gerade der modernen Kunst. Ob er sie nun persönlich mochte. Oder nicht. Und er mochte sie nicht. Aber er sah es als seine heilige Aufgabe (oder wohl eher als seine Pflicht) an (denn er war überaus pflichtbewußt), die Künste zu fördern. Koste es. Was es wolle. Und so hätte es wohl keinen Makart gegeben. Und einen Klimt wohl auch nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Ohne Kaiser Franz Joseph.
Schließlich konnte ja ein Maler, von dem plötzlich das halbe Deutsche Reich redete (und bald schon ganz Europa!), nicht wirklich schlecht sein. Also holte man ihn kurzerhand nach Wien. Beziehungsweise tat dies der Kaiser höchstselbst. Ab in die Residenz- und Reichshauptstadt mit ihm! Dort solle er sich ruhig austoben. Dort habe man vermutlich mehr Verständnis für ihn. Als im provinziellen München. Dachte man. Einer aufgeblasenen Provinz-Hauptstadt. In einem aufgeblasenen Pseudo-Königreich. Welches Napoleon erst kürzlich erschaffen hatte. Ausgerechnet der! Und zwar förmlich aus dem Nichts. Aus einem kleinen Herzogtum nämlich. Am Rande der Alpen. Und nur, um Österreich damit zu ärgern. Um Österreich damit in den Rücken zu fallen. Um Österreich damit zu schaden. Wie immer. Wenn eine neue Intrige aus Frankreich kam. (Dies war übrigens auch der Grund, weshalb man in Wien umgehend darauf reagierte und, in typisch Habsburgischer Tu-Felix-Austria-Nube-Manier, um somit Kriege um jeden Preis zu vermeiden, tunlichst zusah, daß der junge Monarch ausgerechnet eine Bayuwarin ehelichte. Und das, obwohl die Wittelsbacher weit – sehr weit – unter dem Stand der Habsburger waren. Mit ein Grund übrigens, weshalb diese Ehe einfach nicht funktionieren konnte. Und das, obwohl sie ja nun, hochoffiziell, einen fünfundzwanzigjährigen Bestand hatte. Also offiziell versilbert war.)
Und so verstand es der Künstler (der eben auch ein gewiefter Geschäftsmann war), immerzu begleitet von Skandalen und Skandälchen, die seine effektvoll inszenierten Sensationsbilder nach sich zogen, beim aufstrebenden Bürgertum der zweiten Hälfte des Neunzehnten Jahrhunderts sehr bald jene gesellschaftliche sowie künstlerische Anerkennung zu erlangen, die ihm in seinen Augen auch gebührte. (Denn leicht größenwahnsinnig war er auch.) Und tatsächlich sollte er bald schon in Wien gefeiert werden. Und zwar geradezu wie ein Popstar späterer Zeiten. Kaum ein anderer Künstler sollte das Wiener Kulturleben seiner Zeit so sehr prägen wie er. (Weshalb diese Epoche auch heute noch als „Makart-Zeit“ bezeichnet wird.) Bereits im Jahre 1868, und noch in München, war Hans Makart also schlagartig berühmt geworden. Und zwar mit seinen sogenannten ‚Modernen Amoretten‘. Sowie mit seinem Monumentalgemälde ‚Die Pest in Florenz‘. Und beide Arbeiten galten – jedoch nicht aus dem selbem Grunde – als schockierend. Und sensationell. Zugleich. Und das nicht nur in München! Sondern auch im Rest Deutschlands. Das ja da schon größtenteils Preußen war. Und wo diese Arbeiten auf Wanderausstellung gezeigt wurden. Wie wilde Tiere. In einem Circus. Wie Darsteller. Auf einer Wanderbühne. Lockten diese Bilder erstaunlich viele Besucher an. Kein Wunder: Denn sie waren ja auch, wie gesagt, die Vorstufe zum Kino. Beziehungsweise zum Fernsehen. So etwas lockte die Menschen damals immer an. So ein Spektakel! Denn was hätten sie auch sonst anderes tun sollen. Außer ins Theater zu gehen. Oder in die Oper. Oder daheim zu lesen. Oder sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Nein. Diese Zeit. Das Neunzehnte Jahrhundert. Und zwar noch vor der Elektrifizierung. War eher ein ruhiges. Ein beschauliches. Und deshalb zog es die Menschen stets an. Wie die Motten. Das Licht. Wenn so eine fulminante Bühnen-Show die Runde machte. (Und selbst wenn sich auf dieser Bühne absolut nichts bewegte. Denn die Bewegung fand damals schließlich noch im Kopfe der Zuschauer statt. Heute kaum mehr vorstellbar.)
Im Jahre 1869 richtete man ihm in Wien also ein Atelier ein. Und zwar auf Staatskosten! Auf Geheiß seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit höchstselbst. Dort lebte und schuf er wie ein steinreicher Fürst. Eitel. Und extravagant. Und auch ein wenig größenwahnsinnig. Noch später sollte der Kunstkritiker Ludwig Hevesi über ihn schreiben, daß er „zeitlebens kostümiert“ war. Ferner hieß es, daß ihm „das Kostüm eines Fürsten und Milliardärs zu eigen gewesen“ sei. Und daß „nicht nur sein Äußeres fürstlich wirkte, sondern auch sein Gehabe“. Denn „er war ein in Gold wühlender Fürst“5. (Und damit machte er sich, wie gesagt, nicht nur Freunde in Wien.) So sehr sein Frühwerk die Kritiker und die Massen auch polarisierte, bald war er schon in der Mitte der Wiener Gesellschaft angekommen. In der aufstrebenden großbürgerlichen Gesellschaft. Welche in jener Zeit von Wohlstand geprägt war. Und von Überfluß. Und somit. Bereits das Endstadium der europäischen Gesellschaft einläutete. Nämlich die Dekadenz. Die sich nur fünfundvierzig Jahre später in einem verheerenden, allesvernichtenden Krieg entladen sollte.
Und einen eigenen Kopf hatte Hans Makart immer gehabt. Auch schon. Als Student. Da war ihm die Wiener Akademie nämlich schlichtweg zu fad gewesen. Zu steif. Zu unglamourös. Weshalb er kurzerhand nach München ging. Um dort sein Studium abzuschließen. (Da man es ihm nicht so leicht verzieh, verbreitete sich bald schon die Fama in Wien, Makart habe die Akademie nicht geschafft, beziehungsweise, man habe ihn dort herausgeworfen. Aber dem war nicht so. Er ging. Ganz einfach. Weil es ihm zu fad war.) München, mit seinen modernen Tendenzen, erschien ihm einfach geeigneter. Und ebendort, an der Münchener Akademie der Bildenden Künste, fand er auch in Carl Theodor von Piloty einen (in seinen Augen) angemessenen Meister. Denn Piloty hatte ebenfalls ein Faible für großdimensionierte Historienbilder. Und pathetische Inszenierungen. Mit denen er auch berühmt wurde. (Noch heute gilt Carl Theodor von Piloty als einer der wichtigsten Wegbereiter der gründerzeitlichen Malerei in Deutschland.) Doch obwohl Makart ganze sieben Jahre bei Piloty in München in Ausbildung war, eignete er sich dessen Historienmalerei nicht an. Denn wie gesagt: Makart hatte immer schon einen eigenen Kopf gehabt. Auch schon. Als Student.
So konnte es nun mal passieren (und es passierte oft!), daß sich auf einem seiner Monumentalgemälde, welches zum Beispiel ein Sujet aus dem Fünfzehnten Jahrhundert thematisierte (wie etwa die ‚Caterina Cornaro‘), bei den dargestellten Personen eine wilde Kostümierung des sechzehnten oder gar siebzehnten Jahrhunderts, also aus der Barockzeit, einschlich. Ganz einfach. Weil er es so wollte. Und das Publikum liebte es. Zudem fehlte seinen Bildern oft eine konkrete Aussage. Zumeist bekamen sie ihren Titel deshalb erst nach der Fertigstellung. Makart hat also für seine Pseudo-Historienbilder nicht etwa schlecht recherchiert. Sondern gar nicht recherchiert. Ganz einfach. Weil es ihn nicht interessierte. Er war ja schließlich Künstler! Und kein Historiker. Das war seine Meinung. Und es funktionierte. Denn seine Bilder kamen beim Publikum unglaublich gut an. Hans Makart ist somit einer der ersten Künstler überhaupt (und somit im Ansatz erstaunlich modern!), bei denen der Bildinhalt völlig zweckentbunden ist. Eine Vorstufe des L’Art pour l’art. Denn bislang war der Inhalt stets der einzige Zweck der Malerei. Erst der Inhalt, gab ihr überhaupt einen Sinn. Eine Daseinsberechtigung. Und zwar ausschließlich. Somit wurden Makarts Bildthemen also zu einem bloßen Vorwand, zu einem Alibi also, um sich ungeniert in einem Farbenrausch ergehen zu können. Gewürzt mit einer deftigen (und damals sehr gewagten) Prise Nacktheit. Und Erotik. Natürlich.
Makarts schrillbunte Farbpalette wurde rasch legendär. Genauso wie sein schier unglaubliches Schaffenstempo. Bald schon warf man ihm sogar ein „diarrhoeartige[s] Produzieren in seiner asiatischen Trödelbude“6 vor. (Mit letzterem war sein Atelier gemeint.) Genauer gesagt. Stammte dieser Vorwurf vom gebürtigen Speyerer Anselm Feuerbach. Einem Künstlerkollegen. Beziehungsweise Künstlerfeind. Der unterschiedlicher nicht sein konnte. Wenn man sich Makart als überschwenglichen, ausschweifenden, genußsüchtigen und lebenslustigen Barockfürsten (mit roter Trinkernase) vorstellt, so muß man sich Feuerbach als verkniffenen und pedantischen, puritanischen und protestantischen Pfarrer (mit bleichem, ausgemergeltem Gesicht) vorstellen. Denn er war ein braver und biederer Sohn. Eines Archäologen. Und sogar Neffe. Eines Philosophen. (Nämlich keines geringeren. Als Ludwig Feuerbach.) Und Enkel. Des großen Rechtsgelehrten. Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Weshalb er bereits von frühester Kindheit an mit den großen Themen der antiken Mythologie vertraut gewesen war. Beziehungsweise. Vertraut sein hatte müssen. Und seine Karriere war wirklich bemerkenswert: Nach ersten Studienjahren an der Düsseldorfer Akademie folgte eine Ausbildung in Paris, im Atelier keines geringeren als Thomas Couture. Und dann ein langjähriger Aufenthalt in Rom. Dem Sehnsuchtsort. Vieler deutscher Maler. In diesen Tagen. Was absolut zu erwarten war. Zumal bei dem Sohn eines Archäologen.
Doch erst die Berufung an die Wiener Akademie, im Jahre 1873, brachte ihm (wie so vielen) die erhoffte Anerkennung. Auch von Seiten des K.u.K. Ministeriums für Cultus und Unterricht. Eine Anerkennung, die Hans Makart, trotz seines enormen Erfolges beim Publikum, erst drei Jahre später zuteil wurde. Nämlich erst, als Feuerbach seinen Hut genommen und Wien wieder verlassen hatte. Und genau dies war auch der Grund für die andauernde Rivalität der beiden Künstler. Die geradezu in einer Feindschaft ausartete. (Was jedoch eindeutig von Feuerbach ausging.) Der eine, der sich zeitlebens als verkannter Künstler sah, wurde zwar angesehener Professor an der Akademie, konnte es jedoch beim besten Willen nicht verwinden, daß der andere (der zudem in seinen Augen auch noch so schrecklich vulgär war) so unglaublich erfolgreich war und von Krethi und Plethi – und sogar vom Kaiser! – geradezu vergöttert wurde. (Und der zudem förmlich in Geld schwamm!) Der andere hingegen, der allseits beliebte und gefeierte Malerfürst, vermochte es nicht zu verstehen, warum man ihm, trotz der Liebe und Anerkennung des Volkes und sogar des Kaiserhauses, erst nach dem Weggang seines Rivalen aus Wien halbherzig eine Professur angetragen hatte. (Doch genau dasselbe Schicksal sollte später auch Gustav Klimt ereilen. Schlimmer noch. Ihm würde man niemals eine Professur antragen. Und er sollte daran verzweifeln. Zumindest aber, sollte es ihn verbittern.)
Während sich auf Makarts Gemälden dralle Nackedeien à la Rubens lasziv rekelten, wurden Feuerbachs Arbeiten eher von monumental wirkenden, zumeist im makellosen Profil dargestellten Figuren des griechischen Altertums charakterisiert. Während Makarts licht- und farbendurchflutete, geradezu berauschende Gemälde pure Lebensfreude ausstrahlten, war die Grundstimmung der Werke Feuerbachs eher düster und melancholisch. Bisweilen sogar deprimierend. Zudem von einer geradezu irrationalen und irrealen Sehnsucht nach dem Ideal geprägt. Welches der unglückliche Archäologensohn und Philosophenneffe in der Antike zu finden glaubte. Die er zu diesem Zwecke stark verklärte. (Allein sein Werk ‚Orpheus und Eurydike‘, heute im Wiener Belvedere zu sehen, sagt diesbezüglich schon alles aus.) Dieser Konkurrenzkampf zwischen den beiden ungleichen Kontrahenten artete schließlich in einem regelrechten Krieg aus, der via Briefen und Schmäh-Artikeln in der Presse, vor den Augen aller also, peinlichst ausgefochten wurde.
Verständlicherweise riß sich nun alles in Wien um Makarts Werke. Vornehmlich. Mit zumeist offen zur Schau gestellten erotischen Elementen. Zudem waren seine Werke europaweit bekannt. Und das war letztendlich auch der Indikator für Erfolg. In Wien. Wenn man es auch woanders schaffte. Dann wurde man plötzlich auch in Wien interessant. Und angenommen. Gefeiert. Und geliebt. Aber sobald man in Wien geliebt wurde, dann war es meistens schon der Anfang. Vom Ende. Dann war schon irgendwie. Die Luft raus. Und der Wurm drin. Dann würde man schon bald „außer Curs kommen“7. Wie Feuerbach es auch für Makarts Kunst prophezeite. Und das schon im Jahre 1873. Wo dieser doch gerade erst „in Curs“ kam. (Auch Klimt sollte dies eines Tages am eigenen Leibe zu spüren bekommen.)
Und wirklich legendär waren Makarts stadtbekannte Atelierfeste. Wer es schaffte, hierher eingeladen zu werden, der war was in Wien. Der stellte etwas dar. Denn auf diesen Atelierfesten tummelte sich alles, was Rang hatte. Und Namen. Viele seiner berühmten Zeitgenossen. Und Artgenossen. Waren dort zugegen. Und nicht nur nationale. Sondern auch internationale. Unvergessen bleibt zum Beispiel jenes Fest in seinem Atelier, wo, auf vehementes Betreiben des schrillen Gastgebers hin, der zickige Komponist Richard Wagner sich mit dem Architekten Gottfried Semper aussöhnen sollte. Bei Makarts Atelierfesten. Da sagten sich nicht etwa Fuchs. Und Hase. Gute Nacht. Sondern Wagner. Und Semper. Guten Abend. So war das. Bei Makart.
Noch bevor die drei Kunststudenten überhaupt einen genaueren Blick auf die monumentalen Werke werfen konnten, welche an den Atelierwänden ausgestellt waren, ging plötzlich erneut die Tür auf. Im gleißenden Gegenlicht konnten die drei bloß eine Silhouette erkennen. Die merkwürdig war. Irgendwie falsch. Denn sie gehörte nicht hierher. Also nicht in diese Zeit. Da gab es offensichtlich ein Cape. Nein. Es war ein bodenlanger Umhang. Und eben diesen Hut. Gewaltig. Ausladend. Überbordend. Monströs. Mit einer riesigen Straußenfeder auf der Seite, welche im Durchzug auf und ab wippte wie ein lebendes Objekt. Den dreien stockte der Atem. Sollte dies etwa …? Aber ja. Sie hatten mehr Glück. Als Verstand. Denn er war es. Tatsächlich. Der Meister persönlich. Der Maler. Der Fürst. Der Malerfürst. Und genauso war auch sein Gehabe.
„Oha!“, machte er und es klang ganz nach einem einstudierten Bühnenstück, „Besuch!? Zu so früher Stunde?“ (Es war bereits halb Eins.)
„Verzeihen Sie, Meister Makart!“, reagierte Franz Matsch geistesgegenwärtig, „Aber wir wollten nur …“
„Jaja!“, Makart warf sich, in einer dramatischen Geste, den rechten, unteren Teil seines Umhangs über die linke Schulter, „Sie möchten sich inspirieren lassen! Hm? Meine Ideen stehlen! Nicht wahr? Aber wer könnte es Ihnen auch verdenken!?“
„Aber nein, Meister!“, wagte nun auch Ernst Klimt seinen Einsatz, „Wir wollten doch nur …“
„Hm!“, Makart stolzierte auf sie zu, wobei seine Fersen den Boden nicht zu berühren schienen. Seine Füße wirkten merkwürdig gestreckt, wie bei einer Primaballerina, und tatsächlich schritt er auf Spitzen daher; „Sie sind doch … die drei Gehülfen vom Professor Laufberger, nicht wahr?“
Die drei nickten. Es wunderte sie sehr, daß der Meister sich überhaupt noch an sie erinnerte.
„Wie hießen Sie doch gleich?“
„Klimt!“
„Klimt!“
„Matsch!“
„Hm …“, Makart schaute sinnend an die Decke, „Das klingt verdächtig nach Regen!“
Die drei verstanden den Witz daran nicht sofort – und doch sollte dieser verrückte Spruch bald schon die Runde machen.
„Wir wollten uns nur … schnell Ihre Werke ansehen!“, hakte Matsch nun nach, „Während unserer Mittagspause …“
„Was?“, Makart spielte sein Erschrecken darüber eine Spur zu theatralisch, ähnlich wie ein Pantomime, „Sie wollen sich … meine Werke … nur schnell … ansehen? Quasi zwischen Thür und Angel? Quel affront!“
„Nun ja … Ich meinte eigentlich …“
„Papperlapapp!“, Makart mimte den Beleidigten, „Meine Werke kann man sich gar nicht ‚nur schnell’ ansehen! Quasi im Vorbeigehen! Zwischen Thür und Angel! Da können Sie es gleich bleiben lassen!“
„Verzeihen Sie bitte, ich wollte Sie nicht …“
„Café?“, der Meister wirbelte um seine eigene Achse, wie eine Hof-Opern-Balletteuse, und klatschte zweimal in die Hände – noch ohne überhaupt eine Antwort abgewartet zu haben.
Sofort erschien der Diener. In seiner roten Livrée. Hinter einem roten Vorhang. Wie aus dem Nichts. Aber vielleicht hatte er auch davor gestanden. Chamäleonhaft verharrend. In perfekter, lauernder Mimikry. Die ganze Szenerie war derart grotesk, daß den drei Burschen förmlich Hören und Sehen verging. In heutiger Zeit, in der es ja gar keine schillernden und exaltierten heterosexuellen Männer mehr gibt, und in der alle nur darauf erpicht sind, sich künstlich so männlich wie nur irgend möglich zu machen (mit Glatze, auftrainiertem Oberkörper, vulgären Tattoos, primitivem Gerede, etc.), würde Makart glatt als Obertunte durchgehen. Und dennoch liebte er Frauen. So sehr, daß es ihn sein Leben kosten sollte. Und zwar sehr bald schon.
„So …“, Makart stolzierte, fürderhin auf Spitzen, zu einer Sitzgruppe aus feuerrotem Plüsch, auf der sich diverse tunesische Teppiche räkelten, „Dann setzen wir uns doch, nicht wahr?“
Die drei folgten ihm. Schweigend. Während sie untereinander irritierte Blicke austauschten.
„Guth …“, Makart schien alles zu kommentieren, was er tat, „Sie drei sind hier herzlich willkommen. Sie müssen wissen, meine Karten-Legerin, ma diseuse de bonne fortune, hat mir gestern Abend gesagt, es kämen drei Männer zu mir …“
Die drei tauschten wieder (möglichst unauffällig) ihre irritierten Blicke untereinander aus.
„Oh ja! Glauben Sie ruhig, was Sie wollen – aber ich selbst glaube fest daran!“, verteidigte er sich mit nasaler Stimme, „Mein Médium sagte mir gestern auch, daß meine Zeit bald gekommen sei … Und die Ihres werthen Herrn Professors übrigens auch …“
Die drei wechselten nun einen schockierten Blick untereinander aus.
„Deshalb ist es unerläßlich, daß Sie drei nun von mir eingewiesen werden, vom Meister persönlich, und zwar in die wahre Kunst!“
Der Diener brachte den Kaffee auf einem reich verzierten, ägyptischen Silbertablett. Und schenkte den Herrschaften ein.
„Die wahre Kunst besteht nehmlich darin …“, fuhr er fort, „daß Sie den Menschen genau das geben, was jene wollen. Also was jene sehen wollen. Was jene empfinden wollen … Schon Shakespeare schrieb darüber! Wissen Sie … das Leben ist schwer genug – nicht für mich, Gott sei Dank! – aber für die meisten Menschen … Also darf man sie als Künstler nicht auch noch zusätzlich mit seinen eigenen Problemen und Befindlichkeiten belasten – sondern muß ihnen vielmehr Freude schenken. Und Hoffnung. Panem et circenses! Sie verstehen …“
Die drei nickten. Und nippten. Gleichzeitig.
„Nehmen wir nun mal …“, er tat so, als müsse er länger überlegen (und er spielte es sehr schlecht, offensichtlich sogar absichtlich), während er mit den abgespreizten Fingern seiner rechten Hand an seinem Kinn trommelte, „Nun … nehmen wir, der Einfachheit halber, diesen unglückseligen, vertrockneten Feuerbach!“, jetzt war die Katze also aus dem Sack, „Was für eine verdörrte und deprimierende Jammer-Partie! Und damit meine ich nun auch seine Bilder … Wenn man nehmlich vor ebenjenen steht, dann möchte man doch am liebsten gleich losheulen – nein, sich förmlich auf den Boden werfen und sich darauf wälzen, im Staube, wie diese Klage-Weiber, die ich in Nord-Africa mit eigenen Augen gesehen habe!“
Die drei wirkten jetzt gerade ziemlich irritiert.
„Oh ja!“, Makart breitete seine imposante Erscheinung nun über die ganze Couch aus, „Nehmen Sie doch nur einmal sein zutiefst deprimierendes Mach-Werk ‚Orpheus und Eurydike‘, das er nun schon vor exact zehn Jahren fabriciert hat … Was für tragische Figuren! Eurydike wird von einer garstigen Schlange gebißen, Blabla, muß hinab in die Thoten-Welt, Blabla, Orpheus findet sich mit dem tragischen Thode seiner Geliebten und Angebetheten natürlich nicht ab und steigt ebenfalls hinab, in die Unter-Welt, Blabla – Sie kennen die Geschichte ja sicherlich …“
Die drei nickten.
„Nun, dann folgt der Kuh-Handel mit Hades …“, fuhr Makart dennoch fort – und gähnte dabei demonstrativ, „Er dürfe sie zwar wieder mit nach oben nehmen, seine Angebethete – aber sich unter gar keinen Umständen nach ihr umwenden – und zwar während des gesamten Weges – denn sonst würde er sie für Immer und Ewig verlieren … Und was macht dieser Trottel? Natürlich dreht er sich um – und verliert sie somit auf Immer und Ewig … Das an sich ist ja schon schlimm genug und zutiefst deprimierend … Aber was macht dieser verkniffene Feuerbach? Er malt diese Scene auch noch justament in jenem Augenblicke, in dem beide fast schon oben, am Tages-Lichte, angelangt sind – denn man sieht dieses ja schließlich, von oben links, diffus hinein-scheinen – also wirklich in aller-letzter Secunde, vor der erlösenden Situation … Ich frage Sie, meine Herren, ist das nicht deprimierend?“
Alle drei nickten beflissen.
„Ja. Wenn das nicht tragisch und deprimierend ist, was dann? Und dann all diese grauen Farb-Thöne! Nein – um Farb-Thöne handelt es sich ja gar nicht, denn es ist schließlich bloß Grau! Ich frage Sie: Wer will so etwas schon in seinem Salon, in seinem Boudoir, an der Wand haben? Sogar der Hirschl, übrigens ein talentierter junger Bursche, der nun schon seit fünf Jahren hier bei uns an der Academie studiert, wirft dem Publicum in seinen zutiefst deprimierenden Grau-Bildern noch ab und an einen citronen-gelben oder pfefferminz-grünen Farb-Thon vor! Aber dieser Feuerbach …“, er schüttelte den Kopf, „Nein. Ich frage Sie erneut: Wer will so etwas schon sehen? Wer möchte mit so etwas belastet werden? Zumal daheim, in seinem Wohn-Zimmer, wo er diesen Graus – diesen grauen Graus! – tagtäglich vor der Nase hat!? Merken Sie sich also, meine Herren – und dies ist gleichsam Ihre erste Lection heute: Farbe! Und Licht! Aber vor allem Farbe! Je wilder, je beßer!“
Die drei nickten.
„Sie müssen wissen …“, Makart beugte sich vertraulich vor und es wirkte (bewußt) scheinheilig, „Dem armen Feuerbach ist ja in Rom die Frau weggelaufen – ausgerechnet mit einem feurigen Italiener ist sie durchgebrannt! – oder war’s ein Engländer? Völlig egal! – mit einem Kerl jedenfalls, zumal mit einem ganz gemeinen und gewöhnlichen Koch, oder Handwerker, oder so etwas in der Art, was weiß ich … Aber was rede ich da: Alle Frauen sind ihm stets davon-gelaufen! Davon-gerannt! Eben weil er so ein vertrockneter, puritanischer Griesgram ist!“
Die drei wagten es nicht, zu nicken.
„Nein …“, Makart schüttelte erneut den Kopf, während er sich lasziv wie eine Odaliske – oder vielmehr wie eine fette, verwöhnte Perserkatze – auf seinem feuerroten Albtraum aus Plüsch räkelte, „Feuer hat der keines, der Feuerbach! Man hätte ihn beßer Aschenbach nennen sollen. Oder Graubach … Oder Trockenbach … “
Gern hätten die drei gelacht. Aber sie trauten sich nicht. Denn schließlich handelte es sich hierbei ja um übelste und böseste Lästereien.
„Nehmen Sie nur einmal meine ‚Modernen Amouretten‘… Das wollen die Menschen sehen!“
„Ja, Meister, wenn Sie so freundlich wären, uns etwas mehr über Ihre Kunst zu erzählen!?“, hakte Matsch nun ein.
„Aber mit dem größten Vergnügen!“, Makart klatschte erneut in die Hände und der Diener trat heran, „Bitte, Joseph, die Mappe!“
„Nun denn …“, sagte er, nachdem diese gebracht und auf dem niedrigen Couchtisch vor den drei jungen Herren ausgebreitet worden war und er mit nonchalanter Geste – und mit spitzen Fingern – eines der Blätter umklappte, „Hier sehen Sie Studien und Photographien zu meinen früheren Werken, wie zum Beispiel eben zu den ‚Modernen Amouretten‘… Natürlich sind viele meiner älteren Werke längst nicht mehr hier im Atelier zugegen, sondern längst verkauft! Aber ich habe dies alles, wie Sie ja sehen können, sehr guth documentiert …“
„Dürfte ich?“, Franz Matsch griff nach der Photographie.
„Nur zu!“, Makart tat gelangweilt, aber man sah ihm die unbändige Freude über das brennende Interesse an seiner Kunst – sowie an seiner schrillen Persönlichkeit – förmlich an, „Leider Gottes sind ja all diese Photographien bloß in Schwarz-Weiß … Ich frage mich, wann wird endlich einmal etwas wirklich Nützliches erfunden werden – nehmlich die Farb-Photographie? Warum forscht man diesbezüglich nicht weitaus mehr? Diese Schwarz-Weiß-Bilder sind doch ein Jammer! Ein Trauerspiel! Fast schon … wie Feuerbachs Gribouillages!“, er lachte boshaft über seine eigene zynische Bemerkung, „Nein, meine ‚Modernen Amouretten‘, die Sie da in Händen halten – zumindest den traurigen Ab-Klatsch davon – die sind mit einem prächtigen, rein-güldenen Hinter-Grund ausgestattet! Wie in einem gothischen Kirchen-Werke! Und genau das war ja schließlich auch der Scandal daran! Erotik und Kirchen-Kunst!? Nein, das geht gar nicht!“, er lachte erneut (und wieder über sich selbst).
Gustav Klimt indessen, horchte auf.
„Im Sommer 1868, habe ich sie ja im Münchner Kunst-Verein präsentiert … Es handelt sich dabei, wie Sie ja sehen können, um ein monumentales Triptychon … Diese, damals sehr gewagte, Darstellung junger Liebes-Götter, hat mich schlagartig berühmt gemacht! Und genau jene heftige Ablehnung von Seiten der meisten Critiker war es auch, die meinen Namen in aller Munde brachte! Merken Sie sich also die zweite Lection für heute: Scandale können einem Künstler niemals schaden! Ganz im Gegentheil sogar …“
„Und wer war der Auftrag-Geber für dieses Werk?“, wagte nun auch Ernst Klimt eine Frage.
„Hm …“, Makart schüttelte den Kopf, „Nein, einen Auftrag-Geber gab es nicht! Aber um so beßer! Somit war ich nehmlich absolut frei bezüglich der Themen-Wahl – sowie beim Format – und eben auch beim Material, das ja, aufgrund der groß-zügigen Verwendung von Blatt-Gold, äußerst ungewöhnlich ist …“
„Und was soll so scandalös daran sein?“, tat nun auch endlich Gustav Klimt seinen Mund auf.
„Aber, aber, junger Mann!“, entgegnete Makart pikiert, „Sie sehen doch, daß auf meiner modernen Version dieses alten Themas nicht etwa harmlose und unschuldige Kinder mit Pfeil und Bogen abgebildet sind, sondern daß es bereits heranwachsende, pubertierende junge Mädchen sind, begleitet von lasterhaften, bocks-füßigen Faunen, welche in einem ausgelaßenen Triumph-Zuge durch diese traum-artige Scenerie ziehen!?“
Gustav Klimt beugte sich weiter vor, um die Details besser studieren zu können.
„Man warf mir daraufhin vor, meiner modernen Faßung ermangele es an jeglicher historischer oder mythologischer Vorlage – und angeblich sei es bloß eine Darstellung unverhüllter Décadence! Die Herren Kunst-Critiker behaupteten gar – und das noch viele Jahre späther! – daß eben dieses Werk die öffentliche Moral gefährde! Unter anderem schrieb man – Sie können es selbst lesen, denn ich habe all diese dummen Articel natürlich aufgehoben – ich citiere: ‚Schon diese Mädchen und Kinder trugen den Zug altkluger Koketterie und greisenhafter Lüsternheit an sich‘…“, er lachte, „‚Altkluge Koketterie‘! Und ‚greisenhafte Lüsternheit‘! Das ist doch wirklich köstlich, finden Sie nicht auch?“
Die drei konnten darin wirklich nichts Kokettes, Lüsternes – oder gar Schockierendes – erkennen. Aber sie sagten besser nichts.
„Noch im selben Jahre gingen meine ‚Modernen Amouretten‘ ja aus dem Münchner Kunst-Verein directement nach Wien weiter – und zwar zur Allgemeinen Deutschen Kunst-Ausstellung, im damals nagel-neuen Künstler-Hause, wo sie übrigens ein ganz genauso großes Aufsehen erregten … Tja, und dies war dann auch der Start-Schuß für meine Blitz-Carrière, hier in Wien …“
„Und es wurden auch einige Ihrer Werke auf der großen Welt-Ausstellung, vor sechs Jahren, gezeigt, nicht wahr?“, wagte Gustav Klimt erneut eine Frage an den Meister.
„Ganz richtig! Aber nicht etwa auf der Welt-Ausstellung, sondern im Rahmen der Wiener Welt-Ausstellung – aber immerhin! Und zwar in einem eigenen Saale im Künstler-Hause … Das war übrigens mein Monumental-Gemälde ‚Venedig huldigt Caterina Cornaro‘ – mit vier auf zehneinhalb Metern, mein größtes Gemälde überhaupt!“
„Zehneinhalb Meter!“, Ernst Klimt pfiff durch die Zähne.
„Jaja! Hier, hinter mir, sehen Sie ja meine Estrade – und dahinter befindet sich eine eigens für mich construierte Vorrichtung, die es mir ermöglicht, jedes noch so riesige Format, je nach Bedarf, bis hinunter in den Keller absenken zu können! Somit kann ich eben die benöthigte Höhe einstellen, die zu bearbeiten ist …“
Die drei erhoben sich spontan und schritten bis an den Rand dieser Hebebühne, während Makart liegen blieb und einige der Datteln naschte, welche der Kammerdiener inzwischen gebracht hatte.
„Ich selbst hatte im Rahmen der Welt-Ausstellung die Präsentation – nein, die Inscenierung! – dieses Gemäldes übernommen. Und es war wahrlich imposant …“, sagte er, wie beiläufig, während er an einer besonders fetten Dattel knabberte, „So hatte ich etwa die Oberlichte des Saales eigens mit einem schwarzen Tuche abdecken lassen – bis auf einen schmalen Spalt versteht sich, wodurch das Tages-Licht gezielt und äußerst effect-voll – nein: dramatisch ist das richtige Wort! – auf das riesenhafte Bildnis fiel. Und um die Sensation perfect zu machen, ließ ich das Bild von riesenhaften Palmen und anderen exotischen Gewächsen umstellen … Sie wissen ja vielleicht, daß ich die halbe Welt bereist habe! In Spanien war ich unter anderem, in Marocco auch – und sogar bis Aegypthen hinunter, an den Nil, wo ich derartige exotische Dinge mit eigenen Augen gesehen habe – und die mir seither eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration sind! Der arme Feuerbach hätte ebenfalls einmal rauskommen sollen, in den Orient – das hätte ihm ganz sicher die Augen geöffnet – nehmlich für die wahren Farben des Lebens – und ihn abgebracht, von seinem gräßlichen und geradezu unabläßigen Grau in Grau … Aber reden wir nicht mehr von diesem alten Griesgram! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja: Und obwohl ja dann nur wenige Tage nach der Eröffnung der Welt-Ausstellung der große Börsen-Krach erfolgte, war und blieb meine Inscenierung der ‚Caterina Cornaro‘ ein Triumph!“
„Verzeihen Sie die dumme Frage, Meister …“, wagte Ernst Klimt nun eine Wortmeldung, „Aber wer war diese … Caterina Cornaro?“
„Es gibt keine dummen Fragen, mein Guther!“, Makart spuckte einen Dattelkern auf das Silbertablett, „Nur dumme Antworten! Datteln?“
Die drei griffen nur allzu gerne zu. Schließlich hatten sie ja ihre Mittagspause für den Meister geopfert und noch nichts im Magen.
„Wir haben übrigens auch Feigen, Weintrauben und diese Dörr-Früchte hier, wie Sie sehen! Schließlich sind wir ja hier nicht bei armen Leuten!“, er sprach mit vollem Mund und schmunzelte dabei verschmitzt, „Also, greifen Sie nur zu!“
Das ließen die drei sich nicht zweimal sagen. Beziehungsweise. Dreimal.
„Nun denn …“, Makart räkelte sich auf seiner Ottomane, „Caterina Cornaro war die letzte Königin von Cypern. Und zwar von … warten Sie, hier steht es irgendwo, in meinen Aufzeichnungen … Nein? Nun, wenn ich mich recht entsinne, dann war es von 1472 bis 1489 … Aber immer diese dummen Zahlen! Die interessieren mich wirklich nicht! Also, meine Herren, hier nun die dritte Lection für heute: Keinen Menschen interessieren Zahlen und Facten! Außer man ist natürlich Mathematiker oder Physiker – aber, bei Gott, wer will das schon sein? Malen Sie einfach aus dem Herzen! Und falls es sich denn doch um ein historisches Sujet handeln sollte, dann machen Sie es einfach irgendwie paßend – und zwar nach Ihrer Façon! Dieser verdörrte Feuerbach …“, er hielt demonstrativ eine der Dörrfrüchte in die Höhe, „würde mir da natürlich vehement widersprechen! Aber was weiß der schon? Schließlich bin ich es ja, der mit diesen Sensations-Bildern den ganzen Erfolg einfährt – und nicht er!“
Der Vergleich Feuerbachs mit der Dörrpflaume war genauso witzig wie unverschämt. Die drei tauschten deshalb lediglich einen verstohlenen Blick aus, wagten es aber nicht zu lachen.
„Diese Cornaro entstammte übrigens einer alten venecianischen Patricier-Familie und man hatte sie im zarten Alter von nur vierzehn Jahren mit Jacob II. Lusignan, dem König von Cypern verheirathet … Wie gern hätte ich eben justament diesen Moment gemalt, aber das wäre denn wohl doch zu viel des Scandals gewesen!“, er kicherte, „Allerdings mußte sie nach dem baldigen Thode ihres Gemahls – für den man ihr natürlich die Schuld gab! – auf den Thron verzichten und Venedig übernahm daraufhin die Herrschaft, womit Cypern zur venezianischen Colonie wurde – und zwar bis zur Eroberung durch die Ottomanen im Jahre … 1571, wenn ich mich nicht irre … Hach, ich hatte dies alles so oft aufsagen müssen bei der Präsentation vor sechs Jahren, wie ein abgerichteter Papagei, sodaß all diese schrecklichen und ermüdenden Zahlen sich auf immer und ewig in meinem Hirne eingebrannt haben …“
„Ihr Gemälde ‚Der Einzug Carls V. in Antwerpen‘ haben wir übrigens im vergangenen Jahre alle drei im Künstler-Hause gesehen!“, sagte nun Gustav Klimt, während die anderen beiden lebhaft nickten, „Die gesamte Kunstgewerbe-Schule ist geschloßen hingegangen! Samt Professorenschaft! Sie haben ja bei uns im Hause viele Verehrer! Und ich muß gestehen, daß mich dieses Gemälde schwerst beeindruckt hat! Nicht allein wegen seiner schieren Größe – sondern vor allem wegen der …“
„Wegen der Ehren-Jungfrauen!“, Makart lachte glucksend, „Aber natürlich! Alle sind hingepilgert, um sie zu sehen! Und um sich anschließend die Mäuler darüber zu zerreißen! Schließlich tragen jene ja die Conterfeis bekannter Damen aus der hohen Wiener Gesellschaft – wie in allen meinen Historien-Bildern übrigens!“
„Die gehen auf Dürer zurück, nicht wahr?“, fragte Franz Matsch, „Zumindest hatte man uns dies so erklärt …“
„Das ist vollkommen richtig!“, Makart schleckte sich die Finger ab, an denen offensichtlich noch der Honig von den Datteln klebte, „Albrecht Dürer hat mich thatsächlich zu diesem Colossal-Gemälde inspiriert! Er hatte ja im Jahre 1520 den triumphalen Einzug Kaiser Carls V. von Österreich in Antwerpen mit eigenen Augen gesehen! Dieses Ereignis muß Dürer dermaßen beeindruckt haben, daß er es nicht nur en détail in seinem Reise-Diarium beschrieb, sondern auch in seinen diversen Correspondencen, wovon sich meines Wissens nach noch ein Brief, und zwar an einen gewißen Melanchthon, bis in die heutige Zeit erhalten hat. Jedenfalls habe ich dort drüben, in meiner Bibliothèque, ein Buch stehen, von Friedrich Campe, publiciert 1828, wo es ebenfalls herinnen steht … Und darin schreibt Dürer eben, dieser Fest-Zug sei von zahlreichen, nahezu völlig entblößten Ehren-Jungfrauen begleitet worden! Na, bumm! Das muß man sich einmal bildlich vorstellen, habe ich mir gedacht – wie all die blonden Nackedeien da durch die Gassen und Straßen Antwerpens spazieren – und habe gleich drauflos gemalt! Wobei ich diese halb-nackten Jungfrauen natürlich mehr nackt als halb-nackt darstellte – und kurzerhand zum Mittelpunkt meiner Composition machte! Mein Gott, ergab das einen Aufstand!“, er lachte, „Eigentlich hatte ich dies ja heuer im April, bei meinem Fest-Zuge zur Silbernen Hochzeit des Kaiser-Paares, ganz genauso machen wollen – deshalb übrigens auch der explicite Focus auf die Dürer-Zeit – aber man riet mir von allen Seiten vehement davon ab. Auch von aller-höchster Stelle übrigens …“
„Ich sehe schon, Sie programmieren Ihre Scandale regelrecht!“, bemerkte Gustav Klimt lächelnd.
„Ja, das ist wahr!“, Makart nickte, „Das war Ihre Lection Numero Zwei! Sie erinnern sich?“
Alle drei nickten.
„Nun … Das Gemälde producierte folglich einen der größten Kunst-Scandale in Wien überhaupt! Aber das war ja von meiner Seite absolut so geplant! Es war vollkommen calculiert, wie Sie schon sagten! Zumal ich ja den halb-nackten ‚Jung-Frauen‘ die Gesichts-Züge angesehener und allseits bekannter Damen aus der Wiener Groß-Bourgeoisie verlieh! Die Ausstellungs-Critiken waren dementsprechend übervoll von schlüpfrigen Anspielungen, anmaßenden Gerüchten, bösen Unterstellungen – und natürlich voll des empörten Protestes!“, er kicherte selbstzufrieden, „Und nun stellen Sie sich einmal vor: Bereits während der aller-ersten Ausstellungs-Tage, da kamen mehr als vierunddreißigtausend Besucher! Können Sie sich das vorstellen? Die Leute haben uns förmlich die Bude eingerannt! Diese Ausstellung ist somit der größte Publicums-Erfolg des Wiener Künstler-Hauses überhaupt! Zumindest in seiner gesamten bisherigen Geschichte! Und das soll nun mal einer übertreffen!“, er schaute plötzlich lauernd drein, „Vielleicht Feuerbach?“
Jetzt mußten die drei aber lachen. Und es war ihnen peinlich. (Makart hingegen genoß es sichtlich.)
„Und reich hat es mich auch gemacht, wie Sie sich sicherlich vorstellen können! Sie drei hatten ja im vergangenen Jahre sicherlich eine Ermäßigung erhalten, weil Sie mit der Schule kamen – aber all die anderen Herrschaften, die wurden so richtig zur Cassa gebethen! Die wurden so richtig geschröpft und gemolken, daß es eine wahre Freude war!“
Nun lachten die drei nicht mehr.
„Und dann ist das Gemälde ja gleich auf Reisen gegangen!“, Makart war eine der Weintrauben hinuntergefallen und unter seine Ottomane gerollt, was ihn aber nicht weiter zu stören schien, „Es trat einen wahrhaftigen Triumph-Zug durch beinahe sämtliche europäische Haupt- und Großstädte an – und das thut es immer noch, soweit ich weiß. Die Hamburger Kunst-Halle interessiert sich übrigens dafür! Alle interessieren sich dafür – aber ich verkaufe es natürlich nur an diejenige Institution, die mir am meisten dafür biethet! Ist doch wohl klar, oder? Und das ist, zur Zeit zumindest, nun mal Hamburg …“
Die drei nickten zwar, mißbilligten jedoch insgeheim diese offen zur Schau gestellte Prahlsucht des Meisters. Vor allem die beiden Klimt-Brüder schauten zunehmend schockiert drein. Andererseits machte ihnen diese Freak-Show auch Hoffnung. Denn sie sahen ja nun schließlich mit eigenen Augen, wozu es ein Maler bringen konnte!
„Möchten die Herren vielleicht sehen, woran ich gerade eben zur Zeit arbeite?“, fragte Makart plötzlich, wie beiläufig, während er sich eine weitere Dattel in den Mund schob.
„Oh ja! Das wäre wirklich das Größte für uns!“, rief Franz Matsch aus, während er sich zu seinen beiden Kommilitonen umwandte, „Nicht wahr?“
Die anderen beiden nickten.
„Nun denn!“, Makart erhob sich ächzend aus seiner bequemen Liegestellung und schritt (nein: stolzierte!) zur hinteren Atelierwand, wo fünf hohe und schmale Leinwände hinter großen, weißen Damast-Tüchern schemenhaft zu erkennen waren.
Die drei Studenten folgten ihm.
„Sie sind noch nicht fertig … Aber so können Sie wenigstens studieren, wie ich arbeite!“, sagte er und riß, mit einer theatralischen Geste, alle fünf Damast-Tücher von den tatsächlich unvollendeten Gemälden, „Und das ist ein Privileg, wie Sie sich sicherlich denken können …“
Die drei inspizierten nun im Detail die fünf gleich großen, sehr hohen und sehr schmalen Leinwände, auf denen fünf nackte Frauen zu sehen waren – beziehungsweise schien es sich, bei näherem Hinsehen, um nur eine einzige zu handeln, die eben aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wurde. Sehr nackt. Sehr. Sehr. Nackt. Und sehr erotisch.
„Jaja, das Weib …“, sagte Makart, während sein Blick glasig wurde, „Die ewige Quelle der Inspiration! Denn Inspiration ist Lust! Und Lust ist Inspiration! Sie müssen wissen, ich bin verheirathet – aber die Weiber, bei Gott, ich kann einfach nicht die Finger von ihnen lassen …“
Vor allem Gustav Klimt konnte dies nur allzu gut verstehen.
„Diese Gemälde stellen ‚Die fünf Sinne‘ dar, wie Sie wohl unschwer erkennen können …“, sagte Makart, der jedoch Desinteresse an seinen eigenen Werken heuchelte, „Wobei das ‚Gefühl‘ den Anfang macht und der ‚Geschmack‘ den point final meiner Composition hier bildet …“
„Es wirkt so … barock!“, sagte nun Franz Matsch.
„Aber ja! Natürlich!“, Makart hatte sich demonstrativ mit dem Rücken zu den fünf Leinwänden gestellt, „Es ist ja schließlich auch Barock! Die Nähe zu Rubens ist doch unverkennbar, nicht wahr?“
Alle drei nickten.
„Aber das ist sie ja schließlich in allen meinen Werken … Die Barock-Zeit ist mir nun einmal die aller-liebste Epoche!“, seine Straußenfeder wippte dazu im Takt, „Kein Wunder, daß Feuerbach und ich einander nicht warm werden können. Wir stehen schließlich auf exact entgegengesetzten Polen, auf ein und derselben Scala, nehmlich der historistischen …“
Die drei jungen Kunststudenten waren schwer beeindruckt. Das sah man ihnen an. Immer wieder näherten sie sich der Oberfläche der Leinwände an – so nah, daß ihre Nasenspitzen diese förmlich zu berühren schienen. Ja. Der Barock-Stil! Das war es! Und es war nicht nur Gustav Klimt. Der dies dachte.
„Eigentlich sollen es ja Wand-Decorationen für das Palais Helfert an der Wiener Ring-Straße werden – drüben, am Park-Ring №18, um genauer zu sein. Aber der Auftrag-Geber, Joseph Alexander Freiherr von Helfert, Dank Anoblissement, versteht sich, ein Geadelter …“, es klang abschätzig, verriet aber nur Makarts Neid, denn eine Nobilitierung von Seiten des Kaisers wäre für ihn das Allergrößte gewesen (denn damit wäre er auch offiziell ein Aristokrat geworden. Zwar kein Fürst. Aber immerhin ein Freiherr. Also Baron.), „… nun, jedenfalls hat sich dieser Helfert wohl mit seinem Palais leicht übernommen – denn es ist fünf-geschoßig, wie Sie vielleicht wissen … Hach, diese Neu-Reichen! Diese Empor-Kömmlinge! Diese Parvenus! Einfach schrecklich!“, machte er, mit angewiderter Miene, als ob er selbst keiner von ihnen sei, „Er druckst in letzter Zeit immer so sehr mit der Bezahlung herum … Vermuthlich werde ich auf diesen fünf Schinken hier ganz schön sitzenbleiben – ich befürchte dies bereits …“
„Ach, dafür wird sich doch wohl ganz sicher ein Käufer finden!“, sagte Gustav Klimt, der sich dessen wirklich sicher war.
„Nun ja, sicherlich haben Sie da Recht …“, heuchelte Makart Bescheidenheit (er wußte schließlich, daß halb Wien sich darum reißen würde), „Aber mit den Innenraum-Decorationen – vor allem jener der Privatiers – ist das immer so eine Sache … Ich kann Sie davor nur ausdrücklich warnen – Lection Numero Vier also! – denn diese Leute sind schwierig. Und heikel. Sehr heikel sogar …“
Die drei nickten. Sie wollten sich all diese Ratschläge gut merken. Schließlich mußte einer wie Makart ja wissen, wovon er sprach.
„Und geizig!“, Makarts Gesicht verzog sich, als habe er in eine unreife Citrone gebissen, „Sie wollen zwar vor ihren Freunderln damit prahlen, daß sie einen Makart daheim hängen haben – wollen aber nichts dafür bezahlen! Nein, also wirklich: Jeder große Künstler hat seinen Preis! Und damit wären wir dann auch schon bei Lection Numero Fünf: Verkaufen Sie sich niemals unter Ihrem Werth, meine Herren!“
Die drei nickten. Auch das wollten sie sich merken.
„Schauen Sie …“, Makart neigte den Kopf – und die Straußenfeder attackierte dabei plötzlich Franz Matsch, der allzu dicht neben ihm stand, „Es ist wie mit Schuhen, oder Gewand: Wenn Sie diese allzu billig anbiethen, dann denken die Leute automatisch, sie seien schlecht und demnach nichts werth … Sie können den Leuten hingegen eingekochte Hunds-Trümmerl vorsetzen – für einen geradezu hallucinatorischen Preis – und man wird sie Ihnen förmlich aus den Händen reißen! Sie verstehen mich?“
Es erfolgte synchrones Nicken. (Wobei Matsch diskret einen Schritt nach hinten auswich.)
„Ganz anders natürlich, wenn Sie Mäzene haben!“, die Straußenfeder ging nun auch auf Ernst Klimt los, „Und damit hätten wir auch schon Lection Numero Sechs in petto: Ein jeder Maler benöthigt reiche Mäzene! Nicht etwa bloß wohlhabende, sondern reiche! Je reicher, je beßer! Ohne einen Mäzen – oder gleich mehrere, am besten welche, die noch in Concurrence zueinander stehen! – geht es gar nicht. Ohne das, könnte ein Künstler nehmlich gar nicht erst überleben! Sie verstehen, was ich meine?“
Die drei nickten.
„Mein größter Mäzen ist der – übrigens aus einer griechischen Familie entstammende – Wiener Groß-Industrielle Baron Nicolaus von Dumba, von dem Sie ja sicherlich bereits gehört haben …“
Und wieder nickten alle drei. Schließlich kannte ihn ja ein jeder hier in Wien. Den Dumba. Der nicht nur ein Industrieller war. Sondern auch Politiker. Und der in ganz Wien vor allem als Kulturmäzen und als einer der wichtigsten Kunstsammler bekannt war. Viele der monumentalen Statuen auf der neuen Ringstraße (Schiller, Beethoven, Mozart, Schubert, etc.) waren schließlich seinem unermüdlichen Engagement sowie seiner legendären Spendierfreudigkeit zu verdanken. Zudem war er auch Vize-Präsident der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde. Und somit ebenfalls einer der größten Förderer des Wiener Musiklebens.
„Das Arbeits-Zimmer, welches ich für ihn ausgestattet habe, ein Eck-Zimmer im ersten Geschoße seines neuen Palais’ auf der Ring-Straße – Sie wissen schon: Dieser prächtige Bau im Wiener Neo-Renaissance-Stil am Park-Ring №4, also ganz in der Nähe des Palais’ Helfert – wird ja nurmehr ‚Dumba-Zimmer‘ genannt – respective nennt man es jetzt schon ‚Makart-Zimmer‘…“, er lächelte selbstzufrieden, „ist ja schließlich legendär. Jeder in Wien kennt es! Sie sollten es sich einmal ansehen!“
Das nahmen sich die drei vor. (Und wie es das Schicksal so oft will, sollte, just nach dem Tode Makarts, kein geringerer als Gustav Klimt die Ausstattungen im Dumba’schen Palais vollenden. Denn ausgerechnet er sollte den Auftrag zur Ausstattung des Musik-Salons erhalten.) (Wobei seine eigens dafür geschaffenen Wandbilder, wie so vieles, leider Gottes während des Zweiten Weltkriegs verbrennen sollten.)
„Ich habe eigens dafür, unter anderem, ein viereinhalb mal fünf Meter großes Colossal-Gemälde geschaffen, nehmlich für den Plafond, ganz nach den barocken Vorbildern eines Martino Altomonte oder eines Carlo Innocenzo Carlone, die Sie im Unteren, respective im Oberen Belvedere, als Fresco bewundern können. Und dies führt uns auch gerade-wegs zu Lection Numero Sieben: Studieren Sie die historischen Originale, wo immer und wann immer es nur geht!“
Die drei nickten. (Allmählich hätten sie sich dies alles wohl besser aufschreiben sollen.)
„Mit dieser Darstellung der ‚Allegorie der Musik‘, habe ich übrigens den Typus der barocken Plafond-Malerei für die Decorations-Kunst des Historismus wieder-entdeckt! So habe ich unter anderem auch die im barocken Trompe-l’œil so typischen, architectonischen Versatz-Stücke in die Winkel dieses Plafond-Gemäldes hinein-gemalt, wodurch diese eine optische Fort-Setzung der Bücher-Regale, respective ihrer Stützen, bilden – und zwar ins Unermeßliche … Die restliche Ausstattung und Möblierung dieses Arbeits-Zimmers, erfolgte übrigens in verbindlicher Abstimmung zu meinen Gemälden! Ich selbst habe dies schließlich alles vorgenommen – also die gesamte Einrichtung des Bureaus – unter anderem mit dem Plafond-Gemälde, ferner mit allegorischen Wand-Gemälden, kostbaren Holz-Vertäfelungen und reich verzierten Möbeln. Ein Gesamt-Kunstwerk! Vor sechs Jahren, war die Sache mit dem Arbeits-Zimmer dann schließlich abgeschloßen. Nach ganzen zwei Jahren. Aber es gibt dort im Palais noch einiges zu thun …“
Die drei tauschten untereinander interessierte Blicke aus.
„Jawohl, meine Herren!“, sagte Makart, dem offensichtlich nichts entging, „Das war thatsächlich als Ansporn für Sie gemeint! Denn ich selbst habe an weiteren Ausstattungs-Arbeiten wahrlich kein Interesse mehr. Es ist mir einfach viel zu mühsam … Womit wir auch gleich schon bei Lection Numero Acht wären: Nehmen Sie die Hilfe und Unterstützung von Maler-Collegen ruhig an! Jedoch versichere ich Ihnen: Das wird nicht allzu oft geschehen …“
Die drei nickten.
„Und dann wäre da noch dieses hier …“, Makart tänzelte auf Zehenspitzen zur linken Atelierwand herüber, wo sich offenbar ein gigantisches, gut fünf mal acht Meter großes Gemälde hinter einem weiteren Damast-Tuch verborgen befand. Wie ein Magier, riß er es in einer einzigen, effektvollen Geste hinunter. Was nun zum Vorschein kam, war geradewegs eine Explosion aus Licht und Farbe. Allem voran Türkis. Und Nilgrün. Zwischen tropischen Muscheln. Sogar einen Tiger gab es! Und natürlich auch hier wieder jede Menge nackter Leiber. Nackter Frauenleiber. Versteht sich.
„Da bleibt einem förmlich die Spucke weg!“, sagte Gustav Klimt, der seinen Mund tatsächlich nicht mehr zubekam.
„Jaja!“, sagte Makart, „‚Der Triumph-Zug der Ariadne‘! Eigentlich war das Ganze ja als Mittel-Theil des Vorhanges für die Comische Oper, also das neu eröffnete Ring-Theater, geplant – aber kurz vor dessen Eröffnung, vor nunmehr fünf Jahren, sagte man mir, es könne wohl kaum verwendet werden, aufgrund der zu starken Oberflächen-Spiegelung! Und nun frage ich Sie, meine Herren: Weshalb beauftragt man mich, dieses Werk ausgerechnet in Öl auszuführen, wenn es dann anschließend nicht genehm ist? Das hätte man doch wahrlich früher wissen müssen! Und hiermit kommen wir auch schon zu Lection Numero Neun, meine Herren: Sichern Sie sich stets guth ab, sobald es an öffentliche Aufträge geht! Lassen Sie sich alles doppelt und dreifach unterfertigen und zudem in schriftlicher Form bestätigen! Und selbst dann …“, er winkte angewidert ab, „Jetzt soll ich also einen neuen Vorhang anfertigen – und zwar in Wachs-Technik … Sie können sich mit Sicherheit vorstellen, wie sehr mich das freut, die ganze Chose noch einmal zu malen …“
„Meister, wir danken Ihnen wirklich sehr für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben – und das sogar, obwohl wir uns hier einfach so herein-geschummelt haben …“, sagte nun Franz Matsch, nachdem er einen kurzen, diskreten Blick auf seine Taschenuhr geworfen hatte, denn die Mittagsause war nun mehr als überzogen.
„Ach, nicht der Rede werth!“, Makart winkte ab, „Kommen Sie ruhig einmal wieder! Hier, in meinem Atelier, treffen Sie ja immerzu Menschen von aller-höchstem Interesse an! Zum Beispiel Arnold Böcklin, Franz von Lenbach, aber auch Wilhelm Leibl, et cetera. Dem Böcklin – sowie vielen anderen Künstlern auch – stelle ich ja regelmäßig mein Atelier zur Verfügung … Als Lenbach, Böcklin und ich übrigens vor rund sechs Jahren den Auftrag erhielten, ein hoch-officielles Portrait Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit anzufertigen, da haben wir uns sogar zu dritt dieses Atelier hier getheilt! Platz ist hier ja zu genüge!“, Makart wies mit vager, aber majestätischer Geste in den Raum um sie herum, „Als Lenbach aus München anreiste, um diesen Auftrag anzunehmen, da hatte er ja kein Atelier in Wien … Tja, so läuft das nun mal unter Freunden … Womit wir auch schon bei Lection Numero Zehn wären: Helfen Sie sich untereinander! Freundschaften unter Künstlern sind so wichtig wie selten!“
„Und stimmt es, Meister, daß sogar der große Componist Richard Wagner hier häufig zu Gast ist?“, wagte nun Ernst Klimt eine weitere Frage.
„Aber ja! Natürlich! Wie ich bereits sagte: Sie können hier stets Menschen von aller-höchstem Interesse antreffen! Wagner und ich sind übrigens die aller-besten Freunde!“, Makarts Brust schwoll sichtlich vor Stolz an, während seine Straußenfeder sich plötzlich steil aufrichtete, „Zudem bin ich ein glühender Anhänger der wagnerschen Musik! Ich hatte übrigens auch die Ur-Aufführung des gesamten ‚Ringes‘, unter der Leitung des Componisten höchst-selbst natürlich, im nagel-neuen Bayreuther Fest-Spielhaus gesehen – das war im August 1876, also erst vor drei Jahren! Ich hatte mich ja immer schon von Wagners Opern zu Gemälden und Adaptationen anregen lassen – und auch zu Innen-Ausstattungen – aber dieser ‚Ring des Nibelungen‘ – mein Gott, was für ein Werk! Quelle tour de force! Haben Sie es bereits auf der Bühne gesehen?“
Die drei nickten verneinend.
„Aber das müssen Sie!“, insistierte Makart – und seine Straußenfeder tat es ihm sogleich nach, „Das müssen Sie mir hoch und heilig versprechen! Nein, der Stoff der ‚Ring‘-Tetralogie übt eine geradezu magische Anziehungs-Kraft auf mich aus! Aber das thut er ja auf jeden zur Zeit! Die ganze Welt spricht nurmehr davon! Diese gewagte Verknüpfung von Helden-Epos und Götter-Mythos zu einem ungeheuren, geradezu sphärischen – ja, wahrlich meta-physischen, ur-sacralen – Drama! Es gibt überhaupt nichts Überwältigenderes auf der Bühne zu sehen, zur Zeit! Und das wird es sehr lange nicht, meine Herren! Erinnern Sie sich späther an meine Worte!“
„Wir werden es uns ansehen, Meister! Versprochen!“, sagte Franz Matsch artig.
„Bislang hatte ich noch keine wirkliche Zeit, mich auf der Leinwand mit dem ‚Ring des Nibelungen‘ auseinanderzusetzen – Sie wissen schon: all diese lästigen Aufträge, die man immerzu zu erfüllen hat! – aber das werde ich! Bei Gott, das werde ich! Das Concept für eine Raum-Ausstattung zu diesem Thema hätte ich sogar bereits! Es gibt da auch schon einige Studien – allerdings noch ganz im Anfangs-Stadium – sowohl für einen Gemälde-Cyclus, als auch zu einem Plafond-Gemälde … Nehmlich zur Ausstattung eines herrschaftlichen Musik-Salons. Wer weiß – vielleicht sogar für den Meister selbst? Unglaublich jedenfalls, wie viel Material und Potential für einen Maler dies alles birgt!“
„Und würde es Sie denn nicht interessieren, Bühnen-Bilder für Wagner zu entwerfen?“, fragte nun Gustav Klimt. Aus dem Bauch heraus. Und etwas naiv.
„Hm …“, Makarts Miene verriet, daß der junge Kunststudent da soeben einen wunden Punkt getroffen hatte, „Schon während meiner Studien-Zeit an der Münchener Academie, hatte ich ja alle Bühnen-Ausstattungen zu Wagners Opern mit brennendem Interesse mitverfolgt! Kennengelernt habe ich ihn – und seine Gattin, Cosima – jedoch erst hier, in Wien. Das war …“, er überlegte kurz, „vor vier Jahren – also Anno 1875 – nur ein Jahr vor der Ur-Aufführung des ‚Rings‘ in Bayreuth … Ich gab damals ein großes Fest zu Ehren des Componisten – natürlich hier, in meinem Atelier … Nicht ganz uneigennützig, muß ich gestehen, denn natürlich hatte ich brennendes Interesse daran, Bühnen-Ausstattungen für ihn zu fertigen! Und Wagner hat es thatsächlich in Erwägung gezogen, die Bühnen-Bilder für seine Tetralogie bei mir in Auftrag zu geben! Wir sprachen lange darüber – und ich machte ihm auch einige Entwürfe … Dennoch sollte sich dieser Traum leider nicht für mich erfüllen – bislang zumindest … Und ich muß gestehen, es schmerzt mich bis heute, daß Wagner mich damals nicht die Bühnen-Bilder für seinen ‚Ring‘ entwerfen ließ … Sie wissen schon, der Wagner hat einen ganz eigenen Kopf – und in der Ausstattung ist er so ein verdammter, stur-köpfiger Purist! Meine Entwürfe waren ihm offensichtlich zu … nun, sagen wir … zu opulent – Sie wissen ja, daß er Prunk und Pomp stets ablehnt. Vor allem in der Theater-Architectur … Das ist übrigens auch der Grund für das Zerwürfnis mit Gottfried Semper …“
„Ist es richtig, daß die beiden sich hier bei Ihnen – in diesem Atelier hier – wieder ausgesöhnt haben?“, hakte Ernst Klimt nach.
„Aber ja! Natürlich! Und zwar einzig und allein Dank meines Betreibens!“, Makart wechselte nun gekonnt die Pose, „Doch dazu müssen Sie wissen, daß dieser Wagner thatsächlich ein elendiger Stur-Kopf ist! Alles, was auch nur im Ansatze festlich oder gar lebens-froh wirken könnte, wird bei ihm von vornherein verbannt! Nun … in diesem Punkte zumindest, ist er thatsächlich ein wenig wie dieser Feuerbach … Die Deutschen sind schon ein wenig … nun, sagen wir … trocken – zumal im Vergleich mit uns Österreichern … Wilhelm Leibl ist es ja im Grunde auch … Nein, es gibt zur Zeit wirklich viele Genies unter den Deutschen, aber alle sind sie so verdammt … verkniffen! Und machen alle so auf ernsthaft, auf seriös! Vor allem lustig und locker darf’s bei ihnen nicht sein! Oder gar bunt! Nein, immer nur tief-sinnig, und grau, und ernst, und düster … Das wird wohl das Protestantische in ihnen sein … Das bekommt man niemals wieder heraus …“, die Straußenfeder gab ihm diesbezüglich völlig recht, „Der Semper plante ja ein riesiges Fest-Spielhaus in München, das eigens für die Ur-Aufführung der ‚Ring‘-Tetralogie errichtet werden sollte – so ein ganz prächtiger Kasten eben, typisch Semper, mit einem convexen Mittel-Bau, flankiert von zwei lang-gestreckten Seiten-Flügeln … Bei der Innenraum-Gestaltung hatte Wagner ihn schon weichgeklopft, weshalb diese auch schon fast genauso schlicht angelegt war, wie sie es jetzt, auf dem Grünen Hügel, in Bayreuth, ist …“
„Und warum kam es dann schließlich nicht zu diesem Fest-Spielhaus-Project in München?“, hakte Ernst Klimt nach.
„Nun …“, Makart blies die Feder aus seinem Gesicht, „Wie gesagt: Der Meister ist recht … nun, sagen wir: schwierig … Er hat ja München bereits 1865 verlassen. Da gab es Ärger wegen der horrenden Kosten, die er verursachte – und welche der bayuwarische König, Ludwig II., zwar gerne aufbrachte, er ist ja ebenfalls ein glühender Wagnerianer! – aber die klein-geistige Regierung … Sie wissen schon: Immer dieselbe Geschichte! Functionäre!“, er schüttelte angewidert den Kopf, „Da muß man sich wirklich fragen, wozu Staats-Beamte überhaupt guth sein sollen! Denn sie haben wirklich keine Ahnung. Und zwar von gar nichts! Erst recht nicht von der Kunst … Und das macht auch schon Lection Elf: Legen Sie sich als Künstler – oder auch als jedwelcher Mensch – niemals mit einem Staats-Beamten an! Und je niederer ihr Stand, desto gemeiner! Merken Sie sich das!“
Die drei nickten.
„Nun …“, fuhr Makart fort, „Nicht nur, daß er, wie bereits gesagt, München im Jahre 1865 verließ – auch wurde dieses Project wohl auch deshalb aufgegeben, weil Wagner sich zunehmend davon distancierte … Ihm sei das Vorhaben zu monumental geworden – zu pompö(ö)s – und es habe sich immer weiter von seinen Ideal-Vorstellungen von Schlichtheit und Reinheit zu entfernen gedroht. Tz! Als ob sein ‚Ring‘ un-monumental sei! Also wirklich …“, die Straußenfeder verneinte dies vehement, „Nun, genau dies war auch schließlich das Haupt-Argument vom Semper, der ja, zum Beispiel während der Proben, schon so manches aus dem ‚Ring‘ vernommen hatte! Er sagte dann zu Wagner, so ein Monumental-Werk brauche – nein: schreie förmlich – nach einem monumentalen Bau-Werke. Aber mit dem Meister war diesbezüglich nicht zu verhandeln. Und so kam es eben zum Krach. Zunächst zum Disput – und schließlich mied man sich nurmehr, auch in der Öffentlichkeit, was natürlich hoch-noth-peinlich war für alle Betheiligten … Tja, und bei meinem Atelier-Fest vor vier Jahren, also 1875 – officiell ausgerichtet natürlich zu Ehren von Richard Wagner, denn sonst wäre er ja schließlich nicht gekommen – da lud ich eben auch Semper ein … Tja, und der Rest ist längst Geschichte … Und somit wären wir auch schon bei Lection Numero Zwölf angekommen – der letzten für heute, denn aller guthen Dinge sind nun mal zwölf – nehmlich, daß man sich auch mit Künstlern anderer Sparten und Gattungen zusammenthun soll. Also mit Musikern, Literaten, Bild-Hauern, et cetera, zwecks gemeinsamen Gedanken-Austausches. Denn dies ist äußerst inspirierend, wie Sie noch sehen werden! So! Und jetzt bitte ich Sie, mich zu entschuldigen, der Schindler hat sich angemeldet und müßte jede Secunde zur Thüre herein-spazieren!“
„Selbstverständlich, Meister!“, sagte Franz Matsch, während er demonstrativ auf seine Taschenuhr sah, „Wir müssen auch dringendst wieder in die Schule! Meister Laufberger erwartet uns sicherlich bereits!“
„Ach ja, der Laufberger …“, Makart lächelte wohlwollend, „Grüßen Sie ihn bitte recht lieb von mir!“
Und da ging auch schon die Tür auf. Und Emil Jakob Schindler trat ein. Der große Landschaftsmaler. Nein. Der größte Landschaftsmaler. In Wien. Ebenfalls eine lebende Legende. Und ebenfalls ein Held für die jungen Kunststudenten. Und so lernte Gustav Klimt also auch ihn kennen. In Makarts Atelier. Mehr. Oder weniger. Durch Zufall. Eine interessante Verquickung. Und Verstrickung. Denn dessen Tochter kam just heuer zur Welt. Alma. Alma Schindler. Allerdings besser bekannt als Alma Mahler. Beziehungsweise. Alma Mahler-Werfel. Die große Muse. Und Femme Fatale. Der Belle Epoque. Des Fin de Siècle. Die Frau mit den tausend Gesichtern. Und mit den tausend Namen. Und mit den tausend Liebhabern.
Nachdem die drei Burschen das Atelier Makarts wieder verlassen hatten, mußten sie zunächst losprusten. Vor Lachen. Viel. Zu viel. Hatte sich während dieser knappen Stunde aufgestaut. In ihren Zwerchfellen. Beziehungsweise. In ihren Lachmuskeln. Welche das Lachen die ganze Zeit über hatten zurückhalten müssen. Die waren nun gespannt. Nein. Überspannt. Wie Bogensaiten.
„Mann, ist der durchgeknallt!“, sagte Ernst kopfschüttelnd. Und alle lachten. (Und wenige Jahre später nur. Sollte ganz Wien über ihn lachen.)
„Der ist ja total verrückt, dieser Kerl!“, prustete Gustav heraus.
„Ja! Und wie der sich aufführt!“, Ernst lag fast auf dem Boden vor Lachen, wobei er die nasale Stimme Makarts imitierte: „Ist es den Herrschaften denn geneeeeehm? Ein paar Datteln?“
„Der wühlt doch mit beiden Händen förmlich im Gold!“, sagte Franz, während er mit seiner rechten Hand die immerzu wippende Straußenfeder vor seinen Augen imitierte.
„Nein, was für ein verrückter Hund!“, Gustav Klimt konnte gar nicht glauben, daß jemand überhaupt derart exaltiert und exzentrisch sein konnte. Er verachtete Makarts Unbescheidenheit. Aber er bewunderte dessen Ruhm. So weit konnte man es also bringen. Als Künstler. Das wollte er sich merken. Das war die größte Lektion für ihn gewesen. An diesem heutigen Tag. Der denkwürdig war.