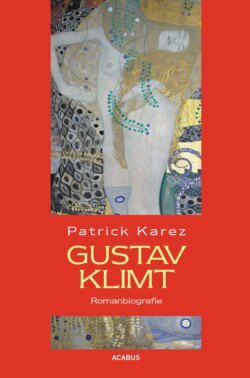Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15
ОглавлениеIm darauffolgenden Jahr verstarb, völlig unerwartet, ihr Professor und Mentor. Laufberger. War gerade einmal zweiundfünfzig Jahre alt geworden. Wobei man hier wirklich nicht von alt sprechen kann. Bald schon begann an der Schule ein seltsames Gerücht umzugehen. Welches sich vor allem in den darauffolgenden Jahren noch verstärken sollte. Nämlich. Daß hier keiner seinen Fünfziger überlebte. Ein Fluch vielleicht. Jedenfalls war es wirklich unheimlich. Denn nach dem Tode Laufbergers, wurde Julius Victor Berger ihr neuer Lehrer. Und auch dieser verstarb im Jahre 1902 plötzlich. Und völlig unerwartet. Und dreimal darf man raten. Wie alt er wurde. Exakt zweiundfünfzig. Aber auch ihr Lehrer Carl Hrachowina. Wurde nur einundfünfzig. Und Ludwig Minnigerode. Wurde dreiundfünfzig. Was zusammengezählt wieder ein Mittel ergab. Nämlich von zweiundfünfzig. (Wie gesagt. Der Tod war scheinbar nichts weiter. Als ein phantasieloser Beamter. Ein spröder Buchhalter.)
Auch auf Ernst und Gustav Klimt sollte dies zutreffen. Keiner von beiden. Sollte seine Fünfziger überleben. Die Fama, die bereits nach dem Tode Laufbergers in der Schule umging, sollte sich in den Jahren 1896 und 1900, beziehungsweise 1902, also noch verstärken. Es war ein Mythos. Für den vor allem Studenten sehr empfänglich sind. Junge Menschen im Allgemeinen. Vor allem Künstler. Sind sehr abergläubisch. Zudem wechselten sie ja nun. Von einem Professor. Zum anderen. Nämlich. Von Ferdinand Julius Laufberger. Zu Julius Victor Berger. Von Laufberger. Zu Berger. Ausgerechnet! (Zudem hieß Laufberger ja mit zweitem Namen Julius. Und Berger mit erstem.) Seltsam nicht? Dachte Klimt. Und er sagte es auch. Nämlich zu seinem Bruder.
Laufberger. Lauf.berger. Lauf. Berger. Berger.
Nach dem Tode Laufbergers änderte sich für die drei nicht allzuviel. Denn Berger, ihr neuer Lehrer für Dekorative Malerei, förderte sie ebenfalls. Und zwar mit derselben Hingabe und Überzeugung wie Laufberger. Auch ihm war nicht nur die künstlerische Zukunft seiner Zöglinge wichtig. Sondern auch deren wirtschaftliche. Da Julius Victor Berger ebenfalls der Riege der führenden Wiener Ringstraßenmaler angehörte, erhielt er zahlreiche Ausstattungsaufträge privater Bauherren. Die er natürlich an seine Studenten weitergeben konnte. Zudem übernahm er nun auch noch die unvollendeten Arbeiten seines Vorgängers. Und so sollte er seinen drei Protegés auch bald schon zu einem neuen Auftrag verhelfen. Zudem war Berger ein glühender Bewunderer Hans Makarts, weshalb er dafür sorgte, daß die drei Studenten das Atelier des Malerfürsten in der Gußhausstraße noch einige weitere Male besuchen sollten. Während der letzten beiden Studienjahre, unter der Leitung Bergers, begannen sie auch konsequent damit, sich mit der Malerei und den Stilprinzipien Makarts näher auseinanderzusetzen und diese in ihr eigenes Schaffen zu integrieren.
„Meine Herren!“, sagte Berger, nachdem er die drei in sein Arbeits-Zimmer, das vormalige Büro Laufbergers, zitiert hatte, „Wir alle sind über den plötzlichen und unerwarteten Thodt unseres allseits sehr geschätzten Professor Laufberger sehr bestürzt. Aber es muß weitergehen. Das Leben geht weiter, und die Arbeit geht weiter … Ich habe gehört, daß Sie drei sich bereits zu einer Atelier-Gemeinschaft zusammen-geschloßen haben … Nun, dies ist sehr guth und lobenswerth – und ich würde Ihnen dringend empfehlen, dies nun auch officiell zu machen. Sie werden ja nurmehr zwei Jahre an dieser Schule hier studieren – und danach wird es schwieriger sein, an Aufträge zu gelangen. Mit einer officiellen Gründung einer Unternehmung, wären Sie auch in Zukunft wesentlich beßer aufgestellt, als jeder für sich allein. Zumal Sie ja perfect zusammen-spielen, nicht wahr?“
Die drei nickten.
„Ihnen wären dann öffentliche Aufträge sicher, da Sie diese wesentlich schneller ausführen könnten als ein Künstler allein … Zumal sind Sie ja erst …“, er sah kurz in seine Dokumentenmappe, „um die neunzehn Jahre alt – also noch nicht voll-jährig. Da sollten Sie wirklich Sorge dafür tragen, daß Ihre Unternehmung auch vor dem Gesetze hieb- und stichfest wird …“
„Wir nennen uns bereits Compagnie …“, sagte Franz Matsch.
„Guth! Dann machen Sie es officiell! Lassen Sie sich Ihre Unternehmung unter dem Namen ‚Künstler-Compagnie‘ eintragen – denn ‚Compagnie‘ allein, sagt nicht allzu viel aus – das könnte ja auch eine Schuh-Werkstätte sein – und das Kind wäre somit in trockenen Tüchern … Das wäre dann Punkt Eins … Punkt Zwei wäre, daß sich für Sie wohl einiges verändern wird, unter meiner Leitung, denn ich bin ein großer Anhänger Makarts, wie Sie vielleicht bereits gehört haben … Makart ist das Um und Auf. Wer Makart nicht kennt, der kann in Wien kein ernstzunehmender Künstler sein. Es ist also außerordentlich wichtig, daß Sie beim Meister persönlich vorstellig werden, damit Sie mit eigenen Augen sehen können, wie dieser so arbeitet …“
„Das haben wir bereits!“, sagte nun Gustav Klimt, nicht ohne Stolz, „Und zwar bereits vor zwei Jahren!“
„Ach, wirklich?“, Berger schien darüber erstaunt, „Hat Professor Laufberger diesen Contact hergestellt?“
„Nein, wir sind von ganz allein hingegangen!“, sagte nun Ernst Klimt.
„Wir haben den Meister förmlich in seinem Atelier überfallen!“, fügte sein Bruder lächelnd hinzu.
„Aha! Hört, hört …“, Berger nickte anerkennend, „Sie drei wissen ja scheinbar ganz genau, wohin Sie wollen! Das gefällt mir … Wissen Sie, als Künstler – vor allem als Künstler – muß man Biß haben! Anders schafft man es nicht. Da geht man dann einfach unter … Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele meiner Collegen – allesamt hoch-begabte Menschen! – einfach so unter die Räder gekommen sind, weil sie eben nicht in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen … In wirtschaftlicher Hinsicht, meine ich damit… Aber nicht nur das… Von daher ist es guth und höchst lobenswerth, daß Sie sich zu einem Trio zusammen-geschloßen haben. So kann man nun mal beßer füreinander Sorge tragen …“
Die drei nickten zustimmend.
„So, nun aber zu Punkt Drei!“, Berger war offensichtlich organisierter und deshalb vermutlich auch etwas pedantischer als sein Vorgänger, „Kommen wir zu Ihrem ersten Auftrage für mich! Nehmlich der Ausführung meiner Entwürfe für das Palais Zierer. Es wurde im vergangenen Jahre, also Anno 1880, vom Architecten Gustav Korompay für den Bankier Wilhelm Zierer errichtet – und zwar im noblen Belvedere-Viertel … Jetzt geht es also um die Ausstattung desselben … Genauer gesagt, handelt es sich um vier Eck-Medaillons für den Vor-Raum des Ober-Geschoßes, also das Foyer, sowie um fünf Gemälde für den Kleinen Salon …“
„Soll es wieder etwas Neu-Barockes sein?“, fragte Franz Matsch. Schon ganz der professionelle Unternehmer.
„Das ist richtig!“, Professor Berger entging dieses Selbstbewußtsein nicht, das ungewöhnlich war – zumal für einen jungen Studenten, der noch nicht einmal gänzlich volljährig war, „Putti mit Blumen, et cetera, et cetera … Sie kennen dieses Procedere ja schon, nicht wahr?“
„Jawohl!“, entgegneten nun alle drei. Wie aus einem Munde.
„Schauen Sie …“, Berger holte eine große Mappe hervor, die neben der Schreibtischplatte angelehnt gewesen war und zog erstaunlich präzise aquarellierte Skizzen daraus hervor. Die Befürchtung, es mit einem Pedanten zu tun zu haben, bestärkte sich nun für die drei Studenten, denn ganz so genau und detailversessen, zumal bei bloßen Skizzen, hatten bislang weder Laufberger noch Rieser gearbeitet. Zudem legte Berger damit die grundsätzliche dekorative Richtung fest. Den Studenten würde also kaum Freiheit bleiben, ihre eigenen Ideen einzubringen. Es wurde tatsächlich Zeit, eine eigene Unternehmung zu gründen. Dachten sie. Insgeheim. Zumal sie später auch feststellen sollten, daß Professor Berger die endgültige Ausführung seiner Skizzen, also als fertiges Werk, zum größten Teil seine Studenten besorgen ließ. Aber hinterher den ganzen Erfolg dafür einstrich. Da war Laufberger anders gewesen. Denn es war ihm stets ein Bedürfnis gewesen, ebenfalls mit Hand anzulegen. Wie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Bei der Ausführung seiner Sgraffiti. Im Kunsthistorischen Hofmuseum. Da war Laufberger immer dabei gewesen. Und hatte seinen Studenten genau gezeigt, wie die Dinge am besten zu bewerkstelligen sind. Berger hingegen, setzte nun alles technische und künstlerische Wissen seiner Studenten voraus. Und hielt sich bei der Ausführung eher zurück. Aber das hatte wiederum auch seinen Vorteil. Denn somit fühlten die Studenten sich nicht mehr wie Studenten. Sondern wie bereits fertige Künstler.
„Sie sehen hier die einzelnen Decken-Spiegel … Der Auftrag-Geber wünscht eben das volle neu-barocke Programm: munter herum-tollende Putti, Blumen-Bouquets sowie Blumen-Gemälde und üppigen Blumen-Schmuck … Da wir ja hier in der Schule nicht so sehr auf Blumen- und Landschafts-Darstellungen specialisiert sind, werde ich neben Ihnen dreien auch die Künstlerin Tina Blau heranziehen, die sich ja auf Landschaft specialisiert hat, wie Sie vielleicht wissen …“
Die drei horchten auf. Oha! Eine Künstlerin! Das war sehr selten. In diesen Tagen. Und Tina Blau hatte sich tatsächlich bereits einen Namen in Wien gemacht. Und nicht nur dort.
„Zudem fordert der Auftrag-Geber detaillierte Aquarell-Studien – aber das kennen Sie ja bereits, von Ihrem Auftrage im Palais Sturany, im vergangenen Jahre, nicht wahr?“
Die drei nickten bejahend.
„Madame Blau wird sich also um die Blumen-Bouquets, die Blumen-Gemälde und den üppigen Blumen-Schmuck kümmern – Sie hingegen werden sich auf die Plafond-Bilder im Vestibül concentrieren … Wie bereits im Palais Sturany, werden Sie diese bitte in Öl ausführen, auf Leinwand – und das Ganze wird dann anschließend am Plafond cachiert … Verwenden Sie bitte diese von mir scizzierte Abwicklung des Decken-Spiegels – Sie sehen ja, wie detailliert er ist … Der Auftrag-Geber entscheidet schließlich, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen und welche nicht … Ist so weit alles klar? Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?“
Die gab es nicht. Die drei wußten genau, was zu tun war. Im Grunde war es das gleiche Prozedere wie bereits im Vorjahr, im Palais Sturany. Diesmal jedoch, bestand der jüngste von ihnen, Ernst Klimt, darauf zwei der vier Arbeiten übernehmen zu dürfen, weil ja im Palais Sturany zwei der vier Deckengemälde von Franz Matsch ausgeführt worden waren und die beiden Klimt-Brüder jeweils nur eines gemalt hatten. Es mußte schließlich immer gerecht zugehen, die Arbeit mußte immer demokratisch aufgeteilt werden, schließlich ging es ja hierbei nicht nur um Ansehen und Berufserfahrung, sondern auch um bare Münze. Doch auch hier, zeigte sich schon sehr bald, daß Gustav Klimt am unkonventionellsten und eigenständigsten von ihnen dreien arbeitete. Der von ihm ausgeführte, scheinbar aus dem Himmel herabstürzende Putto, war um einiges lebendiger und bewegter gearbeitet als diejenigen seiner Kollegen, die doch, trotz allen handwerklichen Könnens, insgesamt etwas starrer und ungelenker wirkten. Gustav Klimt hatte, bereits zu diesem Zeitpunkt, nicht nur den barocken Geist am konsequentesten verinnerlicht und in sein Schaffen eingebunden, sondern auch die Stilprinzipien Makarts. (Was ja mehr oder weniger dasselbe war.)
Noch in diesem Jahre brachte Professor Berger die drei Studenten mit Tina Blau zusammen. Denn schließlich mußten ihre aller Arbeiten gut aufeinander abgestimmt werden. Damit es eben kein heilloses Durcheinander gab. Später. Im Palais Zierer. An der Decke. Zu diesem Zwecke. Arrangierte er ein Treffen. Und zwar in Tina Blaus Atelier. Und tatsächlich. War sie eine begnadete Landschaftsmalerin. Vor allem Gustav Klimt fand dies. Und war von ihr gleich schwer beeindruckt. Nicht nur. Daß sie eine Frau war. Sondern. Sie malte auch. Sie war Künstlerin. Und das gab es zu dieser Zeit noch kaum. Eigentlich gar nicht.
„Meine Herren …“, Professor Berger war als erster eingetreten, „Wenn ich vorstellen dürfte: Madame Blau!“
Alle drei traten hintereinander ein und gaben der Malerin artig die Hand. Sie wirkten etwas irritiert, denn es war, wie gesagt, das erste Mal, daß sie das Atelier eines weiblichen Malers betraten. Also einer Malerin. Die zudem offiziell anerkannt war. Wie man ja sehen konnte. (Sie trug übrigens ein schlichtes, aber elegantes, weißes Kleid – und Gustav Klimt versuchte zwangsläufig, sie sich in ihrem Malerkittel vorzustellen – schließlich würde sie ja wohl kaum in einem weißen Chiffonkleid malen! Während er daran dachte, schoß ihm unwillkürlich das Blut in die Wangen, denn bereits im nächsten, unmittelbar darauf folgenden Gedankenschritt, hatte er sich auszumalen versucht, was sie wohl unter ihrem Malerkittel trüge. Und das. Obwohl sie ganze siebzehn Jahre älter war als er.)
„Herzlich willkommen!“, sagte sie lächelnd und sogleich waren alle drei Studenten regelrecht von ihr verzaubert, „Trethen Sie ein!“
„Dann zeigen Sie uns einmal, was Sie schon fertig haben!“, kam Professor Berger, ganz in seiner organisierten und effizienten Art, gleich zum Punkt.
„Nun … Zunächst trinken wir doch wohl ein Täßchen Tee, nicht wahr? Oder darf es vielleicht ein Cafétschi sein, die Herren?“, Frau Blau war erstaunlich selbstbewußt für eine Frau.
„Sie können derweil die Arbeiten ansehen!“, sagte sie, während sie im Nebenraum verschwand, „Die Sachen für den Zierer stehen dort vorn am Fenster!“
Professor Berger und seine drei Protegés schritten also auf das Fenster zu und hoben die Leinwände vom Boden auf, um sie besser betrachten zu können. Und wahrlich. Was für ein Freudenfest! Diese Farben! Diese Lebendigkeit! Als ob man die Blumen tatsächlich anfassen, sie aus dem Bilde herausnehmen, und an ihnen riechen könnte! Die drei Studenten meinten tatsächlich, einen zarten Blumenduft wahrzunehmen, aber dieser entströmte wohl vermutlich eher der Malerin selbst.
„Ganz bemerkenswerth!“, sagte Berger lobend, als die Künstlerin, ein großes Silbertablett vor sich hertragend, den Raum wieder betrat.
„Vielen Dank, Herr Professor! Sehr gnädig!“, sagte sie, während sie sich leicht verneigte.
Den dreien entging dabei nicht der leise Anflug von Ironie. Denn natürlich hatte sie es gar nicht nötig, von ihm gelobt zu werden.
„Ja! Ihre Arbeiten sind wirklich ganz wundervoll!“, sagte nun auch Franz Matsch, „Die werden ganz sicher sehr guth mit unseren eigenen Arbeiten zusammen-paßen!“
„Wir sind ja damit noch längst nicht fertig …“, fügte nun Ernst Klimt hinzu, „sondern eher im Anfangs-Stadium – aber umso beßer, denn nun können wir ja Ihre Farb-Werthe notieren und diese dann in unseren eigenen Gemälden anbringen!“
„Ach so? Meine Farb-Werthe?“, Tina Blau schaute verdutzt drein, verriet aber durch ihr Lächeln, daß sie Ernst Klimt nur aufziehen wollte, „Sie meinen also: Grün, Grün – und nochmals Grün!? Seit wann gibt es denn im Himmel Botanik und Gestrüpp? Sie drei sollen doch schwebende Putti malen, nicht wahr?“
Die vier Herren lachten über diesen frechen Witz und nippten dabei völlig synchron an ihren Tee- beziehungsweise Kaffeetassen. Ihre Nervosität war ihnen allen vieren anzumerken. Schließlich begegnete man nicht alle Tage einer derart selbstbewußten Frau. Zumal in diesen Tagen.
„Diese Arbeiten für den Zierer sind doch so ganz und gar nicht interessant!“, sagte sie, während sie sich plötzlich erhob und zur gegenüberliegenden Atelierwand schritt, wo sich eine großformatige Leinwand unter einem weißen Laken zu verbergen schien, „Immer diese ewig-faden, neu-barocken Geschichten hier in Wien! Das ist doch schon längst passé, längst démodé!“
An Professor Bergers Miene konnte man zweifelsohne erkennen, daß er ihre Meinung ganz und gar nicht teilte. Aber er schwieg. Aus Höflichkeit. Was wußte die schon? Dachte er. Insgeheim. Das ist doch nur ein Weib. Ein verrücktes obendrein. Und eine akademische Ausbildung hatte sie sowieso nicht genossen. (Weil es Frauen zu dieser Zeit noch gänzlich untersagt war.) Die drei Studenten erhoben sich jedoch – und zwar automatisch – nachdem die Künstlerin das Tuch von der Staffelei gezogen hatte. Sie standen also da. Wie angewurzelt. Und waren fassungslos. Sprachlos. Stand ihnen der Mund weit offen. (Bei Professor Berger tat er es auch. Aber aus einem ganz anderen Grunde.)
„Et voilà!“, sagte sie, während sie eine kokette Halbdrehung zu den Herren hin vollführte, „Un air de Paris! Ein Hauch von Paris!“
Das, was sich dort (noch nicht gänzlich vollendet) auf der gesamten Leinwand ausbreitete (und heute im Wiener Belvedere zu sehen ist), stellte zweifelsohne den Prater dar. Und dann doch wieder nicht. Denn alles Pflanzen- und Blattwerk – nein alles! – schien in einzelne Tupfen aufgelöst. Und das war es auch. Das konnten sie nun, während sie langsam an das Bild heranschritten, immer deutlicher erkennen. Und als sie schließlich ganz nah davor standen, da konnte man überhaupt nicht mehr erkennen, um was es sich da eigentlich handelte. Tupfen! Punkte! Striche! Flecken! Pinselhiebe! Vor allem Gustav Klimt war hin. Und weg. Das war es! Beziehungsweise. Das ist es! Dachte er. Heureka! Da will ich hin. Eines Tages. (Denn jetzt ging es ja noch nicht. Zumal unter Professor Bergers strengen Argusaugen. Die gerade eben eher vor blankem Entsetzen geweitet waren.)
„Das ist … einfach … unfaßbar!“, stammelte Gustav Klimt, während er mit dem Zeigefinger ganz vorsichtig den Malgrund berührte, „Man spürt es sogar!“
„Aber ja! Das soll man ja auch!“, erwiderte die Malerin keß, „Das ist schließlich der Sinn und Zweck der ganzen Sache! Eine Malerei für die Sinne! Une peinture sensuelle! Et une peinture plein d’air! Nehmlich: Plein air! Also Freilicht-Malerei, oder Freiluft-Malerei, wie man auf Deutsch wohl sagt, glaube ich. Es gibt ja noch gar kein richtiges Wort dafür – das ist alles noch ganz neu … Es ist auch thatsächlich draußen entstanden!“
„Wirklich?“, fragte nun auch Franz Matsch, den dieser neue Stil ebenfalls zu interessieren schien – wenn auch bei weitem nicht so sehr wie Gustav Klimt.
„Mais oui! Das ist zur Zeit très à la mode in Paris!“, sie setzte plötzlich die Miene einer einfältigen Pariserin auf, „C’est tout nouveau! Es ist ganz neu! Le dernier cri! Der letzte Schrei, also! Man nennt es: Impressionnisme – also Impressionismus, auf Deutsch. Vermuthlich. Denn auch dafür gibt es noch kein Wort bei uns …“
„Ich bin ganz sprachlos …“, und das war Gustav Klimt wirklich. Das, was er hier sah, kam regelrecht einer Offenbarung gleich. Mehr noch als die Arbeiten Makarts. Oder Schindlers. (Mit dem die Künstlerin sich übrigens bis vor fünf Jahren noch ein Atelier geteilt hatte. Und sich dann mit ihm zerstritten hatte. Wegen unüberbrückbarer Differenzen. Wohl künstlerischer Natur. Denn wie gesagt. Sie hatte ihren eigenen Kopf.)
„Ja! Dieser neue Stil ist die Zukunft der Malerei!“, behauptete die Künstlerin selbstbewußt, „Spontaneität! Unmittelbarkeit! Schnelligkeit! Unmanieriertheit! Intuition! Emotion! Sinnlichkeit! Und zwar ungekünstelt und ungeschönt! Impression, eben! Ein schneller Eindruck! Und zwar der allererste Eindruck von den Dingen, der ja, ganz nebenbei bemerkt, oftmals der Goldrichtige ist …“
Berger indessen, begann nervös mit seiner Schuhspitze zu wippen. Dieses verrückte und offensichtlich entfesselte Weib warf ihm doch tatsächlich grad seine gesamten schulischen Erziehungsprinzipien über Bord! (Und tatsächlich entsprachen all diese Attribute genau dem Gegenteil dessen, was an der Kunstgewerbeschule mühevoll gelehrt und erlernt wurde!)
„Der Impressionismus ist wie ein Schnapp-Schuß mit dem Photo-Apparat!“, Tina Blau war kaum mehr einzubremsen, „Aber eben in Farbe! Genial, nicht wahr? Eine ehrlichere Malerei kann es gar nicht geben!“
Plötzlich sprang Professor Berger auf. (Wie von der Tarantel gestochen.) Was zu viel war. War zu viel.
„Meine Dame, meine Herren!“, ging er nun mit sauertöpfischer Miene dazwischen, „Dieses … Gemälde wird jetzt umgehend wieder verhüllt, damit wir uns endlich unserer Arbeit zuwenden können! Schließlich sind wir ja nicht zum Coquettieren hier!“, und als er die Enttäuschung in den Gesichtern seiner Studenten sah (vor allem in jenem des älteren Klimt-Bruders), fügte er rasch hinzu: „Sie können Madame Blau ja jederzeit privat in ihrem Atelier aufsuchen, nicht wahr? Und dann hätten Sie alle Zeit der Welt, sich über dieses … dieses … Flicken-Werk hier zu ergießen …“
Und damit war dem Einzug der Moderne in Wien der Riegel vorgeschoben. Vorerst zumindest.
Als sie das Atelier nach einer Weile geschlossen wieder verließen, machte Professor Berger ohne Umschweife seiner Mißbilligung über diese soeben verabreichte, bittere Pille – nämlich in Form eines brandneuen Stils (zumal aus den Händen einer Frau!) – freien Lauf. Er wetterte förmlich dagegen! Er sprach. Und schrie. Zeter. Und Mordio. Er tobte. Und bebte. Förmlich. Vor Wut. Das kam ihm nun wirklich nicht in die Tüte! Beziehungsweise. Ins Sackerl. (Dieses Gackerl10.) Er erregte sich. Er erhitzte sich. Er dozierte. Er argumentierte. Er widerlegte. Und führte einen Monolog. Er warnte. (Mit erhobenem Zeigefinger sogar!) Vor diesen neuen Sitten. Vor diesen losen Sitten. Ungeniert. Und anmaßend. Frech. Und zynisch. Vor dem Verfall. Der Moral. Und der Regeln. Der Kunst. Und somit der Ordnung. Die ja schließlich hoch war. Und heilig. Die Hohe Kunst eben. (Aber das war die Angewandte Kunst ja damals in den Augen der Akademiker genauso wenig!) Er sprach von Revolte. Und Anarchie. Von Demagogie. Von Dekadenz. Und sogar vom Ende. Und vom Untergang. Der Kunst. (Und des Abendlandes sowieso.) Und überhaupt. Mulier taceat in ecclesia! Nein. Die drei sollten sich tunlichst und gefälligst an Makart halten. Das war schon der Moderne genug. Und damit basta.
„Da könnte ja schließlich ein jeder daher-kommen!“, schnaubte er, während sein Gesicht sich puterrot verfärbte, „Jeder Aff’ im Zoo, könnte diese Schmierage mindestens genauso guth bewerkstelligen, gäbe man ihm denn nur einen Pinsel und Farben in die Hand!“
Seine Studenten wagten es natürlich nicht, ihm zu widersprechen. Vor allem Gustav Klimt nicht. Und doch war er es, der wohl die gegensätzlichste Meinung zu jener seines Professors hatte. Man würde dies auch bald schon sehen. Nicht allzu bald. Erst in rund siebzehn Jahren. Aber bald. Zudem fiel ihm heute wieder mal auf, wie schrill doch alle Künstler scheinbar waren. Schrill. Und extravagant. Und exaltiert. Zudem sprachen sie alle Französisch. Weil alle entweder in Paris studiert hatten. Oder zumindest bereits einmal dorthin gereist waren. Ein gepflegtes, nobles, mondänes Französisch. Wie die Aristokraten! Einerseits bewunderte er diese Exaltiertheit und Extravaganz. Aber selbst wollte er niemals so werden. Und das hätte er auch gar nicht können. Eben weil er sein Leben lang viel zu schüchtern und introvertiert war. Und viel zu bescheiden. Viel zu bodenständig.
Das Zusammentreffen mit Tina Blau hatte für ihn jedoch auch eine weitere, folgenschwere Konsequenz. Allgemeinhin wird angenommen, Klimt habe seine ersten Landschaften erst in den Jahren 1897/98 gemalt – also fast zwanzig Jahre später. Dies entspricht nicht der Wahrheit, denn just nach der Begegnung und dem daraus erfolgten Gedankenaustausch mit Tina Blau, wurde ihm bewußt, daß ein ganz wichtiger Aspekt in seiner Ausbildung fehlte. Nämlich eben die Landschaftsmalerei. Schon das Zusammentreffen mit Emil Jakob Schindler, in Makarts Atelier, hatte ihm diesbezüglich die Augen geöffnet, denn sowohl Schindler als auch Blau, waren von der neuen französischen Plein-Air-Malerei sehr stark beeinflußt. Monet hatte ja sein erstes rein impressionistisches Bild, ‚Impression (soleil levant)‘, im Jahre 1872 gemalt – also erst neun Jahre zuvor – und diese Neuigkeit machte schnell die Runde, denn es war geradewegs eine Revolution. In der Malerei. Beziehungsweise. Eine Revolution. Der Malerei. Und so wurden sowohl Schindler als auch Blau – vor allem aber Tina Blau, die ebenfalls nach Paris gepilgert war und dort bereits 1883 unter anderem die Tuilerien auf Leinwand festgehalten hatte, die ebenfalls im Wiener Belvedere zu sehen sind – zu den ersten Impressionisten in Österreich überhaupt. Nicht ganz so radikal. Wie jene in Frankreich. Weil dieser neue, „wilde“ Stil bei der konservativen österreichischen Klientel nicht ankam. Sondern weicher. Verklärter. Stimmungsvoller. Weshalb ihr Impressionismus auch als „Stimmungs-Impressionismus“ bezeichnet wird.
Warum Klimt dann tatsächlich erst siebzehn Jahre später begann, konsequent und regelmäßig Landschaften zu malen, liegt ganz einfach daran, daß er vorher keine Zeit dafür hatte. Für die kommenden Jahre sollte er nämlich bis über beide Ohren mit Privat- und Staatsaufträgen eingedeckt werden und unablässig daran arbeiten. Tag. Und Nacht. Und zwar jeden Tag. Das allerdings, funktioniert gerade bei der Landschaftsmalerei nicht. Man braucht Muße, um Landschaften malen zu können. Nicht nur, daß man zuallererst in die Landschaft herausfahren muß (und dies setzt bereits ein gewisses Maß an Freizeit, bzw. Freiheit, voraus), sondern man muß dort völlig abschalten. Zur Ruhe kommen. Eins werden mit der Natur. Man muß die Natur fühlen. Sie begreifen. Ihren eigenen Herzschlag spüren. Denn sonst kann man sie nicht überzeugend wiedergeben. Erst bei seinen späteren Aufenthalten am Attersee, zur Sommerfrische, würde Gustav Klimt wirklich die nötige Ruhe finden (auch die innere), um sich ganz und gar auf die Landschaftsmalerei einlassen zu können. Und bemerkenswert ist auch, daß Klimt für allgemeinhin nicht so sehr als Landschaftsmaler wahrgenommen wird. In erster Linie stehen seine Allegorien. Und seine Portraits. Dennoch sollte er im Laufe seines Lebens beinahe sechzig Landschaftsbilder malen, was immerhin ein Viertel seines Gesamtwerkes ausmacht! Ab dem Jahre 1898, in welchem er sich konsequent in die Landschaftsmalerei vertiefte, schuf er, bis zu seinem Tode, überhaupt nur noch hundertvierundzwanzig Gemälde. Wenn man die Sache so rechnet, dann machen die Landschaften also tatsächlich die Hälfte seines gesamten Schaffens aus.
Also machte er sich noch in diesem Jahr daran. An die Landschaftsmalerei. Sie interessierte ihn brennend. Und er war für sie entflammt. Im Grunde muß man sich Gustav Klimt wie einen Schwamm vorstellen: Alles, was ihn irgendwie interessierte, oder nur peripher tangierte, das nahm er umgehend in sich auf. Beziehungsweise war er wie ein Koch: Alles, was er bekommen konnte, verkochte er. Und zwar sofort. Zu einem eigenen Stil. Jetzt noch nicht. Allzu sehr. Aber dafür später. Umso mehr.
Das heutige Klimt-Menü besteht (unter anderem) aus:
Einem Eßlöffel Laufberger.
Einem gehörigen Schuß Makart.
Einer Prise Schindler. Und Blau.
Einem guten Pfund van Gogh. Und Monet.
Einem Quentchen Leighton. Whistler. Und Beardsley.
Einem Teelöffel Khnopff. Toorop. Und Rodin.
Einer gestrichenen Tasse Matisse. Und Lautrec.
Abgeschmeckt mit einer Messerspitze Schiele.
(Und doch schmeckt es gänzlich nach Klimt.)
Inspiriert – nein: angespornt – von Tina Blaus und Emil Jakob Schindlers Landschaften, nutzte Gustav Klimt nun seine äußerst knapp bemessene freie Zeit, um an den Wochenenden in den nahegelegenen Wienerwald zu fahren und sich dort in der Landschaftsmalerei zu üben. Diese ersten Landschaften verkaufte er nicht etwa, denn das Interesse an Landschaften, zumal an kleinformatigen, war beim Wiener Großbürgertum zu jener Zeit bei weitem nicht so groß wie etwa an Portraits oder allegorischen Darstellungen. Kleinformatige Landschaften besaß man schließlich noch und nöcher, und zwar aus der inzwischen unmodern gewordenen Biedermeierzeit – die damals noch nicht allzu weit entfernt lag, nämlich erst gut dreißig Jahre, endete sie doch offiziell erst im Jahre 1848. Zudem war es Mode im Großbürgertum, selbst zu malen, weshalb die bourgeoisen Salons übervoll waren mit bemühten und gutgemeinten Landschaften von Onkeln und Tanten. Neffen und Nichten. Vettern und Basen. Söhnen und Töchtern. Müttern und Vätern. Und so behielt Gustav Klimt diese ersten Landschaften. Oder schenkte sie seinen Schwestern. Er selbst schien sie nicht für beachtenswert zu halten, obwohl sich in ihnen doch bereits der spätere Künstler offenbart.
Als erstes Sujet wählte er einen ‚Stillen Weiher‘, denn eine glatte Wasseroberfläche, welche den Himmel reflektiert, erschien ihm als reizvollstes und stimmungsvollstes Motiv. (Später sollte er es noch einige Male verwenden.) Dabei knüpfte er an den immer noch aktuellen Wiener Stimmungs-Impressionismus an – also an jene spezifische und von den Franzosen, nämlich der École de Barbizon, inspirierte Richtung der Landschaftsmalerei, die nach dem Tode Waldmüllers, während der 60’er Jahre des Neunzehnten Jahrhunderts, einsetzte und deren Leitfiguren eben Emil Jakob Schindler und Tina Blau waren. Und dennoch imitierte Klimt die beiden nicht. Vielmehr suchte er nach einer neuen Sicht- und Darstellungsweise der Natur. Seine Epoche, die sehr stark vom Ornament geprägt war, hatte seinen Blick verändert. Nicht zuletzt war es ja das ornamentale Sehen und Erfassen der Dinge, welches allem voran an der Kunstgewerbeschule tagtäglich trainiert und den Schülern förmlich eingebläut wurde.
Also begann Gustav Klimt auch die Landschaft als Ornament zu sehen. Beziehungsweise. Diese in ornamentale Felder zu zerlegen. Während bei Schindler noch die Weite des Raumes in den Vordergrund rückt, lassen sich bei diesen allerersten Landschaften Gustav Klimts bereits Tendenzen seines späteren, unverkennbaren Stils entdecken, da er, eben aufgrund seines Fokus’ auf das Ornamentale, ein völlig neues Kompositionsprinzip – und somit auch ein völlig neues Raumgefühl – erschafft. Bei Gustav Klimt wird plötzlich alles sehr konzentriert. Sehr eng. Aber ohne beengend zu wirken. Er wählt lediglich kleine Ausschnitte der zu malenden Landschaften aus, was er später, mit Hilfe eines eigens dafür angefertigten „Suchers“, nurmehr tun sollte – einem kleinen Kärtchen aus Karton, in welchem sich ein quadratisches, ausgestanztes Sichtfeld befand. Ideal, um bloß einen Teil, einen Ausschnitt, einer Landschaft zu fokussieren und diesen dann auf die Leinwand zu übertragen.
Das nächste Landschaftsbild Gustav Klimts, ein ‚Waldboden‘, verdeutlicht dies noch weitaus genauer. Denn hier wird die Ausschnitthaftigkeit der Landschaft förmlich auf die Spitze getrieben. Eben weil der junge Künstler sich hier lediglich auf den Boden des Waldes konzentriert, von einer leichten Erhöhung aus gemalt, wobei das Ornament hier nicht nur durch die vertikalen Stämme der Bäume gebildet wird, sondern auch durch ein sowohl raffiniertes als auch subtiles Spiel aus Licht und Schatten, welches sich über den gesamten Waldboden zieht. Bereits in diesem, zweiten, Landschaftsbild, offenbart sich eine geradezu meisterhafte und wahrlich bezaubernde Lichtführung, welche jener der Impressionisten in nichts nachsteht. Durch den Fokus auf den Boden des Waldes – ein Motiv, welches so schlicht wie genial (und vor allem modern!) ist – distanziert er sich jedoch von den Wiener Impressionisten und legt bereits einen ganz eigenen, persönlichen Stil an, der sich jedoch, wie gesagt, erst in rund zwanzig Jahren vollständig entfalten sollte.
Beim dritten dieser ersten Landschaftsbilder, ‚Waldinneres‘, macht der junge Künstler dann noch einmal einen regelrechten Quantensprung. Diese Landschaft ist bereits völlig ornamental zergliedert, extrem ausschnitthaft dargestellt, zudem mit einer starken Draufsicht, wodurch das Motiv plötzlich zweidimensional wirkt, was für seinen späteren Stil symptomatisch werden sollte. Zwar gibt es diese Tendenz einer starken Draufsicht bereits bei der Schule von Barbizon und bei Schindler zu erkennen, aber Klimt treibt es förmlich auf die Spitze, denn bei ihm wird die ganze Natur zum Ornament, wodurch dieses dritte Landschaftsbild fast schon einen sakralen Charakter erhält. Bereits in seinen frühesten Landschaftsbildern verzichtet er zudem vollständig auf die Darstellung von Menschen oder Tieren. In seinen Landschaften herrscht ausschließlich Ruhe. Eine zeitlose und kontemplative Ruhe. Man spürt bereits in diesen frühesten Landschaften (und da war er ja gerade einmal neunzehn Jahre jung!), was Gustav Klimt als Maler wirklich wichtig war. Und was er aus Zeitmangel erst in seinem letzten Lebensdrittel verwirklichen konnte. Aber dies auch nur begrenzt. Nämlich nur während seiner Sommerfrische-Aufenthalte am Attersee, jeweils im Juli und im August, wo er, wie gesagt, die nötige Ruhe und Muße fand, sich völlig auf die Landschaftsmalerei einlassen zu können.
Als Kontrastprogramm dazu – also das genaue Gegenteil, was den Stil und die freie Wahl des Motivs anbelangt – erhielten Gustav und Ernst Klimt sowie Franz Matsch den Auftrag, am Musterbuch ‚Allegorien und Embleme‘ mitzuarbeiten, welches von Martin Gerlach herausgegeben wurde und im Wiener Verlag Gerlach & Schenk erscheinen sollte, mit erklärenden Texten von Dr. Albert Ilg, keinem Geringeren als dem Direktor des Kunsthistorischen Hofmuseums. Diesen Auftrag hatten sie bereits im vergangenen Jahr erhalten und die Arbeit daran sollte sich noch über die kommenden drei Jahre erstrecken. Obwohl die drei die Arbeit daran todlangweilig fanden, war es eine lukrative Einnahmequelle. Dieses, in drei Bänden angelegte Kompendium, bot, laut Untertitel, „Originalentwürfe von den hervorragendsten modernen Künstlern, alte Zunftzeichen und moderne Entwürfe von Zunftwappen im Charakter der Renaissance“. Viele namhafte Künstler hatten sich zur Mitarbeit daran bereit erklärt, unter anderem auch Max Klinger und Franz von Stuck. Die ersten beiden Bände – ‚Allegorien sowie Embleme und Zunftwappen‘ – erschienen zwischen 1882 und 1884. Der dritte Band allerdings, ‚Allegorien. Neue Folge‘, sollte fast zwanzig Jahre später erscheinen, erst zwischen 1895 und 1900. Dieses groß angelegte Kompendium war ganz dem Geiste des Historismus verschrieben. Die Idee dabei war es, Allegorien der Renaissance, des Barock und des Rokoko neu zu interpretieren und sie somit, vor allem für die Ausstattungs- und Buchdruckkunst, wieder aktuell werden zu lassen.
Daneben gab es aber auch Neuschöpfungen von Seiten der Künstler. Schließlich hatte sich das Rad der Zeit inzwischen weitergedreht. Und somit lautete auch eine der Maximen dieser Publikation, die „wichtigsten Begriffe des idealen und reellen Lebens zu illustrieren“ – also moderne Allegorien, zum Beispiel der Tages- und Jahreszeiten, anzufertigen – aber auch von Emotionen und Fügungen, wie zum Beispiel der Liebe und dem Tod. Dazu kamen Allegorien der verschiedenen Staats- und Regierungsformen, des Handels und der Stände, aber auch der modernen Errungenschaften der Technik, wobei sich diese thematisch völlig neuartigen Allegorien stilistisch an den historischen Vorlagen orientieren sollten, inhaltlich allerdings der neuen Zeit entsprechen mußten. Dies führte unweigerlich zu einem Interessen- und Stilkonflikt und forderte zuhauf unbarmherzige Kritiker aufs Tapet, wobei das Hauptargument war, daß es peinlich und nicht mehr zeitgemäß sei, neue technische Erfindungen und Errungenschaften wie die Eisenbahn, den Magnetismus oder insbesondere die Elektrizität, in barocker Manier – oder gar im Stile der Renaissance – darzustellen. Trotz allem erfreute sich dieses Werk größter Beliebtheit beim Publikum und bei den Künstlern selbst.
Schon ab dem kommenden Jahre, also 1882, wurde dieses Standardwerk auch ins Englische übersetzt, wobei es sich (und somit auch die Reproduktionen der Klimt’schen Arbeiten) rasch über den ganzen Globus verbreiten sollte. Die Zeichnungen, aber auch Ölgemälde Klimts, welche als Illustrationen für das Kompendium ‚Allegorien und Embleme‘ dienten, sollten also seine ersten Arbeiten sein, die international bekannt wurden. Vor allem für seine Entwicklung als Graphiker, war dieses Werk von allergrößter Bedeutung. Zudem kann man anhand dieser Illustrationen seinen frühen künstlerischen Werdegang sehr gut nachvollziehen. Während nämlich die ersten Zeichnungen, wie zum Beispiel die ‚Vier Tageszeiten‘, aus eben diesem Jahre, oder ‚Jugend‘, aus dem Folgejahre, also 1882, noch sehr stark durch Laufbergers Stil geprägt sind, läßt sich bei den späteren Blättern eindeutig der Einfluß Makarts erkennen, dessen glühender Anhänger sein zweiter Professor für Dekorative Malerei, Julius Victor Berger, nun mal war.
Da es also, neben dem Studium, immer mehr zu tun gab, und ersteres ja bereits in zwei Jahren abgeschlossen sein sollte, machten die drei Kollegen und Freunde tatsächlich noch in diesem Jahre ihre Ateliergemeinschaft offiziell und meldeten sie, unter dem Namen Künstler-Compagnie, als Unternehmung an. Obwohl offiziell alle drei Teilhaber darauf bestanden, daß es keinen Geschäftsführer gebe und daß sie vielmehr alle zu gleichen Teilen verantwortlich seien, war doch Franz Matsch offensichtlich der Kopf der Firma. Denn er hatte das Amt des Schriftführers sowie des Kassierers und des Organisators inne, womit er auch für die Buchhaltung verantwortlich war. Außerdem besaß er ein außerordentliches Gespür dafür, zukünftige Auftraggeber ausfindig zu machen und somit die Verträge für ihre Unternehmung zu lukrieren, während den anderen beiden ein jeglicher Geschäftssinn völlig abging. Von daher konnte es ihnen nur recht sein, wenn Franz Matsch künftig all diese leidigen Aufgaben übernahm.
Bei der Arbeitsaufteilung herrschte, bis auf zwei Ausnahmen, wo sie alle ‚durcheinander‘ arbeiten sollten, wie Matsch es später nannte, ein klares Konzept vor. Nämlich eine klare Arbeitsteilung. Sobald Franz Matsch einen Auftrag an Land gezogen hatte und sie die Aufforderung von Seiten des Bauherren erhielten, ihre Skizzen und Entwürfe einzureichen, fertigte jeder von ihnen einen kompletten Satz an. Somit sicherten sie sich dreifach ab, denn der Auftraggeber hatte nun die Möglichkeit, aus drei Alternativen auszuwählen oder diese gar untereinander zu mischen, womit nicht nur ihre Chance auf eine endgültige Auftragserteilung dreimal höher war, sondern auch das Risiko einer letztendlichen Absage des Projekts wegen Nichtgefallens dreimal geringer. Sobald dann die vom Bauherrn gewünschten Skizzen retour kamen, wurde per demokratischem Beschluß oder per Los entschieden, wer genau was auszuführen hatte. So konnte es durchaus geschehen, daß einer von ihnen die Skizze des anderen realisierte, wobei letztendlich dann doch jeder eher bei seinen eigenen Entwürfen blieb. Sie arbeiteten schließlich alle in gleicher Art und Weise, weshalb also keinerlei stilistischer Unterschied zwischen ihren einzelnen Arbeiten zu erkennen war – zumindest nicht für das ungeschulte Auge.
Franz Matsch behauptete zwar stets nach Außen hin, daß sie, bezüglich der Ausführung der Skizzen, alle zu gleichen Teilen involviert seien (zumal legte er auch großen Wert darauf, in Wien die Fama von der Auslosung ihrer jeweiligen Auftragsarbeiten zu verbreiten), dennoch nahm Ernst Klimt, der jüngste von ihnen, eine eher untergeordnete Rolle ein. Da er nicht ganz so begabt war wie seine beiden Kollegen und zudem auch noch recht langsam (dafür außerordentlich präzise) arbeitete. Konzentrierte er sich eher auf Dekorationsbeiwerk, wie zum Beispiel Hintergrundarbeiten oder ornamentale Bordüren. Eine minutiöse Arbeit, die ihm sogar Spaß machte, während sie den anderen beiden, allem voran Gustav Klimt, völlig zuwider, wenn nicht gar verhaßt, war. Somit ergänzten sie sich alle drei perfekt – und keiner pfuschte dem anderen in dessen Handwerk hinein.