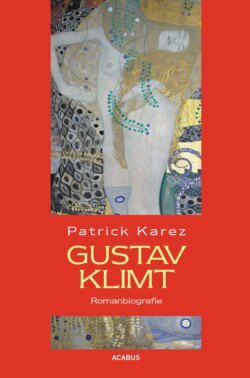Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16
ОглавлениеEnde des Jahres – genauer gesagt am 8. Dezember 1881 – sollte sich eine schreckliche Nachricht wie ein Lauffeuer in Wien verbreiten. „Das Ring-Theater brennt!“. Und tatsächlich. Die rote Feuersäule loderte so weit in den Wiener Nachthimmel, daß man sie von überall her sehen konnte. Die Sirenen heulten, die Glocken läuteten, und alles strömte hin. Alle Droschken und Fiaker waren in Windeseile vergriffen, und diejenigen, die keinen fahrbaren Untersatz mehr hatten ergattern können, liefen zu Fuß hin. Über die prächtige, nächtlich erleuchtete Ringstraße. Die noch halb im Bau war. Vorbei an der Staatsoper, vorbei an den großen Museen und der Hofburg, am Rathaus, am Hofburgtheater, an der Neuen Universität – bishin zur Wiener Börse, der gegenüber das neue Ringstraßen-Theater lag. Doch das, was man dort zu Gesicht bekam, war das Schrecklichste, was die Reichshauptstadt – vom Ausbruch der Pest während der ersten Türkenbelagerung vielleicht einmal ausgenommen – jemals erlebt hatte. Es war förmlich die Hölle. Auf Erden.
An diesem Tage hätte eigentlich die Phantastische Oper ‚Hoffmanns Erzählungen‘ des Kölner Komponisten Jakob Eberst, besser bekannt als Jacques Offenbach, aufgeführt werden sollen – und der Andrang war groß, da das Stück erst im Februar dieses Jahres, in Paris, uraufgeführt worden war. Der riesige Saal war bis zum letzten Platz ausverkauft und vornehmlich mit Vertretern des Wiener Großbürgertums, angefüllt. Weil die Bühne damals ausschließlich mit Gaslaternen beleuchtet wurde, die Zündvorrichtung an diesem Abend jedoch einen Defekt aufwies, fing die Bühne noch vor Beginn des Stückes Feuer, welches sich rasch auf den gesamten Zuschauerraum ausbreitete. Da die Flügeltüren des Saales sich lediglich nach Innen öffnen ließen und die Menschen bei Ausbruch des Feuers jedoch in wilder Panik von Innen gegen die Flügeltüren drückten, verbrannten Hunderte von ihnen hilflos in den Flammen. Auch die Klimt-Brüder fuhren hin, um sich dieses Inferno anzusehen, gingen aber bald darauf wieder, weil dieser Anblick das Schrecklichste war, was sie jemals gesehen hatten. Die rund vierhundert Leichen, die von der Brandwehr herausgetragen wurden und unter weißen Tüchern verborgen lagen, waren kaum größer als einen Meter, da die Theaterbesucher förmlich verkohlt- und somit auf die Größe von Kindern zusammengeschrumpft waren.
Somit erübrigte sich nicht nur Hans Makarts Auftrag, einen neuen Mittelteil für den Vorhang dieses Theaters in Wachstechnik anzufertigen, es hatte auch Auswirkungen auf die Arbeiten der drei jungen Künstler, da nach diesem verheerenden und alles vernichtenden Ringstraßen-Theater-Brand neue Brandschutz-Bestimmungen für den Theaterbau, sowie insgesamt eine neue Theaterbau-Ordnung von den zuständigen Behörden erlassen wurden, welche übrigens, von Wien ausgehend, in ganz Europa zur verpflichtenden Anwendung kommen sollten, weshalb sich auch die laufenden Arbeiten ihrer Auftraggeber, Fellner und Helmer, empfindlich verzögern sollten.
Auch im darauffolgenden Jahr, ihrem vorletzten Studienjahr, sollte es für die neu gegründete Künstler-Compagnie bezüglich der Aufträge munter weitergehen. Nachdem sich die Arbeiten im Palais Zierer bis ins Frühjahr hinein gezogen hatten – und währenddessen die Arbeit am Mappenwerk ‚Allegorien und Embleme‘ die drei jungen Künstler kontinuierlich beschäftigte – erhielten sie 1882 gleich zwei neue Aufträge von Fellner und Helmer. Zum einen, sollten sie für das im Juli des vergangenen Jahres begonnene Stadttheater in Brünn Sgraffiti ausführen, Putti mit Spruchbändern, wobei es sich jedoch insgesamt um vier unterschiedliche Typen handeln sollte, welche an drei Fassaden anzubringen waren, nämlich zwischen den Fenstern des zweiten Obergeschoßes. Fellner und Helmer arbeiteten stets in einem Rekordtempo (und das bei dieser enormen Qualität!), denn nach einer Bauzeit von nur fünfzehn Monaten, konnte das Brünner Stadttheater noch im Herbst, und zwar am 30. Oktober, feierlich eröffnet werden. Da es noch vor dem Brand der Komischen Oper weitgehend fertiggestellt war, kamen hier die neuen Theaterbau-Bestimmungen noch nicht in vollem Maße zum tragen.
Anders verhielt es sich jedoch beim Bau des Reichenberger Stadttheaters, welches ebenfalls im vergangenen Jahre bei Fellner und Helmer in Auftrag gegeben wurde. (Denn die Herren Architekten tanzten ständig auf mehreren Hochzeiten. Und das in halb Europa.) Nachdem man die Baupläne bereits im August des vergangenen Jahres eingereicht hatte, verschob sich der Baubeginn in Reichenberg (heute: Liberec) bis in den Oktober hinein, also um ganze vierzehn Monate, weil die Baupläne komplett umgeändert werden mußten. Die neue Theaterbau-Ordnung, mit ihren strikten Brandschutz-Bestimmungen, kam hier voll zum Tragen und veranlaßte die Behörden dazu, vor Baubeginn alle betreffenden Veränderungen vorzunehmen, was Fellner und Helmer also im Grunde die Arbeit von zwei neuen Theatern bescherte. Erst im darauffolgenden Jahre, nämlich am 30. September 1883, konnte das Theater (übrigens mit der Aufführung von Friedrich Schillers Wilhelm Tell) eröffnet werden.
Die Compagnie fertigte hierfür vier Deckenbilder, ein Proszeniumsbild, sowie, ganz zum Schluß, den Theatervorhang, womit sie in gewisser Weise in Makarts Fußstapfen traten (wobei es diesem ja, wie gesagt, in der Komischen Oper aus tragischen Gründen nicht vergönnt gewesen war). Und sie teilten sich die Arbeit wie folgt auf: Jeweils zwei der Deckenbilder wurden von Franz Matsch und Gustav Klimt gefertigt, während Ernst Klimt das Proszeniumsbild, also das Gemälde über der Bühnenöffnung, übernahm. Am Bühnenvorhang arbeiteten sie schließlich alle drei zusammen. Gustav Klimt schuf die beiden Deckenbilder ‚Lautenspiel‘, sowie ‚Familie mit trommelndem Kind‘, beide in Öl, auf Leinwand. Aus seiner Hand stammte ebenfalls der Entwurf zum Theatervorhang, ebenfalls Öl auf Leinwand, der schließlich angenommen wurde und unter dem Titel ‚Heitere und ernste Kunst‘ von allen dreien in Leimfarbe auf Leinwand ausgeführt wurde. Die Arbeiten daran zogen sich bis ins folgende Jahr, als das Theater schließlich Ende September feierlich eröffnet werden konnte. Wobei ihre vollendeten Werke, bevor man sie ins böhmische Reichenberg verschickte, im Museum für Kunst und Industrie in Wien ausgestellt wurden, was natürlich für die drei, die ja kurz vor ihrem Studienabschluß standen, eine große Ehre war.
Übrigens arbeiteten die drei – auch für ihre Aufträge in den Kronländern sowie im Ausland – stets in Wien, in ihrem Atelier, weshalb sie die Architekturpläne äußerst genau studieren mußten und von daher immer sehr gut kannten. In ihren Arbeitspausen konzentrierten sie sich während ihrer letzten beiden Studienjahre vornehmlich auf die Aktmalerei – das heißt auf Männerakte – sehr zum Bedauern Gustav Klimts natürlich, wobei in seinen Arbeiten dieser letzten beiden Studienjahre immer noch der Einfluß seines verstorbenen Professors Laufberger zu erkennen ist. Bald würde ihr Studium also enden – doch vor allem Gustav Klimt machte sich große Sorgen, da trotz des Stipendiums von zwanzig Gulden monatlich, ihr Einkommen immer noch nicht ausreichte, um die ganze Familie durchbringen zu können. Geschweige denn, um ihnen allen eine anständige und komfortable (und vor allem dauerhafte) Unterkunft zu gewährleisten. Noch lebten sie ja alle in der unsäglichen Dachbodenwohnung im ehemaligen Kloster, auf der Mariahilfer Straße. Und das sollten sie noch für ganze zwei Jahre.