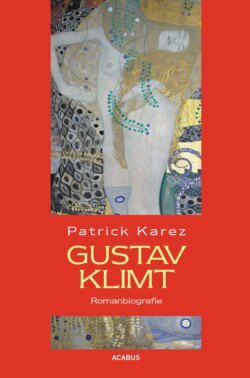Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 19
14
ОглавлениеVon nun an ging es mit den Aufträgen für die drei jungen Burschen Knall auf Fall. Offiziell hatten sie zwar noch keine eigene Unternehmung gegründet, oder gar angemeldet, aber sie nannten sich, ganz nach den Worten ihres Meisters, Compagnie. Nur wenig später sollte daraus die Künstler-Compagnie werden – einer der erfolgreichsten Zusammenschlüsse in der Kunstgeschichte. Normalerweise sind ja Künstler eher Einzelgänger. Individualisten. Kämpferische sogar. Das liegt nun mal in ihrem Naturell. Sie können mitunter recht stutenbissig sein. Und mit unbändiger Eifersucht reagieren. Auf ihre Konkurrenten. Auf ihre Freßfeinde. Die ihnen das Futter vor der Nase wegschnappen. Und die unter Umständen sogar noch viel besser sind als sie selbst. Nicht so die drei. Denn in der dekorativen Malerei gab es ohnehin keinen Platz für individualistische Höhenflüge. Für egoistische Kapriolen. Und genauso sahen die drei auch ihr eigenes Kunstschaffen. Einer für Alle. Alle für Einen. Da sich keiner von ihnen mit einem eigenen Stil in den Vordergrund drängte, waren sie untereinander vollkommen austauschbar. Ein großes Plus. Wenn man sich als Kollektiv versteht. Und vor allem. Wenn man im Kollektiv arbeitet. Das war fast schon gelebter Kommunismus. (Karl Marx, der zu dieser Zeit ja noch lebte, und erst drei Jahre später sterben sollte, hätte übrigens seine größte Freude an ihnen gehabt. Denn seine zynisch-pragmatische Meinung zu diesem Thema lautet wie folgt: „In einer kommunistischen Gesellschaft gibt es keine Maler, sondern höchstens Menschen, die auch malen.“8)
Professor Laufberger hatte wieder Wort gehalten: Bereits zum Ende des Vorjahres hatte er ihnen in der Schule ein eigenes Atelier verschafft. Dies war eine ungemeine Auszeichnung für die drei Studenten und zeigte überdies seine Wertschätzung für seine jungen Zöglinge. Für die Compagnie. Die anderen Studenten hingegen, nahmen diese Neuigkeit mit gemischten Gefühlen auf. Aber sie waren es ja schließlich auch selbst schuld. Denn sie waren allesamt Einzelkämpfer. So viele Atelierräume hätte es in der Schule gar nicht geben können, daß jedem von ihnen ein eigener hätte zugewiesen werden können.
Anfangs. Da hatte Gustav Klimt noch gedacht. Er selbst sei der Lieblingsschüler Laufbergers. Warum auch immer. Vielleicht weil sein Vater und jener einst in derselben Gegend gelebt hatten. Das war allerdings völlig irrational. Davon läßt sich ein Meister nicht beirren. Und erst recht nicht leiten. Von derartigen Banalitäten. Und Zufällen. Des Lebens. Er deutet es vielleicht als Zeichen. Wenn er abergläubisch ist. Aber er läßt sich davon ganz sicher nicht beeinflussen. Nein. Anfangs. Da hatte Gustav Klimt tatsächlich noch gedacht. Er sei der Lieblingsschüler Laufbergers. Vielleicht weil er vom Meister viel Lob und Zuspruch erhielt. Sehr viel. Aber nicht das meiste. Denn das meiste Lob erntete zweifelsohne Franz Matsch. Laufberger ließ bereits von Anfang an durchblicken, daß Franz Matsch von allen der Begabteste sei. Nun. Sagen wir. Der Folgsamste. Denn er hatte kaum eine eigene Meinung. Er tat stets das. Was der Meister ihm auftrug. Ohne Widerworte. Und ohne Abzuwägen. Das Für. Und das Wider. Gustav Klimt hingegen. Der war da schon um einiges unbequemer. Sogar bereits in diesen ganz frühen Jahren. Der hatte einen eigenen Kopf. Definitiv. Der sprühte förmlich nur so vor Phantasie. Der war ein Weltverbesserer. Ein Welterneuerer. Zumindest würde er es eines Tages sein. Der würde sich über alle Grenzen und Gesetze hinwegsetzen. Eines Tages. Und über alle Konventionen. Das sah Laufberger sofort. Dennoch wurde Franz Matsch sein Lieblings-Student. Beziehungsweise. Gerade deshalb. Denn der hielt sich von allen Schülern am konsequentesten an die Lehrprinzipien seines Meisters. Der eine Klimt-Junge. Der jüngere. Der war in seinen Augen nicht allzu begabt. Begabt schon. Aber eben nicht allzu. Dennoch würde auch aus ihm etwas werden. Wenn er nur fleißig wäre. Und das war er. Vielleicht sogar von allen am meisten. Um auf diese Weise eben das Manko an Genialität wieder wettzumachen. Der andere hingegen. Der Ältere. Erschien ihm fast schon als angehendes Genie. Der hätte wohl eher auf die Akademie gehört. Dachte Laufberger. Denn nur dort erhielte er jene Freiheit. Die er für seine Entwicklung bräuchte. Hier hingegen. War er allzu sehr eingespannt. Allzu sehr gefangen. Das sah Laufberger. Und er spürte es. Tag. Für Tag.
Bereits im Oktober des vergangenen Jahres. Hatten die drei von ihrem Meister den Auftrag erhalten. Dessen Entwürfe für die allegorischen Sgraffito-Darstellungen in den Höfen des Kunsthistorischen Hofmuseums in Wien als Schablonen auszuführen. Heuer war es also endlich so weit. 1880. Ein gutes Jahr. Ein rundes Jahr. Auch für die drei. Sollte von nun an alles rund laufen. Sie würden sich selbst noch wundern. Wie sehr. Zuvor hatte Professor Laufberger sie einige Male mitgenommen. Auf die Baustelle. Damit sie sich ein eigenes Bild machen konnten. Vom Großen. Und Ganzen. Denn das war wichtig. Für einen Dekorationsmaler. Sagte er. Schließlich dient dieser ja der Architektur. Also muß er sie auch kennen. Sehr gut sogar. Möglichst perfekt. Er muß sie verstehen. Deshalb muß er sich in der jeweiligen Epoche sehr gut auskennen. In welcher das Haus errichtet wurde. Beziehungsweise. In der jeweiligen Epoche. Welche das Haus widerspiegelte. In diesem Falle die Hochrenaissance. Die italienische. Was sonst. Der Historismus war eine sehr arbeits- und zeitaufwendige Kunstepoche. Er verlangte den Künstlern alles ab. Zwischen 1830. Und 1880. Gab es den romantischen Historismus. Dann den strengen Historismus. Beziehungsweise. Den wissenschaftlichen Historismus. Und nach 1880. Den Späthistorismus. Beziehungsweise. Die Restaurationsgründerzeit. Doch vor allem der strenge Historismus. Der hatte es in sich. Um wirklich glaubwürdig und authentisch arbeiten zu können, mußten die Künstler und Architekten eine geradezu wissenschaftliche Recherche betreiben. Ein Künstler des Historismus, zumal ein guter, der war immer auch eine Art Kunsthistoriker. Sein historisches Wissen mußte fundiert sein. Hieb. Und Stichfest. Denn sonst wurde er von den Experten auseinandergenommen.
Am 30. Mai war es dann so weit. Endlich. Durften die drei Studenten mit der Ausführung ihrer Arbeit beginnen. Sie brachten also mittels ihrer vorgefertigten Schablonen die Festons an. Und sie waren hoch motiviert. Es machte ihnen Spaß. Direkt am Bauwerk arbeiten zu dürfen. Das war etwas ganz anderes. Als herinnen. Im Schulatelier. Bereits am 6. Juni hatten sie ihre Arbeit vollendet. Nach einer Woche nur. Und die konnte sich sehen lassen. Die Putti wirkten überaus lebendig. Sie hielten ihre Spruchbänder. Stolz. Und verspielt zugleich. Auf denen die Namen berühmter Künstler prangten. Überaus detailliert. Fielen auch die Personifikationen der Schönen Künste und des Kunsthandwerks aus. Auch das renommierte Baujournal nahm Notiz davon. Man schrieb darüber. Daß Laufberger die Ausführung vorgenommen hatte. Und zwar „mit seinen drei Gehülfen“9. Noch wurden sie nicht namentlich genannt. Aber das würde bald schon kommen. Sehr bald sogar. Und nur zwei Jahre später, ein Jahr nach dem Tode Laufbergers, sollten ihre Schablonen im K.u.K. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie ausgestellt- und anschließend durch die Galerie Miethke versteigert werden.
Der nächste Auftrag folgte auf dem Fuße. Professor Laufberger hielt wirklich Wort. Und deckte die drei jungen Burschen bis über alle Ohren mit Arbeit ein. Als ob er gewußt hätte, daß er das kommende Jahr nicht mehr überleben sollte. Darüber hinaus machte er sie auch mit dem Kunstmarkt vertraut. Schließlich mußte ja auch ein Künstler von etwas leben. Die Kunst allein machte ihn nicht satt. Zudem hatte er Mitleid mit den Klimts. Die prekäre Situation ihrer Familie hatte sich längst in der Schule herumgesprochen. Abgesehen davon. Sah man es auch. Denn keiner der Studenten war so erbärmlich gekleidet wie die beiden Klimt-Brüder. Anstatt sich von ihrem ersten Einkommen elegante Anzüge zu kaufen, lieferten sie jeden verdienten Gulden daheim ab. Damit die Familie etwas zu essen hatte. Vor allem die kleinen Geschwister. Diese Großzügigkeit und Selbstlosigkeit sollte Gustav Klimt sein Leben lang beibehalten. Weshalb er selbst es auch nie zu Wohlstand bringen sollte. Er würde bis an sein Lebensende ein Dasein in größter Bescheidenheit führen. Und das, obwohl er bald schon der bestbezahlte Maler der gesamten Donaumonarchie werden sollte.
Es war auch in diesem Jahr, daß Professor Laufberger die drei Studenten mit wichtigen Auftraggebern in Kontakt bringen sollte. Allem voran mit Ferdinand Fellner. Und Hermann Helmer. Aus dem Effeff. (FF.) Und HH. Wurde F&H. Fellner und Helmer. Die berühmten Theaterarchitekten. Die bedeutendsten überhaupt. In der gesamten Donaumonarchie. Denn dieses Architekten-Duo, das längst schon zur lebenden Legende geworden war, sollte zwischen 1872 und 1915 ganze achtundvierzig neue Theater in Österreich-Ungarn errichten. Samt Kronländern. Sowie im heutigen Deutschland. Und in den Balkanländern. Wobei sie neben dem eigentlichen Bauvorhaben ebenfalls für die gesamte Ausstattung Sorge zu tragen hatten. Und die Auftraggeber waren damals sehr heikel. Und wählerisch. Also suchten Fellner und Helmer für diese Aufgabe immer wieder qualifizierte Dekorationsmaler. Die nicht allzu teuer waren. Aber gut mußten sie sein. Sehr gut sogar. Denn die beiden Architekten hafteten ja mit ihrem guten Namen dafür. Und so kam es. Daß das Bureau Fellner und Helmer in den nächsten Jahren zum wichtigsten Auftraggeber für die Gebrüder Klimt sowie für Franz Matsch werden sollte.
„Meine Herren!“, Laufberger betrat das Atelier, in welchem die drei Studenten wie immer fleißig schufen, „Wie Sie ja wissen, übernehmen Sie einige der Decorations-Arbeiten am Palais Sturany, im Auftrage des Architectur-Bureaus Fellner und Helmer … Dies wird übrigens Ihr erster eigenständiger Auftrag sein! Ich selbst werde mich da nicht mehr einmengen …“
Die drei nickten. Sie waren bereits seit Tagen sehr aufgeregt deswegen.
„Das wird eine Menge Arbeit und Sie sehen hoffentlich bereits jetzt den enormen Vortheil eines eigenen, separaten Ateliers … Nun, am heutigen Nachmittage findet die Baustellen-Begehung statt und bei dieser Gelegenheit dürfen Sie sich heute bei den Herren Architecten höchst-selbst vorstellig machen. Ich habe dies so arrangiert, weil ich der festen Überzeugung bin, daß Ihnen hiermit eine lang-jährige Zusammenarbeit angedeihen könnte. Ich werde Sie selbstverständlich hierbei begleiten und noch einmal, hoch-officiell, für Sie drei eine explicite Empfehlung abgeben … Wenn Sie dann so guth sein würden – die Droschke wird uns um vierzehn Uhr vor dem Hause erwarten …“
Die drei Studenten bedankten sich. Vielleicht ein wenig zu überschwenglich.
„Ach, und noch etwas …“, Professor Laufberger, der bereits halb im Türrahmen verschwunden war, hielt plötzlich inne und adressierte die Rede erneut an seine Studenten, ohne sich dabei noch einmal umzuwenden: „Es wäre vielleicht von Vortheil, zumindest für zwei von Ihnen, bäldigst bei einem Herren-Schneider vorstellig zu werden, um sich neue Anzüge maß-anfertigen zu lassen … Einige Clienten sind bezüglich der Kleidung ja recht heikel – außerdem ist für demnächst ein Photograph in die Schule bestellt worden, um meine Classe für die Ewigkeit festzuhalten … Und da wollen wir doch schließlich alle schön aussehen, nicht wahr?“, mit Sicherheit lächelte er bei diesen letzten Worten, aber das konnten die Studenten ja nun nicht mehr sehen. Als er bereits außer Sichtweite war, fügte er hinzu: „Für die Bezahlung ist jedenfalls schon gesorgt. Alles weitere dann in meinem Bureau …“
Gustav und Ernst Klimt wären am liebsten vor Scham im Boden versunken. Gott sei Dank war nur Franz Matsch stummer Zeuge dieser peinlichen und zutiefst erniedrigenden Situation. Aber sie wußten, daß ihr Professor recht hatte. Es hatte schließlich einmal gesagt werden müssen. Zudem wußten sie auch, daß er es nur gut mit ihnen meinte. Des öfteren hatte er davon gesprochen, wie wichtig die Kleidung sei. Auch bei einem Künstler. Gerade bei einem Künstler. Dieser sollte sich durch seine Kleidung von der Masse absetzen. Von den Normalsterblichen. Sozusagen. In London und in Paris herrschte zur Zeit der Dandy-Look. Ein exaltierter Ästhetizismus. Mit weiten Hosen. Und üppigen Seiden-Foulards. Mit Nadelstreif. Und goldener Krawatten-Nadel. Mit goldener Taschenuhr. Und der dazu passenden Kette. Aber extralang, bitte! Und nach Möglichkeit auch noch zweifarbig abgesetzte Halbschuhe. Mit Budapester Lochmuster. Ganz so weit ging man hier denn doch nicht. In Wien. Denn das war ja schließlich reinste Stoff- und Materialverschwendung. Hier schätzte man es eben gediegen. Schlicht. Aber höchst qualitätvoll. Daran wurde man schließlich gemessen. An der Kleidung erkannte man nicht nur den Beruf. Und das Vermögen. Sondern auch den gesellschaftlichen Stand. Deshalb konnte man mit der Wahl seiner Kleidung ein Signal setzen. Und das Signal, das die beiden Klimt-Brüder zur Zeit mit ihrer Kleidung aussendeten, lautete nunmal: „Wir sind bettelarm. Wie Kirchenmäuse!“. Laufberger hatte völlig recht. Ohne den passenden Anzug, wurde man einfach nicht ernst genommen. Vor allem hier in Wien. Denn hier galten feste Regeln. Und eine davon lautete: Kleide dich besser. Als du bist. Kleider machen ja. Bekanntlich. Leute.
So standen sie also. Bald nach 14 Uhr. Vor dem Palais Sturany. Am Schottenring №21. In ihrer abgetragenen Kleidung. Vor den beiden Ikonen der Theaterarchitektur. Ferdinand Fellner. Und Hermann Helmer. Wahre Berühmtheiten. Und das nicht nur in Österreich-Ungarn. Doch die beiden hatten keine Augen für die abgetretenen Schuhe der Klimts. Und erst recht nicht für ihre durchgewetzten Hosen. Die Klimts aber achteten sehr wohl auf die Kleidung ihrer zukünftigen Brotgeber. Welch Eleganz! Falls es überhaupt Dandys in Wien gab, außer Makart natürlich, dann gehörten diese beiden ganz sicher dazu. Und sympathisch waren sie ihnen auch. Richtige Künstler waren es! Ja. Wirklich imposant erschienen die beiden ihnen. Zudem nobel. Und witzig. Eine seltene Melange.
„So …“, Ferdinand Fellner rieb sich die Hände, „Sie sind also die verheißungs-vollen jungen Talente, welche schon bald in die Fuß-Stapfen ihres Meisters trethen werden …“
Die drei nickten. Und Laufberger. Der lächelte milde.
„Nun, Ferdinand …“, fügte Hermann Helmer hinzu, „Offensichtlich sind sie es bereits, denn sonst stünden sie ja wohl kaum hier!“
Gustav Klimt, der wie immer keinen Ton herausbekam, ging beinahe über vor Bewunderung für diese beiden Herren. Sie waren der lebende Beweis für ihn, daß es richtig war, sich zusammenzutun. Einer allein hätte es wohl kaum so weit gebracht. Aber zu zweit, da gehörte ihnen die ganze Welt. Zumindest Österreich-Ungarn. Samt Kronländern. Und Deutschland. Und der Balkan. Aber das war ja auch schon was. Nämlich halb Europa. Deshalb war es ihm die größte Ehre, für diese beiden lebenden Legenden tätig sein zu dürfen. Und er würde sein Bestes geben.
„Also, die Herren, gehen wir es an!“, sagte Fellner, während sie das Palais betraten und die breite Treppenflucht hinaufstiegen. Ins Piano Nobile. Wo sich der Salon befand. Beziehungsweise. Der Sitzungssaal. Welcher von den drei Studenten auszustatten war. Der Hausherr selbst, K.u.K. Hofbaumeister Johann Sturany, war bei dieser Begehung anwesend.
„Sie hätten dann insgesamt vier Plafond-Bilder für diesen Salon hier auszuführen …“, fuhr Fellner fort, „Dabei wird es sich nicht etwa um Plafond-Malerei handeln, also Frescos, wie Sie ja vermuthlich bereits gehört haben, sondern um gewöhnliche Staffel-Bilder auf Leinwand …“
„Die vier von Ihnen auszuführenden Öl-Gemälde, werden dann, nach ihrer Ausführung, vor Ort zugeschnitten- und auf den Plafond cachiert werden“, ergänzte Helmer, „Diese Panneaux, werden dann in die Winkel des Plafonds hier eingelassen …“, er deutete vage auf die Ecken der Decke, „und anschließend mit Stuck-Rahmen versehen …“
„Jawohl“, hakte nun wieder Fellner ein, „Machen Sie uns irgendetwas Allegorisches, wenn Sie so freundlich sein würden. Lassen Sie sich etwas einfallen! Sie sind diesbezüglich völlig frei … Doch zuvor werden Sie mir, sowie dem hoch-verehrten Hofbaumeister Sturany, wie alle anderen Künstler auch, detaillierte Aquarell-Studien vorlegen. Und dann sehen wir weiter …“
„Und vergeßen Sie bitte nicht …“, meldete sich nun auch der Bauherr selbst zu Wort, „Es handelt sich bei diesem, meinem, Palais um ein neu-barockes Bauwerk … Also arbeiten Sie gefälligst dementsprechend!“
„Das versteht sich von selbst!“, entgegnete Franz Matsch knapp. Und es klang ziemlich vorlaut.
‚Woher nimmt er nur all das Selbst-Bewußtsein?‘, dachte Gustav Klimt, ‚Zumal in derart jungen Jahren?!‘
Aber er selbst sollte sich sein Leben lang mit Menschen umgeben, die vor lauter Selbstbewußtsein nur so strotzten. In ihrem Kreise fühlte er sich ganz einfach sicherer.
„Nun denn …“, Fellner rieb sich erneut die Hände, als sie wieder unten waren, und er wirkte dabei eher wie ein gewiefter Geschäftsmann denn als ein versonnener Künstler, „Sie haben, sagen wir … eine Woche … oder …“, er warf seinem Associé einen fragenden Blick zu.
„Sagen wir eher … drei Tage!“, berichtigte dieser ihn, „Jedenfalls gilt bei uns stets die güldene Regel: Je eher, je beßer!“
„Und denken Sie daran …“, Fellner setzte plötzlich eine bedeutungsschwangere Miene auf, „Von diesem Auftrage hier hängt für Sie so einiges ab! Erfüllen Sie diesen nehmlich zu unserer vollkommenen Zufriedenheit …“
„So dürfen Sie sich weiterer Aufträge von unserer Seite gewiß sein!“, komplettierte Helmer seinen Satz. Und damit wurden die drei jungen Männer entlassen.
Noch während der gesamten Droschkenfahrt zurück zur Schule, redete Professor Laufberger ihnen ins Gewissen. Welche Allegorien sich wohl am besten eignen würden. Musik ist immer guth! Tanz auch! Es ist zwar ein Sitzungs-Saal. Wird aber ganz sicher auch als Ball-Saal genützt werden! Er gab ihnen auch Vorschläge bezüglich der Farbwahl. Die sich natürlich mehr nach Anweisungen anhörten. Ausschließlich zarte Töne! Pastell-Töne! Eine ganz und gar späth-barocke Palette! Sehen Sie sich das Belvedere an! Martino Altomonte. Und Carlo Innocenzo Carlone! Die Apotheose des Mars! Da haben Sie einen Vergleich! Et cetera. Et cetera. Et cetera. Und dabei hatte er versprochen, sich nicht einzumischen.
Gustav Klimt hingegen, hörte längst nicht mehr zu. Seine Gedanken kreisten immer noch um diese äußerst merkwürdigen beiden Herren. Fellner. Und Helmer. Was für ein bemerkenswertes Duo! Dachte er. Einer. War die Hand. Des anderen. Der andere. Komplettierte sogar die Rede. Des einen. Sie waren inzwischen längst schon zu einem einzigen Organismus zusammengewachsen. So erschien es ihm. Der eine. Wäre ohne den anderen. Gar nicht mehr denkbar. Und er hatte damit völlig recht. Einer von ihnen. Wäre ohne den anderen. Gar nichts. Sie funktionierten ausschließlich als Duo. Wie die beiden Kritiker. Aus der Muppet-Show. Waldorf. Und Statler. Nur ein Fellner. Oder nur ein Helmer. Wäre wie Laurel. Ohne Hardy. Wie Kaffee. Ohne Milch. Und Zucker. Aber halt. Das waren dann ja schon drei Ingredienzien. Genauso wie bei ihnen selbst. Gustav. Ernst. Und Franz. Sie wollten es ganz genauso halten. Und doch sollten zwei von ihnen bald schon vergessen werden. In Wien. Nicht allzu sehr. Aber im Ausland. Völlig.
Nachdem die Aquarellstudien – tatsächlich nach nur drei Tagen – vollendet worden waren (Laufberger hatte ihnen dabei natürlich gehörig auf die Finger geschaut!) und sowohl von den Architekten als auch vom Hausherren als geeignet befunden worden waren, machten sich die Gebrüder Klimt und Franz Matsch also an die endgültige Ausführung der vier Plafondbilder für das Palais Sturany. Als Staffelei-Bilder. In Öl. Auf Leinwand. Sie wählten dabei selbstverständlich den neubarocken Stil. Mit kessen weiblichen Allegorien. In blähenden Gewändern. Die in einem blauen Wolkenhimmel schwebten. Ganz nach spätbarocker Manier also. (Wobei der starke Einfluß Laufbergers kaum zu übersehen war.) Gustav Klimt wählte die ‚Allegorie der Musik‘ als Sujet. Ernst Klimt die ‚Allegorie des Tanzes‘. Und die ‚Allegorie des Theaters‘ sowie jene der ‚Poesie‘, bewerkstelligte Franz Matsch. Gustav Klimt personifizierte die Musik durch die Muse Euterpe. Welche nach ihrer Anbringung hoch über dem Betrachter schweben sollte. Diesen Eindruck des Schwebens, der Schwerelosigkeit, untermalte er durch die sich im Winde aufbauschende Kleidung. Ganz und gar. In barocker Manier. Dennoch stellte er sie mit nacktem Oberkörper dar. Womit ihre entblößte, schön gerundete Brust zum Vorschein kam. Denn ein wenig Spaß sollte man bei der Arbeit schon auch haben. Fand er. Als Attribut versah er seine Allegorie der Musik mit einem antiken Musikinstrument. Seine Muse spielte die Doppel-Aulos. Während Ernst Klimt seine Allegorie des Tanzes mit einem Tambourin versah. Franz Matsch, der sich gleich zwei der vier Arbeiten zugesichert hatte, unterstrich damit seine vermeintliche Vormachtstellung in diesem Trio. Noch war es so. Und dennoch. Gustav Klimts Darstellung wirkte um einiges überzeugender als die der anderen beiden. Während jene nämlich, aufgrund ihrer allzu manierierten Schrittstellung, etwas instabil wirkten, entfaltete sich Gustav Klimts Muse majestätisch und frei im unendlichen Raume. So wie er selbst. Es in einigen Jahren ebenfalls tun sollte.
Nachdem die vier Deckengemälde vollendet und im Palais Sturany abgeliefert worden waren, ließen Fellner und Helmer die drei jungen Burschen in ihrem Architekturbüro vorstellig werden. Man rechnete von Seiten der Studenten mit einer reinen Formalität. Mit Lob. Oder gar mit einem Empfehlungsschreiben. Sowohl von Seiten der Architekten. Als auch von Seiten des Bauherren. Der scheinbar mit ihrer Arbeit überaus zufrieden war. Aber es sollte völlig anders kommen. Denn die beiden Architekten hielten Wort. So war das eben. In diesen Tagen. Ein Wort. War ein Wort. Es zählte. Ganz genauso. Wie ein schriftlicher Vertrag. Denn nun sollte die Ateliergemeinschaft, die Compagnie, als Institution noch gar nicht gegründet, ihren zweiten selbstständigen Auftrag erhalten. Und zwar von keinen geringeren. Als eben wieder von Fellner und Helmer.
„Meine Herren!“, Fellner erhob sich, um jedem einzelnen von ihnen die Hand zu reichen, „Bitte nehmen Sie doch Platz! Café?“
„Ja, bitte!“ und: „Für mich bitte mit Milch und Cucker!“. Die Zeit des stummen Nickens war also vorbei. Ihr beginnender beruflicher Erfolg verschaffte ihnen nun das nötige Selbstwertgefühl. Die drei strotzten nur so vor jugendlichem Selbstbewußtsein. Außer Gustav Klimt. Der blieb nach wie vor still. Und hielt sich im Hintergrund. Dennoch beobachtete er stets alles ganz genau. Man hat einen anderen Blick für die Dinge. Wenn man sie als Außenstehender wahrnimmt. Meinte er.
„Und schon wartet der nächste Auftrag auf Sie!“, kam Helmer gleich zum Punkt, „Nehmlich in einem unserer hoch-geschätzten Kron-Länder, im Königreiche Böhmen …“
„Sie werden dort, in Carlsbad, ein Plafond-Gemälde für den Concert-Saal im neuen Cur-Salon anfertigen“, fuhr Fellner fort, „Und zwar mit dem klingenden Titel ‚Die Musik der Nationen‘!“
Die drei ließen ihrer Freude darüber freien Lauf. In Karlsbad! Ausgerechnet! Dem nobelsten Kurort Europas. In diesen Tagen. Wo sie sich alle ein Stelldichein gaben. Gekrönte Häupter. Millionäre. Künstler. Eben alle. Die es zu etwas gebracht hatten. Wenn das mal kein prestigiöser Auftrag war!
„Wir haben soeben erst, per Dépêche, den officiellen Auftrag erhalten, im Carlsbader Cur-Park nicht nur einen Concert-Saal, sondern auch eine daran angrenzende Gast-Stätte zu errichten!“, sagte Helmer und erhob sich, um eine Pergamentrolle vom Nebentisch zu holen, „Guth, hierbei handelt es sich lediglich um die aller-ersten Entwürfe dazu – aber Sie können bereits sehen, daß es ein respectabler Monumental-Bau wird, der an allen vier Ecken von Kuppeln bekrönt sein wird. Der Saal selbst wird mit einem Tonnen-Gewölbe ausgestattet werden, welches wiederum mit ganzen sechs monumentalen Plafond-Bildern decoriert werden soll …“
Die drei vertieften sich ganz in den Architekturentwurf.
„Und damit kommen nun Sie ins Spiel, meine Herren!“, sagte nun wieder Fellner, „Und keine Sorge – diesmal haben Sie auch etwas mehr Zeit dafür!“, er lächelte, „Schließlich haben wir ja erst October – und die Plafond-Bilder können nicht vor dem kommenden Frühjahr angebracht werden …“
„Sie sind auch diesmal wieder völlig frei …“, begann Helmer.
„Abgesehen natürlich vom gestrengen Blicke Ihres Meisters!“, unterbrach Fellner ihn lächelnd.
„Doch Sie sollen, so will man es nehmlich, romantische Scenen schaffen!“, fuhr Helmer unbeirrt fort, „Hier ein tanzendes Paar in slawischer oder ungarischer Tracht, dort eine malerische Landschaft mit einem Stalle, oder, beßer noch, mit einer Schafs-Hütte … Dann tanzende Italiener, natürlich äußerst lebhaft, wie sie nun mal so sind … Ferner eine Andacht vor dem Gnaden-Bilde der Mutter Gottes, um das alles wieder zu beruhigen … Daneben das einfache und pittoreske Dorf-Leben – am besten an einem Fluß-Ufer – gefolgt von Freunden auf der Jagd. Et cetera. Et cetera. Et cetera. Sie wissen schon …“
„Halt die üblichen Clichées!“, führte Fellner lächelnd weiter aus, „Geben Sie den Leuten, was sie sehen wollen! Malen Sie, was die Seele verlangt! Was das Herz begehrt! Wir müssen die Menschen zum Träumen verführen, zumal in einem Concert-Hause, zumal in einem Cur-Park, wo sich ja nicht wenige der Gäste durch das Curen eine Linderung ihrer Leiden und sonstiger Weh-Wehchen erhoffen. Und auch die anderen, denen es an nichts ermangelt, kommen nach Carlsbad, um zu sehen und um gesehen zu werden.“
„Wir haben uns das so gedacht …“, wies sich Helmer als der eigentliche Pragmatiker aus, „Sie erschaffen uns sechs monumentale Plafond-Gemälde mit je zwei auf sechs Metern Größe …“
Zwei mal sechs Meter! Die drei tauschten irritierte Blicke aus. Etwas in dieser Größe hatten sie zuvor noch nie in Angriff genommen.
„Nun, Meister Laufberger wird Ihnen natürlich noch ganz genau erklären, wie so etwas functioniert!“, fügte nun Fellner hinzu, „Die Plafonds werden sehr hoch sein – und zwar um einiges höher als im Palais Sturany! Also müssen Sie dies bei Ihren Ausfertigungen auch unbedingt beachten! Winzige Détails, wie zum Beispiel güldene Schuh-Schnallen oder Ohr-Gehänge, werden bei dieser schieren Höhe natürlich nicht mehr sichtbar sein – was aber nicht bedeutet, daß Sie auf derartige Détails verzichten dürfen! Denn das menschliche Auge nimmt weitaus mehr wahr, als man zu glauben meint! Aber ich bin sehr zuversichtlich, daß Sie dies auch thatsächlich bewerkstelligen können. Schließlich sind Sie ja bei Meister Laufberger in aller-besten Händen …“
„Diese zwei auf sechs Meter großen Gemälde sind bitte in Leim-Farbe auszuführen!“, hakte Helmer wieder nach, „Und bedenken Sie unbedingt die großen Themen, denn es geht hier schließlich um die Musik! Und zwar: Tanz-Musik, Volks-Musik, Hochzeits-Musik, Religiöse Musik, Jagd-Musik, et cetera. Und nicht nur die böhmische oder die österreichische, sondern auch zum Beispiel die italienische – also international, bitte! Eben ‚Die Musik der Nationen‘…“
Obwohl die drei Kunststudenten noch viel Zeit für diese Ausführungen hatten, machten sie sich gleich an die Arbeit. Sie legten ihr ganzes Herzblut hinein. Zum ersten Mal. Hatten sie einen öffentlichen Auftrag erhalten. Zumal einen. In dieser Dimension! Im darauffolgenden Jahre schon, Anno 1881, wurde der Konzertsaal im Karlsbader Kurpark feierlich eröffnet. Die sechs Deckenbilder fielen dermaßen grandios aus, daß nicht nur jeder davon sprach, sondern daß die Theaterarchitekten Fellner und Helmer die drei angehenden Künstler auf weitere Jahre immer wieder beschäftigen sollten. (Und dennoch. Wurde der Konzertsaal später abgerissen. 1966. Während der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Unter der Knute Moskaus. Ein Verbrechen an der Kunst. Ein Verbrechen an der Menschheit. Aber typisch für die späten sechziger Jahre. So kurz vor der Mondfahrt. War man schließlich fortschrittlich. Und modern. Koste es. Was es wolle. Da hatte man für all diesen „alten Kram“ keinerlei Sinn mehr. Nur eine Handvoll Schwarz-Weiß-Photographien. Bezeugen die sechs Gemälde. Der Compagnie. Wo sie allerdings hingekommen sind. Weiß kein Mensch. Vermutlich nach Moskau. Oder anderswohin. In der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken. Wie so vieles andere auch.)
So lukrativ diese Verdienstquelle auch sein mochte – noch genügte sie nicht, um die gesamte Familie zu ernähren. Zumal eine achtköpfige. Und es sollte auch noch einige Jahre andauern. Die finanzielle Lage besserte sich zwar ein wenig ab diesem Jahre, weil ja Gustav und Ernst in ihrer Freizeit (die immer sporadischer bemessen war) Portraits nach Photographien fertigten und so ihre Familie, vor allem den Vater, unterstützen und entlasten konnten, aber man war noch weit davon entfernt, ein angenehmes und sorgenfreies Familienleben zu führen. Ganz im Gegenteil sogar. Nachdem man sich an die beengende Einzimmer-Behausung in der Neubaugasse №5 leidlich gewöhnt hatte, mußte die Familie plötzlich mit Sack und Pack wieder ausziehen. Vier ganze Jahre sollte man nun in einer schäbigen Dachbodenwohnung leben, da die Familie Klimt sich in ihrer Armut nichts Besseres leisten konnte. Es handelte sich nicht einmal wirklich um eine Wohnung. Sondern eher um ein mehr schlecht als recht zusammengezimmertes und ausgebautes Dachgeschoß. Eines ehemaligen Klosters. In der Mariahilferstraße №75.
Im Sommer war es hier oben unerträglich heiß. So heiß. Daß man gar nicht schlafen konnte. Und im Winter war es wiederum eiskalt. Denn es gab hier oben nicht einmal einen ordentlichen Kamin. (Kein Wunder, denn es war ja alles aus Holz!) Nur einen kleinen, gußeisernen Standofen. Den die beiden Brüder gemeinsam mit dem Vater eingebaut hatten. Was nicht ungefährlich war. Und deshalb verboten. Nicht nur wegen all des Holzes drumherum. Sondern vor allem wegen des Rauchs. Viele Menschen starben damals daran. Viele ärmere Menschen vor allem. An Kohlenmonoxid-Vergiftung. Der Standofen war also mehr Zierde (und ein psychologischer Wärmespender) als daß er wirklich etwas nützen konnte. Während der klirrend kalten Wiener Winter. Zumal in einem Dachgeschoß. Also war diese Wohnung so gut wie gar nicht ausheizbar. Eine eigene Wasserleitung gab es ebenfalls nicht. Die hatte man erst gar nicht bis hier hinauf verlegt. Wozu auch? Auf einen Dachboden? Eines Klosters? Man hatte also nicht einmal ein Bad. Jeden Tag mußte man hinabsteigen. Ins letzte Geschoß. Um sich dort am Bassin sein Wasser zu holen.
Vor allem Gustav und Ernst belastete dies alles sehr. Denn es bildete einen allzu starken Kontrast. Zu dem. Was sie tagsüber waren. Und taten. Zu den edlen und bedeutenden Menschen. Die sie tagsüber trafen. Laufberger. Eitelberger von Edelberg. Sturany. Fellner. Und Helmer. Und Makart. Vor allem Makart! Wenn der sie so sehen könnte! Sie schämten sich in Grund und Boden. Wenn sie dann am Abend heimkamen. Zu ihrer Familie. War es wie das Märchen vom Aschenbrödel. Das mit seiner goldenen Kutsche und den prächtigen Kleidern zum Ball fährt. Doch am Abend. Nach dem Ball. Sobald es wieder heimkommt. Da verwandelt sich die goldene Kutsche plötzlich wieder. In einen schnöden Kürbis. Und die majestätischen sechs Schimmel. Welche die Kutsche vorhin noch so stolz gezogen. Werden plötzlich zu Mäusen. (Und davon gab es in der Tat zuhauf. Hier oben. Auf dem Dachboden.)
Umso wichtiger war und wurde das, was sie tagsüber taten. All das Schöne. Mit dem sie sich umgaben. Umgeben durften. Es hätte auch wahrlich anders kommen können. Ganz anders sogar. Denn schließlich gab es sehr viele junge Burschen in ihrem Alter. In Wien. In diesen Tagen. Vor allem in den Vorstädten. Die bloß herumlungerten. Die gar keine Schuhe hatten. Denen die Zähne fehlten. Und der Magen knurrte. Die sich aufs Betteln verlegten. Oder gar aufs Stehlen. Um überhaupt irgendwie durchkommen zu können. Zudem gab es auch genügend Künstler. In diesen Tagen. Und gute sogar. Die glatt verhungerten. Nur ein einziger Faktor hätte nicht mitspielen brauchen. Und schon wäre alles dahingewesen. Nur ein ganz kleines bißchen weniger Talent. Oder die Ablehnung eines Stipendiums. Oder kein Erlaß des Schulgeldes. Oder ein etwas weniger engagierter Professor. Zumal einer. Der nicht so gut vernetzt war. Dies alles waren Faktoren. Welche doch eher vom Glück bestimmt wurden. Denn darauf hatte man selbst wohl kaum einen Einfluß. Selbst auf sein Talent nicht. Denn das ist gottgegeben. Aber das Schicksal meinte es gut mit ihnen beiden. Mit einem von ihnen. Zumindest.
Aus diesem Grunde stürzten sie sich auch förmlich auf die Malerei. Denn bis dahin hatten sie ja nur zeichnen dürfen. Und die Zeichnung. Die war bloß der kleinere Bruder. Der Malerei. (Und der billigere Bruder vor allem!) Die Malerei hingegen, war die Königsdisziplin der bildenden Künste. Und zog die drei ungemein an. Denn man war eher Künstler. Wenn man sich Maler nennen durfte. Als wenn man bloß Zeichner war. Künstler zweiter Klasse. Wenn nicht gar dritter. Die Zeichner waren ja meist nur Handlanger. Für Dekorateure. Oder Architekten. Oder eben Maler. In diesen Tagen. Nachdem sie in der Fachklasse für Malerei nun schon ein Jahr lang die Theorie studiert hatten, sowie die Materialkunde erlernt und ausschließlich Übungsbilder hatten anfertigen dürfen, um den richtigen Umgang mit Ölfarbe zu trainieren, einem äußerst heiklen Material, entstanden in diesem Jahr ihre ersten richtigen Gemälde.
Als Modell gab es an diesem Tage ein junges Mädchen. Und so setzte sich das Mädchen artig auf einen Thonet-Stuhl. Mit seinem bordeauxfarbenen Wams aus Samt. Und seiner geklöppelten, schneeweißen Spitzenbluse. Das dunkle Haar streng nach hinten gebunden. Was sie ein wenig älter machte. Gustav und Franz setzten sich ebenfalls. Nebeneinander. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Im Grunde war es sogar bemerkenswert. Ausgesprochen gut. Vollkommen identisch. Denn das war ja auch die Aufgabe gewesen. Und zudem sehr gefragt. Beziehungsweise ein Muß. An der Kunstgewerbeschule. Zumal bei Professor Laufberger. Da zählte ausschließlich die uniforme, gleichbleibende Qualität. Nicht etwa irgendwelche hochtrabenden, künstlerischen oder gar individualistischen Kapriolen. Wie drüben. An der Kunstakademie.
Doch wenn man etwas näher hinsah, dann offenbarte sich doch ein Unterschied. Der klein war. Aber fein. Denn Franz Matsch, der zweifelsohne der bessere Techniker war, arbeitete überaus detailversessen. Da brauchte man sich nur einmal die Wimpern bei seinem Mädchen-Portrait anzusehen. Bei seinem Kollegen Gustav Klimt hingegen, beginnen die Konturen zu verschwimmen. Obwohl dies eigentlich erst viel später typisch für ihn werden sollte. Erst in rund zwanzig Jahren. Also gegen 1897. Beziehungsweise 1898. Als er endlich zu einem eigenen Stil finden sollte. Der ihn über Nacht berühmt machen würde. Und unsterblich.
Natürlich fand er diese jungen, zumal völlig angekleideten, Modelle fad. Urfad sogar. Allzu gern hätte er doch endlich einmal entblößte Frauen gemalt. Nackte. Barbusige. Lasterhafte. Laszive. Fatale. Schwarze. Blonde. Brünette. Rote. Ja. Vor allem Rote! Aber das würde noch kommen. Und zwar schneller als gedacht. Bereits in diesem Jahr. Sollte er sein erstes weibliches Aktmodell malen. Das jedoch fast schon verschämt wirkt. Nach rechts gewandt. Also im Profil. Mit nervös verschränkten Händen. Die Umrißlinie bei diesem Akt zog er außerordentlich scharf. Nachdem er für die allzu weiche Kontur des Mädchen-Bildnisses einen Rüffel von Laufberger kassiert hatte. Und doch brachte es ihm erneut Kritik von Seiten Laufbergers ein. Denn diesmal war die Kontur viel zu scharf ausgefallen. Fast schon kantig.
Nichtsdestotrotz gab es Aktmodelle nur äußerst selten an der Kunstgewerbeschule. Und selbst die wenigen Photographien von Aktmodellen, die unter den Studenten kursierten (und überdies hoch gehandelt wurden!), waren diesbezüglich kaum befriedigend. Und so verlegte sich Gustav Klimt also auf das Malen angekleideter Menschen, weshalb in diesem Jahre zahlreiche Portraits entstanden, die erstaunlich qualitätvoll ausfielen, zumal es ja seine allerersten waren. Und wenn es denn ab und an einmal Modelle an der Schule gab, dann ausschließlich männliche, denn Frauen war diese Tätigkeit damals an den Schulen und Akademien untersagt. Die Schüler und Studenten mußten also privat dafür sorgen, wenn sie eine nackte Frau malen wollten. Weshalb sie sich also alle zusammentaten, um den horrenden Preis bezahlen zu können. Ein wenig war es schon wie Prostitution. Fand Gustav Klimt. Und er wollte sich diesen Luxus eines Tages leisten. (Nicht den der Prostitution. Sondern ersteren.) (Wobei beides oft Hand in Hand ging.)
Ja. Diesen Luxus wollte er sich leisten. Und er sollte dies auch tun. In rund zwanzig Jahren. Als er mit seinen Bildern sehr viel Geld verdienen sollte. Das meiste davon, würde freilich just für seine Modelle draufgehen. Denn es waren wirklich seine Modelle. Er würde sich dann sogar den Luxus eigener Modelle leisten können. Die ihn ständig umgeben sollten. Und die im Grunde permanent in seinem Atelier anzutreffen waren. Sogar mehrere. Und zwar gleichzeitig. Alle im Hinterzimmer. Verborgen. Aber immer bereit. Wenn er sie brauchte. Nur ein männliches. Sehr muskulös. Die anderen ausschließlich weiblich. Schwarze. Blonde. Brünette. Rote. Ja. Vor allem Rote! Und die waren schwer zu finden. (Und das nicht nur in jenen Tagen.)
Nicht nur, daß er später einen Großteil seines Einkommens für die Bezahlung seiner Modelle verwenden sollte. Zusätzlich sollte er ihnen, großzügig wie er nun mal war, auch immer wieder das eine oder andere zustecken. Sogar in die Oper und ins Theater sollte er sie manchmal mitnehmen. Und ins Restaurant sowieso. Denn er hatte Mitleid mit ihnen. Schließlich waren sie ja allesamt gefallene Mädchen. Die keine andere Perspektive hatten. Die keinen anderen Trumpf in ihrem Ärmel hatten. Außer ihrer Schönheit. Doch die war ja bekanntlich vergänglich. Und was dann? Aber es waren wilde Mädchen. Mädchen von der Straße. Oft waren sie krank. Todkrank. Nämlich syphilitisch. Und das sah man ihnen ja schließlich nicht an. (Zumindest nicht im Anfangsstadium.) Das Verkaufen ihrer Körper gegen bare Münze hatte sich jedenfalls nicht bezahlt gemacht. Zumindest nicht für sie selbst. Sie lebten zumeist sehr kurze Leben. Schlechte Leben. Nackte Leben. Sündige Leben. Wie im Rausch. Und genau dies sollte Gustav Klimt auch später in seiner Kunst festhalten.
Oft wurde er von ihnen ausgenutzt. Ständig benötigte man Geld für dies und das. Vor allem fürs Begräbnis. Denn das funktionierte schließlich immer. Das Drücken. Auf die Tränendrüse. Und der Klimt, der war nah am Wasser gebaut. Das wußten alle. Vor allem seine Modelle. Da war dann plötzlich der Vater der einen gestorben. Oder die Mutter der anderen. (Und erst als der Vater der einen zum zweiten Mal gestorben war, und die Mutter der anderen zum dritten Mal, da fiel es auf.) Aber Gustav Klimt war es herzlich egal. Auch das Geld war ihm herzlich egal. Denn mit Geld konnte er absolut nicht umgehen. Schließlich hatte er es nie gelernt. Er war der Meinung, das Geld sei ausschließlich dazu da, um ausgegeben zu werden. Und um anderen damit eine Freude zu machen. (Das klingt verdächtig nach Klischee. Und doch ist es bezeugt. Sogar schriftlich. Und zwar von keinem geringeren. Als von ihm selbst.)