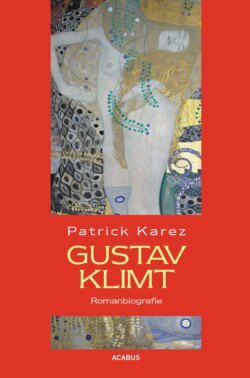Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 6
2
ОглавлениеDer Weg zur Wiener Volks- und Bürgerschule, die er nunmehr seit sechs Jahren besuchte, gefiel ihm sehr. Immerzu gab es etwas Neues zu sehen und zu entdecken. Und immerhin war es besser als daheim. Falls man überhaupt von einem Daheim sprechen konnte. Denn an seinem ursprünglichen Zuhause, in der Linzer Straße № 247, wohnten sie längst nicht mehr. Als er fünf Jahre alt wurde, mußte die Familie von dort ausziehen. Immerhin nach Wien hinein. Nämlich in die Lerchenfelderstraße. Dort blieben sie aber nur kurz. Und nur wenig später. Ging es in die Neubaugasse №5.
An Baumgarten, in der Wiener Vorstadt, wo er geboren ist, konnte er sich kaum mehr erinnern. Es war weit draußen gewesen. Vor den Toren der Stadt. Praktisch auf dem Lande. Grün war es gewesen. Mit hohen Bäumen. Und Gärten. Das wußte er noch. Hier in der Stadt, war längst alles verbaut. Nicht umsonst hieß er Wien-Neubau. Der VII. Wiener Gemeinde-Bezirk. Man hatte sich der Sache also angenähert. Der Stadt Wien. Dem Centrum. Immerhin. Lebte man nicht mehr in Baumgarten. Bei Wien. Sondern in Neubau. In Wien. Wo die Häuser, die man in jenen Tagen errichtete, gut fünfmal so hoch waren wie jene in Baumgarten. (Dort waren sie nämlich nur ebenerdig.) Es hatte ihn also hinaufbefördert. Von der Vorstadt. In die Stadt. Die zwar nicht die Innere Stadt war. (Also Wien I.) Aber immerhin die Stadt. (Nämlich Wien VII.) Theoretisch eine Verbesserung. Theoretisch.
Von der Neubaugasse №5 war es nicht weit bis zur Stadtmitte. Nach Wien I. Das richtige Wien. Ein Katzensprung bloß. Nur einige Häuserblocks weit entfernt. Natürlich erlaubte die ängstliche Mutter es den Kindern nicht, allein „in die Stadt“ zu gehen. Und sie taten es dennoch. Immer. Und immer wieder. Zumindest versuchten sie es. Weit kamen sie meistens nicht. Zunächst tasteten sie sich an das Glacis heran, wo in diesen Tagen die große Ringstraße angelegt wurde. Ein heilloses Chaos. Ganz Wien stand im Umbruch. Denn es waren ja die Gründerzeitjahre. Die riesigen Baustellen, die nicht allzu weit von ihrem Haus entfernt lagen, interessierten die Kinder natürlich brennend. Vor allem Gustav. Und seinen jüngeren Bruder. Ernst. Die waren wie magisch angezogen davon. Und sie waren ausgezogen. Um die Mutter das Fürchten zu lehren. Schritt. Für Schritt. Machten sie sich auf. Und davon. Und aus dem Staub. Beziehungsweise mitten hinein. Nämlich in die Groß-Baustelle.
Die alten Stadtmauern der Reichshauptstadt waren bereits im Jahre 1857 niedergelegt worden. Das war nur fünf Jahre vor Gustav Klimts Geburt. So ein garstiges und trotziges Mauerwerk. Aus alten Zeiten. War in diesen Tagen nicht mehr modern. So ein Bollwerk. Gegen den Feind. Das übrigens gleich zwei Türkenstürmen standgehalten hatte. Also wurde es nun im Eiltempo geschleift, wie andernorts in Europa auch, um an seiner statt eine Prachtstraße anzulegen. Einen Pracht-Boulevard. Einen Grand-Boulevard. Ganz nach Pariser Vorbild. Und da die alte Stadtmauer nun einmal einen kreisrunden Ring um das historische Zentrum gebildet hatte, wurde auch der Pracht-Boulevard ringförmig. Weshalb man ihn also Ringstraße nannte. Der Einfachheit halber. Wurde bereits ein Jahr später mit ihrem Bau begonnen. Seither teilte sich die Reichshauptstadt Wien in neun Bezirke auf. Die Vororte, wo auch Gustav Klimt geboren war, blieben freilich von der Stadt isoliert. Dazwischen. Also zwischen Stadt. Und Vorstadt. Verlief der sogenannte Linienwall. Kreisförmig, beziehungsweise halbkreisförmig, um die inneren neun Bezirke gelegt. Denn von Osten her bildete die Donau, beziehungsweise der Donau-Canal, eine natürliche Grenze. Und somit Schutz. Im Angriffsfall.
Nicht die Ringstraße. Sondern dieser Linienwall. War die eigentliche Grenze. Zwischen Stadt. Und Land. Zwischen Bürger. Und Ländler. (Beziehungsweise Vorstädter. Was ja noch schlimmer war.) Zwischen Arm. Und Reich. Zwischen Gut. Und Böse. Schon der Unterschied von der Ersten Stadt, also der historischen Innenstadt, zu den anderen Bezirken, die rundherum angelegt worden waren, war beachtlich. Aber der Linienwall, stellte eine weitaus größere und bedeutsamere Grenze dar. Alles was außerhalb des Linienwalls lag, gehörte nicht mehr zu Wien. Und konnte somit im Notfall nicht verteidigt werden. Also war der Linienwall auch eine Grenze zwischen Krieg. Und Frieden. Zudem war ab dem Jahre 1829 eine sogenannte „Verzehr-Steuer“ erhoben worden. Und zwar auf alle Lebensmittel, die just über diesen Linienwall in die Stadt gebracht wurden. Ein Grenzposten also. Wie zu einem ganz anderen Reich. Und dementsprechend war auch der Unterschied. Zwischen Innen. Und Außen. Erst im Jahre 1899 wurde diese Steuer wieder aufgehoben – und drei Jahre später, Anno 1902, erfolgte schließlich und endlich die offizielle Eingemeindung der Vororte. Nun gehörte man also hochoffiziell zu Wien dazu. Endlich. War man nicht mehr „die da drüben“. Außerhalb der Reichshauptstadt. Sondern „waschechte Wiener“. Und es gab da noch einen weiteren Nebeneffekt. Durchaus beabsichtigt. Wenn nicht gar erst der Antrieb für dieses ganze Unterfangen: Durch die Eingemeindung der Vororte nämlich, wurde Wien über Nacht zur Millionen-Metropole. (Was zu dieser Zeit natürlich als „très chic“ galt. Beziehungsweise als „très moderne“.)
Sie hatten es also geschafft. Die Klimts. Von Draußen. Nach Drinnen. Aus dem Vorort. Jenseits des Linienwalls. In die Stadt. Innerhalb des Linienwalls. In die Reichshauptstadt sogar. Also von Pfui. Nach Hui. Nun gab es da nur noch eine einzige Hürde zu überwinden. Eine allerletzte Grenze. Die allerdings nicht unerheblich war. Und nur sehr schwer zu überwinden. Nämlich die Ringstraße. Wer es bis hier hinein schaffte, der zählte in Wien zu den ganz großen Gewinnern. Der konnte sich nämlich wirklich als „waschechter Wiener“ bezeichnen. Alles andere waren bloß „Zugereiste“. Und dementsprechend wurden sie auch behandelt. Nämlich abschätzig. Zumindest aber, wurden sie sehr kritisch beäugt.
Diese Ringstraße also, beziehungsweise die Groß-Baustelle dazu, übte eine geradezu magische Anziehungskraft auf die beiden jungen Burschen aus. Haus. Um Haus. Erkämpften sich Gustav und Ernst Klimt ihre neue Freiheit. (In einem wahren Häuserkampf.) Wie frisch geschlüpfte Küken. Die sich anfangs nicht allzu weit von ihrem Nest fortwagen. Und die stets vom Muttertier bewacht werden. Der Nestglucke. Mit ihren Argusaugen. (Denn Hühneraugen sind etwas anderes.) Denen nichts entgeht. Dann aber, nach einiger Zeit, wird der Radius der entdeckungsfreudigen und erfindungsreichen Jungküken immer größer. Das ist wichtig. Dachte der junge Gustav. Sonst bleibt man dumm. Und wird somit zur leichten Beute. Seiner Freßfeinde. Die stets und überall lauern. So sagte es zumindest das ängstliche und stets besorgte Muttertier. Die Glucke. Der nichts entging. Nicht die leiseste Regung. Kein Wunder. Bei sieben Kindern. Weshalb er in diesen frühen Jahren die Innere Stadt nur wenig kannte. Dafür aber seinen Bezirk. Und zwar in- und auswendig. Der war ja schließlich sein Zuhause. Deshalb würde er freiwillig nicht mehr von hier wegwollen. Er würde hier sterben. So dachte er. Aber zumindest würde er hier bis zu seinem Tode leben wollen. Und das tat er auch.
Derzeit war es also ihr Zuhause. Beziehungsweise lebten sie hier. Unter schwierigsten Bedingungen. Alle zusammen. Alle Neune. In einem winzigen Zimmer. Im hinteren Teil des Gebäudes. Wo es dunkel und feucht war. Arbeitete der Vater im Hof. Insofern das Wetter es zuließ. Damit die Kinder in Ruhe ihre Schulaufgaben machen konnten. Herinnen. Im Zimmer. In einem Zimmer. Einem einzigen. Für Vater. Mutter. Und sieben Kinder. Aber immerhin. Hatten sie ein Dach über dem Kopf. Noch. Denn es sollte nicht ihre letzte Adresse bleiben. Noch ganze dreißig Jahre lang. Sollten sie herumvagabundieren. Nach diesem letzten Umzug. Bis sie endlich ein feste, endgültige Bleibe finden sollten. Also ein richtiges Zuhause. Dreißig ganze Jahre. Fast bis auf den Tag genau. Der Vater sollte dies leider nicht mehr erleben. Und der Bruder auch nicht. Und die Schwester auch nicht. Dann wäre nurmehr ein letzter, trauriger Troß im Ziel- und Endhafen angekommen. Ein Torso. Von Familie. Nur sechs. Von Neunen. Beziehungsweise nur vier. Von ihnen. Da zwei weitere sich in der Zwischenzeit verselbständigt haben sollten.
Aber dazwischen. Während dieser dreißig Jahre. Während dieser ewig langen, unendlichen, dreißig Jahre, sollten sie immer wieder umziehen müssen. Immer. Und immer wieder. Mit Sack. Und Pack. Mit Kind. Und Kegel. Mit all der Wäsche. Und dem Kochgeschirr. Und den sieben kleinen Kindern unterm Arm. Möbel hatten sie ohnehin keine. Wie Nomaden. Wie Vertriebene. Wie Heimatlose. Wie Obdachlose. Dachte Gustav. Und doch. War das alles bloß ein großer Spaß für ihn. Noch. War es bloß ein Spiel. Denn er kannte es ja nicht anders. Aber später dann. Sollte es ihm peinlich sein. Später dann. Sollte es die Hölle werden für ihn. Ein Albtraum. Ein Trauma. An dem er sein ganzes Leben lang zu leiden hatte. Vor allem wegen seiner Mutter.
Die arme Mutter! Sie tat ihm leid. Schrecklich leid. So hatte sie sich ihr Leben ganz sicher nicht vorgestellt. Als Mädchen. Als Backfisch. Hatte sie noch von einer Karriere geträumt. Von einer Künstler-Karriere sogar! Das hatte sie ihm gesagt. Als Opernsängerin. Auf der ganz großen Bühne. Auf den Brettern. Die die Welt bedeuten. Daraus ist natürlich nichts geworden. Denn oft kommt es eben anders. Im Leben. Erstens. Und zweitens. Als man denkt. Anstatt in der Oper aufzutreten, von den Massen umjubelt und gefeiert, in ein Meer aus Blumen und Applaus getaucht, hatte sie ihren täglichen Auftritt hier. Auf den Brettern. Einer halbverrotteten Ein-Zimmer-Wohnung. Nur wenige Häuserblocks entfernt. Von der Oper. Und von der größten Baustelle Europas. Mit all ihrem Dreck. Und Staub. Den man erst gar nicht zu putzen beginnen brauchte. Denn nur eine Stunde später war er ohnehin schon wieder da. In dieser jämmerlichen und schändlichen Bruchbude. Wo sie Kindermädchen, Wäscherin, Näherin, Köchin und Putzfrau zugleich war. Im falschen Beruf also. Im falschen Film sozusagen. Beziehungsweise. Im falschen Roman.
Der Vater war schuld. Das war Gustav von Anfang an klar. Dieser Vater. Ernst. Ernsthaft. Ganz im Ernst. Dieser Versager ! Dieser Ober-Versager! Schaffte der es nicht einmal, seine Angetraute und seine elende Brut durchzufüttern! Aber Hauptsache Künstler! Er haßte den Vater dafür. Einen einfachen Graveur. Nicht einmal angestellt. Sondern bloß selbstständig. Ohne festes Einkommen. Ohne Schutz. Ohne eine jegliche Sicherheit. Ohne Netz. Und ohne doppelten Boden. Ein einfacher Graveur. Dessen miserables Gehalt bei weitem nicht ausreichte. Zumal für eine Familie. Zumal mit sieben kleinen und unmündigen Kindern. Von wegen Künstler! Hungerkünstler vielleicht! Denn selbst zum Lebenskünstler reichte es nicht. Hatte er denn nicht nachgedacht, bevor er sie alle in diese Katastrophe geführt hatte? Hätte er es sich nicht besser überlegen können? Hätte er es sich nicht verkneifen können? Das eine. Oder andere. Kind? Hatte er schließlich nichts anderes im Kopf als das? Konnte er denn nicht Eins und Eins zusammenzählen? Beziehungsweise Zwei und Sieben? Nein. Er hatte sie alle in diese Bredouille hineingeritten. Dieser Vater. Und der Sohn haßte ihn dafür.
Sogar zu Weihnachten. Hatte es diesmal kein Brot gegeben. Nicht einmal Brot! Geschweige denn Geschenke. Gut. Auf Geschenke konnte man gut und gerne verzichten. Obwohl. Als Kind eher nicht. Aber auf Brot? Zu Weihnachten? Wo andere im fetten Gänsebraten schwelgen? Beziehungsweise im panierten Karpfen?2 Auch da war der Vater schuld. Deshalb haßte der Sohn ihn dafür. Sehr oft. Hatte der Sohn nicht einmal eine Hose zum anziehen. Eine Hose! Die Grund-Ausstattung eines jeden Menschen! So dachte er. Ein Menschen-Recht! Ein Grund-Recht! Aber das hatte er nun mal nicht. Und zwar sehr oft. Mußte er deshalb zu Hause bleiben. Und konnte nicht zur Schule gehen. Sehr oft. Deswegen. Wegen seines unfähigen Vaters. Deshalb haßte ihn der Sohn.
Einzig das Zeichnen. Mit dem Vater. Das war schön. Und es hatte bereits sehr früh begonnen. Eigentlich sobald er denken konnte. Und die Hände bewegen. Und einen Stift halten. Hatte der Vater mit ihm gezeichnet. Der Sohn hatte sich bereits sehr früh im Zeichnen geübt. Denn früh übt sich. Was ein Meister werden will. Der Sohn zeichnete also. Und zwar immerzu. Dank des Vaters. Das immerhin. Hatte der Vater gut hingekriegt. Dachte er. Verbittert. Und das in derart jungen Jahren. Also zeichnete er. Förmlich. Um sein Leben. Er sollte es ja schließlich eines Tages besser haben. Sagte der Vater. Immerzu. Zeichnete er. Und zwar jene Dinge. Die er in der reellen Welt nicht bekommen konnte. Er zeichnete. Um der Realität zu entfliehen. Er zeichnete. Wenn er mal wieder keine Hose zum anziehen hatte. Dann zeichnete er sich eben eine. Und alles war wieder in Ordnung. Im Lot. Beziehungsweise. Auf dem Papier. Beziehungsweise. Auf dem Trottoir. Denn das war billiger. Beziehungsweise. Kostete es gar nichts. Wenn sie kein Brot zu essen hatten. Wie leider so oft. Dann zeichnete er sich eben eines. Und wenn es nur auf dem Trottoir war. Mit einem Stückchen Kohle. Aus dem Keller stibitzt. Erkannte er bereits früh. Die Macht. Der Phantasie. Die Macht. War mit ihm. Und mit ihr. Ließ es sich gut leben. Wenn es in der reellen Welt nicht mehr auszuhalten war. So erschuf man sich eben geschwind eine neue. Eine Phantasie-Welt. Eine Parallel-Welt. Eine Gegen-Welt. Eine Schein-Welt. In welcher alles anders war. Nämlich genau das Gegenteil. Und schöner Schein. Leicht. Und fröhlich. Und reich. In der reellen Welt hingegen. War es schwer. Und traurig. Und bitterarm. Der Vater war schuld! Deswegen haßte ihn der Sohn so sehr.
Es ist die Weltausstellung. Klagt der Vater. Es ist die Mißernte. Klagt der Vater. Es ist der Börsenkrach. Klagt der Vater. Es ist die Finanzkrise. Klagt der Vater. Es ist die Wirtschaftskrise. Klagt der Vater. Es ist die miserable Auftragslage zur Zeit. Klagt der Vater. Aber die Weltausstellung, die Mißernte, der Börsenkrach, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise und die miserable Auftragslage zur Zeit, wie der Vater stets behauptete, waren es jedenfalls nicht. Denn der Sohn konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, daß es ihnen jemals besser ergangen sei. Es stimmte zwar, daß es ihnen jetzt, nach der Weltausstellung, nach der Mißernte, nach dem Börsenkrach, in der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise und aufgrund der miserablen Auftragslage zur Zeit, noch schlechter ging als zuvor. Aber noch schlechter als ohnehin schon schlecht – das machte dann auch keinen großen Unterschied mehr. Ob man nun bloß ein Stückchen Brot für neun Personen auf dem Tisch liegen hat. Oder ein halbes. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Denn Hunger hat man. So. Oder so. Aber ja. Es stimmte. Seit dem großen Börsenkrach, da ging es seiner Familie tatsächlich noch schlechter.
Der Vater konnte seit Beginn der Wirtschaftskrise kaum mehr Aufträge erhalten. Denn wo neue Geschäfte fehlten, da verlangte man auch nicht nach gravierten Schildern. Immerzu machte der Vater die große Weltausstellung dafür verantwortlich. Immerzu. Wie eine defekte Schellack-Platte. Auf einem Grammophon. (Nur, daß jenes erst dreizehn Jahre später erfunden werden sollte.) Ach, die große Weltausstellung! Wehmütig dachte der Sohn daran zurück. Das waren tatsächlich noch bessere Zeiten gewesen! Er erinnerte sich daran, wie sein Vater noch viel zu tun hatte. Damals. Bis vor einem Jahr. Dem Jahr. Es war zwar bloß ein Jahr. Aber es erschien ihm wie eine halbe Ewigkeit. Denn Kinder haben eine andere Zeitrechnung. Außerdem war seither viel passiert. Zu viel.
Die Welt war noch eine andere gewesen. Bis kurz vor der Eröffnung. Der großen Weltausstellung. Anno 1873. Keine bessere unbedingt. Aber eine andere. Da hatte der Vater zumindest noch Arbeit gehabt. Ab und an. Hatte er Schilder gravieren müssen. Viele sogar. Denn es kam ein Großauftrag. Für die Weltausstellung. Tag und Nacht. Arbeitete der Vater daran. Und der Sohn schaute ihm dabei genau zu. Und dann, eines Tages, hatte er sie hinbringen sollen. Zum Weltausstellungsgelände. Hatte er den Sohn mitgenommen. Den Ältesten. Den Thronfolger. Den Kronprinzen. Der ja in seine unseligen Fußstapfen treten sollte. Eines schönen Tages.
Die Kutschfahrt quer durch die ganze Stadt war so ziemlich das Aufregendste, was der junge Gustav bis dahin erlebt hatte. Denn eine Kutsche konnte man sich für gewöhnlich nicht leisten. Nur davon träumen. Genauso wie von einem Grammophon. Oder Heizkohle. Oder Heißwasser. Oder Hosen. Oder Brot. Aber bei diesem Gefährt hier handelte es sich auch nicht wirklich um eine Kutsche. Eher um ein Fuhrwerk. Ein elendes Gespann. Von Schindmähren gezogen. Für das die Handwerker zusammengelegt hatten. Um ihre Waren gemeinsam anzuliefern. Dementsprechend voll war es. Und laut. Und unbequem. Den jungen Gustav kümmerte es nicht. Denn sein großes Abenteuer hatte gerade erst begonnen.
Erst jetzt. Konnte er das ganze Ausmaß der Baustelle überblicken. Die Ringstraße. Beziehungsweise das, was eines schönen Tages die Ringstraße werden sollte. Der prächtigste Boulevard ganz Europas. Wenn nicht gar der ganzen Welt. Wien hatte sich viel vorgenommen. In diesen Tagen. Zu viel. Denn vieles befand sich noch im Bau. Die beiden Zwillingsbauten der Museen. Zum Beispiel. Waren noch lange nicht fertig. Aber man konnte ihre baldige Pracht und Größe bereits erahnen. Kunsthistorisches links. Naturhistorisches rechts. Beziehungsweise umgekehrt. Je nachdem. Von wo man kam.
Man passierte den Donau-Canal. Über die Rotunden-Brücke. Und dann ging es geradewegs hinein. In den Prater. Über die Rotunden-Allee. Rechts. Die Jesuitenwiese. Links. Der Constantin-Hügel. Der eigens für die Weltausstellung aufgeschüttet worden war. Damit man auch ja einen schönen Ausblick hätte. Auf die Rotunde. Und das ganze Ausstellungsgelände. Und später auf das Riesen-Rad. Vierundzwanzig Jahre später. Ein ganzer Hügel also. Ein richtiger Berg. Denn der Glaube versetzt ja bekanntlich sogar Berge. Der Glaube. An den Fortschritt. An das Wachstum. An den Reichtum.
Das alles ist mächtig in die Hose gegangen. Man hatte sich mit alledem übernommen. Ringstraße. Und Weltausstellung. Das war zu viel. Des Guten. Purer Größenwahn. Eines riesigen Reiches. Das munter weiter expandierte. Weshalb sogar Berge versetzt wurden. Um es der ganzen Welt zu zeigen. Nämlich wer hier die Hosen anhatte. In Europa. Und zwar im Prater. Mittendrin. Hatte man also einen ganzen Berg aufgetürmt. Mit einem großen künstlichen See. Zu seinen Füßen. Und an seinem Abhang. Einen echten Wasserfall sogar! (Natürlich nicht minder künstlich.)
Im Galopp ging es nun. Quer über die Prater-Haupt-Allee. Über die schnurgerade Kaiser-Allee. Mit ihren Hunderten Kastanienbäumen. Und dann. Und dann. Dann. Endlich. Die Rotunde! Dieses gigantische, dieses kolossale Bauwerk, das man schon von weitem sehen konnte! Schon vom Linienwall aus! Dem Jungen stand der Mund offen. Er bekam ihn gar nicht mehr zu. Je näher sie diesem Ungetüm kamen. Diesem Gebirge. Aus Stahl. Und Glas.
Die Weltausstellung war zwar in diesen Tagen noch nicht eröffnet, aber es war für den elfjährigen Buben nicht minder aufregend, hier zu sein. Das alles sehen zu dürfen – und wenn es auch nur von außen war. Draußen. Hinter dem Bauzaun. Hinter der Absperrung. Verfolgte er das bunte Treiben herinnen. Wie so viele Wiener. Die nie und nimmer das Geld für die Eintrittskarte hätten aufbringen können. Genauso wie die Klimts. Drängten sich viele an der Absperrung. Die Zaungäste. Und beobachteten alles ganz genau. In diesen Tagen. Befand sich das alles hier noch im Bau. Legten die Arbeiter gerade letzte Hand an. Gaben dem Ganzen hier noch den letzten Schliff. Fasziniert schaute der Bub zu. Wie man die großen Glasscheiben nach oben zog. Auf die Rotunde. Die so riesig war, daß man den Kopf ganz weit in den Nacken legen mußte. Und noch weiter.
Es war das größte Bauwerk, das er überhaupt je gesehen hatte. Außer dem Stephansdom natürlich. Aber das hier, das erschien ihm wesentlich massiger, imposanter. Mit diesem aus Stein geschlagenen, mit riesenhaften Menschenfiguren verzierten Triumphbogen in seiner Mitte. Und dieser langgestreckten Halle. Schier unendlich. Und komplett aus Glas. Und darüber. Dieses gigantische Zeltdach. Diese Kuppel. Ganz aus Glas. So etwas hatte man bis dato noch nie gesehen. Zumindest in Wien nicht. Das war eine moderne Kathedrale. Und sie bestand nurmehr aus Glas. Und Stahl. Kein einziger Stein. Bis auf das Portal. Das lediglich schmückendes Beiwerk war. Und das mit dem Glaspalast an sich, mit dessen Statik und tragendem Konzept, nicht das geringste zu tun hatte.
Man zog die riesigen Glasscheiben hinauf. Unter lauten Zurufen. Die das Ganze noch viel dramatischer machten. Man schrie. Und man zog. Bis ganz nach oben. Mit Lastkränen. Über hölzerne Baugerüste. Welche um die kreisrunde Stahlkonstruktion errichtet worden waren. Wie ein Korsett. Wie ein Mieder. Aus Holz. Das neue Material. Der Stahl. Löste nun das alte Baumaterial ab. Stahl. Und Glas. Und sonst nichts. Das war der Beginn einer neuen Ära. Jeder spürte es. Und auch der Bub spürte es.
Unten nun ein Riesenradau. Die Maschinen wurden angeliefert. Die Ausstellungsstücke. Die Exponate. Der kleine Junge drückte sein Gesicht ganz fest an den Zaun. Mein Gott. Was war das bloß? Gigantische Turbinen. Schwarz. Und mächtig. Wie Walfische. Nein. Noch größer! Es brach eine neue Ära an. Eine Ära der schieren Größe. Eine Ära des schieren Größenwahns. Alles wurde größer. Alles wurde riesig. Kolossal. Gigantisch. Unüberschaubar. Die Ozeandampfer. Die Lokomotiven. Die Brücken. Alles aus diesem neuen Material. Aus Stahl. Sogar die Bauwerke.
Man hatte die Gleise bis hierher verlängern müssen. Um die Waren aus aller Welt bis in die Hallen hineintransportieren zu können. Schnaubend. Und brüllend. Stampften die riesigen Dampf-Lokomotiven ein. Unzählige Waggons hinter sich herziehend. Bis an den Rand vollgefüllt. Mit Waren. Aus aller Welt. Den neuesten. Den kostbarsten. Und darüber. Über dem allem. Die gigantische Rotunde. Der Glaspalast. Wie eine Kathedrale. Wie ein Himmelszelt. Ein neues Firmament. Unter dem sich die gesamte Welt zusammenfinden sollte. In Wien. Staunend. Sprachlos. Und zutiefst beeindruckt. Von Wien. Dem Zentrum Mitteleuropas. Und bald schon. Zentrum der Welt. In wenigen Tagen nur.
Und über diesem allen. Noch weit darüber. Da stand der Vater. Sein Vater. Der große Held. Der Erretter der Weltausstellung. Denn ohne seine gravierten Schilder, könnte das Ganze hier erst gar nicht vonstatten gehen. Dessen war der Bub sich sicher. Schließlich mußten doch die Herrschaften aus aller Welt ganz genau wissen, wo es langgeht! Und dafür war sein Vater zuständig! Sein Vater machte den wichtigsten Job hier bei der ganzen Weltausstellung! Das Herz des kleinen Jungen schlug schneller. Nein. Es hämmerte regelrecht in seiner Brust. Wie der Stahlkolben dieser gigantischen Dampflokomotive neben ihm. Und plötzlich wurde ihm alles klar. Dies war der Augenblick. Der alles entzündende Funke. Die Initialzündung. Als er sich entschloß. Künstler zu werden. Wie sein Vater.
Er wollte fortan Künstler sein. Und nur das. Denn dann würde er ebenfalls so wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Wichtige Menschen treffen. An einer wichtigen Ausstellung mitarbeiten. Einer welt-wichtigen Ausstellung sogar. Im Grunde erschien es ihm, als sei dies alles nur für seinen Vater erbaut worden. Diese prächtige, kolossale Rotunde! Als Monument. Und Mahnmal. Für seinen Vater. Den Helden. Den größten Vater von allen! Doch da hatte er noch nicht verstanden, daß sein Vater bloß ein einfacher Handlanger war. Ein gewöhnlicher Handwerker. Die Welt-Ausstellung hätte auch genausogut ohne dessen gravierte Schilder über die Bühne gehen können. Aber für den Sohn war der Vater an diesem Tag der große Held. Ein Vorbild. Dem es tunlichst nachzueifern galt.