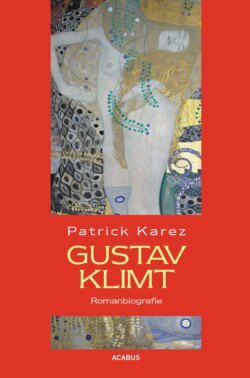Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 24
18
ОглавлениеWährend sie also mit den Arbeiten für Schloß Peleş bis über beide Ohren eingedeckt waren, nachdem es zuvor kaum etwas zu tun gegeben hatte, erfolgte im zweiten Lebensjahr der Künstler-Compagnie, also Anno 1884, eine regelrechte Auftrags-Schwemme. Eine Flut. Von Aufträgen. Eine regelrechte Überschwemmung. Mit Arbeit. Und es sollte noch dicker kommen. Und zwar so dick. Daß die drei kaum mehr wissen sollten, wie sie dies alles unter einen Hut bringen konnten. Denn wieder einmal hatten sich Fellner und Helmer an sie gewandt, die, wie bereits erwähnt, zwischen 1872 und 1915 ganze achtundvierzig neue Theater und Opernhäuser errichteten. (Und sie bauten ja schließlich nicht nur Theater und Opernhäuser!) In nur dreiundvierzig Jahren. Das machte mehr als ein Theater. Pro Jahr. Genauer gesagt: 1,1162790697674418604651162790698.
Eine unglaubliche Leistung. Und das nicht nur in logistischer Hinsicht. In quantitativer also. Sondern auch in qualitativer. Denn sie stehen ja heute immer noch. Und sind dabei noch genauso effizient wie eh. Und je. Dabei auch noch majestätisch. Und erhaben. Weshalb es die betreffenden Städte den Architekten danken. Noch heute. Was wären schließlich Städte wie Brünn, Preßburg, Szeged, Fürth, Gießen, Wiesbaden, Ravensburg, Augsburg, Temeschburg, Odessa, Gablonz oder Klausenburg ohne ihre Fellner-und-Helmer-Theater? Sogar große Haupt- und Kulturstädte wie Prag, Budapest, Zagreb und Sofia – aber auch Berlin, Hamburg und Zürich – gönnten sich damals opulente Theaterbauten aus der Feder der beiden österreichischen Architekten! Nachdem die drei jungen Künstler bereits für Fellner und Helmer am Stadttheater der mährischen Hauptstadt Brünn, sowie im Stadttheater der böhmischen Stadt Reichenberg, aber auch für den Kursalon samt Konzertsaal im renommierten Kurort Karlsbad, ebenfalls in Böhmen, umfassende Ausstattungsarbeiten vorgenommen hatten, kam Ende 1884 noch ein weiterer Auftrag hinzu: für das Stadttheater in Fiume. Damals Österreich. Heute Kroatien. Und auch die Stadt selbst wurde umbenannt. Nämlich in Rijeka. Genauso wie Brünn. Reichenberg. Und Karlsbad. In Brno. Liberec. Und Karlový Vary. Alles ist anders geworden. Nur die Theater stehen noch immer. Auch wenn die meisten Menschen jeden Tag an ihnen vorbeigehen und nicht einmal wissen, von wem sie stammen. Nun. Sie gehen damit auch immer an einigen echten Klimts vorbei.
Wie bereits bei anderen Projekten für Fellner und Helmer, sollte die Künstler-Compagnie im Stadttheater von Fiume die Gestaltung der sechs Deckengemälde, das Proszeniums-Bild sowie den Theatervorhang beisteuern. In diesem und im darauffolgenden Jahr, schuf Gustav Klimt also drei der Deckengemälde, während die anderen drei von Franz Matsch ausgeführt wurden. Sein Bruder Ernst besorgte auch hier wieder das Proszeniumsbild. Und am Theatervorhang arbeiteten sie erneut alle zusammen. Ihre Arbeiten schickte die Compagnie wie immer einige Monate vor der Eröffnung des Theaters ein. (Das Stadttheater von Fiume wurde übrigens am 3. Oktober 1885 feierlich eröffnet. Und zwar mit Giuseppe Verdis ‚Aida‘. Sowie mit Amilcare Ponchiellis Oper ‚La Gioconda‘. Die Mona Lisa. Also. Italienische Renaissance. Und Altes Ägypten. Historismus pur. Auch in der Musik.)
À propos. Italienische Renaissance. Unter den drei Deckenbildern Gustav Klimts, befindet sich übrigens eine ‚Allegorie der Musik‘, welche eine Orgelspielerin darstellt. In ihren überlängten Gliedmaßen ist der Einfluß Michelangelos zu erkennen, welchen Gustav Klimt zu dieser Zeit eingehend studierte. Und dieser Einfluß Michelangelos läßt sich auch sehr gut in seiner gleichzeitigen Arbeit für das Mappenwerk ‚Allegorien und Embleme‘ erkennen, die ja währenddessen (als ob es nicht schon genug zu tun gäbe) immer noch weiterlief. Nach seiner Darstellung der ‚Fabel‘, im vorherigen Jahr, wählte er die ‚Idylle‘, die er, als zweite gemalte Vorlage für das Mappenwerk, dessen zweiter Band in jenem Jahr erscheinen sollte, ebenfalls in Öl auf Leinwand ausführte. Und auch hier ist bemerkenswert, daß die beiden, überaus muskulösen Männerakte Klimts, geradewegs Michelangelos Decken- und Wandfresken der Sixtinischen Kapelle im Vatikan entsprungen zu sein scheinen. Die Alten Meister waren schließlich immer wichtig für ihn gewesen. So schätzte er, neben Tizian, Rubens und Michelangelo, unter anderem auch Diego Velázquez sehr. Dazu kommt noch, daß Gustav Klimt bei dieser Arbeit zum ersten Mal einen rein dekorativen Hintergrund verwendet, der bereits recht flächig erscheint. Dies ist insofern bemerkenswert, als daß es seinen späteren, für ihn so typischen Stil ausmachen sollte. Flächigkeit. Und ornamentaler Hintergrund.
Zeitgleich mit der Auftragserteilung für das Stadttheater von Fiume, erhielt die Compagnie, direkt von Fellner und Helmer, ebenfalls den Auftrag für die Innenausstattung des neuen Stadttheaters von Karlsbad. Parallel dazu waren auch noch die Ausstattungsarbeiten für die Sommerresidenz des rumänischen Königs im Gange. Obwohl Karlsbad ja bereits ein stattliches Theater besaß, beschloß der Stadtrat, aufgrund der stetig steigenden Besucherzahlen bereits im Jahre 1870 ein neues Theater erbauen zu lassen. Und wieder erhielt das Architekturbüro Fellner und Helmer den Zuschlag. Allerdings begann man erst vierzehn Jahre später mit dem Bau des neuen Theaters. Nachdem im Jahre 1883 die Finanzierung stand, wurde der Neubau noch im selben Jahr bei Fellner und Helmer in Auftrag gegeben. Ende September des darauffolgenden Jahres wurde das alte Becher-Theater abgerissen, an dessen Stelle im Oktober der Bau begonnen werden konnte. Bereits am 15. Mai 1886, nur neunzehn Monate später, konnte das neue Theater feierlich eröffnet werden. (Und zwar mit einer Hochzeit. Eines Figaros. Nämlich von Mozart.) Die Künstler-Compagnie führte auch hier wieder die Deckengemälde, das Proszeniumsbild sowie den Theatervorhang aus. Von den geforderten vier Deckenbildern, mit den Themen ‚Tanz‘, ‚Tafelfreuden‘, ‚Spiel‘ und ‚Jagd‘, die wie immer in Öl auf Leinwand ausgeführt und anschließend mit Stuckrahmen am Plafond kaschiert wurden, führte Gustav Klimt die ersten beiden aus und arbeitete zudem, wie die anderen beiden auch, am Bühnenvorhang mit, der mit Mischtechnik auf Leinwand gebracht wurde.
Es war auch zu dieser Zeit, als für Gustav Klimt die Arbeit nach trockenen, gemalten Vorlagen immer unbefriedigender wurde. Michelangelo. Hin. Oder Her. Er wollte schließlich aus erster Hand schaffen. Muskeln. Und Haut. Und das Licht darauf. In Natura studieren. Und nicht bloß jene Körper reproduzieren, welche durch die Augen und Hände der Alten Meister gegangen waren. Die längst tot waren. Nein. Sondern lebendige, atmende Menschen malen. Allem voran Frauen. Rote. Bonde. Brünette. Schwarze. Aber vor allem Rote. Und da professionelle Aktmodelle wie gesagt sehr teuer waren – und zudem schwer aufzutreiben – begann er in diesen Tagen damit, junge Mädchen auf der Straße anzusprechen. Wäscherinnen. Tagelöhnerinnen. Botengängerinnen. Kurz. Junge Frauen. Die nichts zu verlieren hatten. Schließlich zog die Sache mit dem rumänischen König immer. Und Plafond-Bilder für prächtige Theater waren ja letztendlich auch nicht so schlecht. Die Mädchen wähnten sich also in Sicherheit. Und so tauchte er eines Tages mit einer jungen Wäscherin im Atelier auf, was die anderen beiden nicht besonders freute. Vor allem Franz Matsch nicht.
„Gustl, was hast Du Dir dabei nur gedacht?“, flüsterte dieser ihm zu, nachdem er ihn diskret zur Seite genommen hatte, „All diese Mädchen sind krank, viele von ihnen leiden an der Schwind-Sucht, manche auch an der Syphilis – und Schlimmeres noch! Zudem ist diese hier eindeutig minderjährig …“
„Na und?“, Gustav Klingt zuckte mit den Schultern, „Das war ich bis zum letzten Jahre auch noch! Und daß man minderjährig ist, bedeutet ja noch lange nicht, daß man deppert ist. Oder daß man gar keine Bedürfniße hat …“
„Laß es sein!“, bekniete Franz ihn, „Es wird uns nichts Guthes einbringen! Laß uns noch ein wenig zusammensparen, dann werden wir uns professionelle Modelle von der Academie leisten können, aber so kann und will ich hier nicht arbeiten. Denn es ist höchst-gradig unseriös!“
„Ach, papperlapapp!“, machte Gustav und wandte sich wieder der jungen und schönen Wäscherin zu, „Na, mein Kind, dann zeig doch mal, was Du hast …“
Nachdem diese sich zaghaft entkleidet hatte, begann Gustav umgehend Zeichnungen von ihr anzufertigen. Sehr viele Zeichnungen. Am liebsten hätte er sie in den unmöglichsten Posen gezeichnet. Aber das traute er sich denn doch nicht. Noch nicht. Nicht hier. Vor den anderen. Aber es würde schon noch kommen. Dann verschwand er. Mit ihr. Im Hinterzimmer.
Das Verhältnis zu Franz Matsch, welches ohnehin ein wenig belastet war in diesen Tagen, wurde dadurch nicht besser. Denn schließlich hielt Gustav Klimt sich damit nicht an die von ihm selbst aufgestellte Regel. Des Einen. Für Alle. Und Aller. Für Einen. Und so machte er es sich fortan zur Angewohnheit, junge Mädchen (zumeist Wäscherinnen, die er unten, am Wien-Fluß, aufgabelte) von der Straße ins Dachatelier zu holen, sehr zum Mißfallen der beiden anderen. Da Gustav jedoch nicht davon abzubringen war, duldeten es die anderen beiden stillschweigend, bemerkten jedoch auch, mit Unbehagen, wie ihr Kollege diese jungen Frauen behandelte. Sie schienen nichts weiter als Stückgut für ihn zu sein. Ware. Die man kaufte. Und konsumierte. Und anschließend wieder fortwarf. Wenn sie aus dem einen oder anderen Grund (oder aus keinem, denn eines Grundes bedurfte es ja schließlich nicht) nicht mehr paßte.
„Hast Du Dir denn nur einmal dabei gedacht, was diese Frauen bei alledem empfinden?“, stellte ihn Franz Matsch nach einigen Wochen erneut zur Rede, „Das, was Du da thust, ist nicht richtig. Es ist falsch. Es ist quasi Nöthigung! Prostitution! Auch ein armer Mensch, hat schließlich seine Würde!“
„Geh bitte, Franzl!“, Gustav wollte von alledem offensichtlich nichts hören, „Diese jungen Dinger brauchen das Geld – und ich bezahle sie! Sie sind keine Opfer – das ist nichts weiter als guthe, alte Dienst-Leistung. Und zwar von beiden Seiten! Sie brauchen dringend das Geld – und ich brauche nun mal dringend ihre Cörper. Ein ganz gewöhnlicher Handel, ein classisches Tausch-Geschäft, also! Ich bin Künstler, hast Du das etwa schon vergeßen?“
„Ja, aber kannst Du Dich denn nicht damit begnügen, sie einfach nur zu zeichnen oder zu malen? Muß dann diese G’schicht mit dem Hinterzimmer immer wieder sein?“
„Ich kann keine schöne Frau einfach nur ansehen. Da geht’s mit mir durch …“
„Du mußt Deinen Trieb unbedingt unter Controlle bringen! Er wird Dir nichts Guthes bescheren, glaube mir!“
„Ich schaffe aber nun mal genau aus diesem Triebe heraus!“, verteidigte Gustav sich, und es klang glaubwürdig, „Was denkst Du denn, woher all diese creative Energie kommt? Alles, was wir im Leben thun, das thun wir doch schließlich nur aus einem Grunde – nehmlich um zu schnacks’ln! Um uns fortzupflanzen … Nimm doch nur einmal diese alberne Concurrence zwischen uns beiden … Was denkst Du denn, wie das zustande kommt? Es geht doch auch hierbei um nichts anderes als um Potenz, um Dominanz, um Sieg – also um die Rivalität unter Neben-Buhlern, wobei der Erfolg an der Sache nun mal immer eine schöne Frau ist. Der Mann, der gewinnt, bekommt eben die schönste Frau. So war es immer schon. Und sei es im Neo-Lithikum – oder aber im Mittel-Alter, wo man ja eigens dafür Tourniere austrug! Der Gewinner erhielt die schönste Jungfrau. So war es – und so ist es heute immer noch. Ich nehme mich da ganz und gar nicht aus …“
„Ja, aber … Dein Bruder und ich, wir schaffen doch auch so! Ich meine, wir brauchen keine schmutzigen und quiekenden Straßen-Mädchen im Hinterzimmer, um Kunst zu machen! Irgend etwas an Deiner Argumentation hinkt also …“
„Nun, jedem Thierchen sein Plaisierchen, heißt es doch so schön … Jeder ist da anders. Ihr beide seid da vielleicht controllierter, arthiger, beßer erzogen, aber ich selbst will nicht controlliert sein! Ich will nicht arthig sein! Ich will nicht so sein, wie Tausende andere! Ich will das Leben spüren, um malen zu können! Und die Sexualität gehört da nun mal eben dazu! Sie ist für mich eine der größten Energie- und Inspirations-Quellen für meine Kunst! Nein: Sie ist meine größte Energie- und Inspirations-Quelle überhaupt! Im Grunde thue ich das alles, was ich thue, nur um den jungen Dingern zu imponieren – und um hinterher eine nach der anderen zu vernaschen! Einen anderen Sinn in meiner Existenz gibt es nicht – und ich schwöre Dir, einen anderen Sinn gibt es in keiner menschlichen Existenz – das sagt ja schließlich auch Darwin! Wir sind nichts anderes als Affen, also Thiere! Und denkst Du etwa, ein Schimpanse überlegt vorher groß, ob er dies oder jenes thun soll? Nein! Er thut es einfach! Und das, weil er es nun mal thun muß!“
„Aber Gustl …“, erwiderte Matsch kopfschüttelnd, „Wir sind doch keine Primaten!“
„Jetzt redest Du schon ganz genau so, wie alle anderen Spieß-Bürger auch! Wer sagt das denn? Die Kirche? Die Moral-Wächter? Das Parlament? Die Eltern? Wer hat uns vorzuschreiben, wie wir zu sein und zu leben haben? Doch wohl nur Gott allein. Ganz genauso wie bei den Thieren … Glaube mir, Franzl, ich höre seine Stimme in mir herinnen … Und diese Stimme sagt mir unabläßig: ‚Schaff! Schaff! Nimm! Lebe! Begreife das Leben! Denn sonst kannst Du keine Kunst machen! Keine überzeugende, keine authentische, zumindest!‘… Ich weiß doch was ich fühle – ich bin ja nicht deppert!“
„Gustl, auch ein Mörder und ein Dieb, der hört diese Stimme! Sie sagt ihm: ‚Stiehl! Stiehl!‘, respective: ‚Morde! Meuchle!‘… Denkst Du etwa allen Ernstes, daß diese Stimme von Gott kommt?“
„Nun, sagt man nicht, daß alles von Gott kommt? Wenn Gott wirklich der Allmächtige ist, dann müßte er ja wohl auch für all diese Dinge verantwortlich sein!“
„Aber Gott hat uns Menschen den Freien Willen gegeben, Gustl. Eben, damit wir selbst uns entscheiden können. Nehmlich zwischen dem, was Guth und was Falsch ist! Das kann ein Thier nicht! Und junge, gefallene Mädchen auszunützen, die ganz offensichtlich in der Misere stecken, kann schließlich nicht guth und ehrenhaft sein! Mach es so wie alle: Wähle eine aus – und eheliche sie. Stehe dann zu ihr – komme was wolle – und zwar bis daß der Thodt euch scheide!“
„Ich fürchte, das kann ich nicht …“, Klimt schüttelte den Kopf, und er wirkte dabei nicht sonderlich glücklich, „Das Leben ist zu kurz, als daß man es an einen einzigen Menschen verschenken könnte! Als daß man sich an nur eine einzige Frau binden könnte! Das ist ja gleich so, als müßte ich tagtäglich – und zwar bis zu meinem Thode – ein und dieselbe Suppe essen! Nein, Franzl, ich weiß schon, was richtig für mich ist. Ich fühle es …“
Daß Gefühle trügerisch sind, sollte Gustav Klimt erst spät erfahren. Sehr spät. Nämlich. Als es bereits zu spät war. Aber diesbezüglich war er ja schließlich keine Ausnahme. Von anderen Männern. Diesen seltsamen Wesen. Mit notorischen Bindungsängsten. Deren biologische Aufgabe es nunmal ist. Ihren Samen durch die Weltgeschichte zu verstreuen. Und zwar so oft. Wie nur irgend möglich. Ohne Rücksicht. Auf Verluste. Konkurrenz. Kampf. Und Krieg. Also unbarmherzige Selektion. Und das Vorrecht des Stärkeren. Sind das Resultat dieser Einstellung. So funktioniert unsere Welt nun mal. So funktioniert alles Leben. So entsteht es schließlich. Aber ob es gut ist. Bleibt eine andere Frage.
Und dann geschah etwas. Was niemand auch nur geahnt hatte. Was niemand für möglich gehalten hatte. Makart starb. Mit nur knapp Vierundvierzig. Und zwar an Syphilis. Dem Künstler-Killer. Nummer Eins. In diesen Tagen. Genauer gesagt am 3. Oktober. 1884. Auch er hatte es so gehalten. Wie der junge Klimt. Und wie viele andere Künstler auch. Nein. Wie viele andere Männer auch. Wie ALLE Männer. Denn ein Mann kann nun mal von Natur aus nicht treu sein. Auch Makart hatte dieses Gefühl verspürt. Dieses Bedürfnis. Aus dem Vollen schöpfen zu müssen. Sich jede Frau zu nehmen. Die er begehrte. Und das. Obwohl er verheiratet war. Seine Gattin dankte es ihm nicht. Denn sie steckte er damit an. Nicht etwa mit der Untreue. (Denn das liegt Frauen nicht so sehr im Blut wie den Männern. Schließlich sind sie es ja, die in der Regel die Folgen daraus zu tragen haben. Beziehungsweise. Auszutragen.) Sondern mit der Syphilis. Und so starb sie ebenfalls daran. Wegen der Triebhaftigkeit und Unvorsicht ihres Mannes. So wie viele andere auch. Aus Unvorsicht. Aus Egoismus. Aus Triebhaftigkeit. Aus Leichtsinn. Denn der Herrgott gibt. Und der Herrgott nimmt. Auch wieder. Und zwar alles. Ohne Diskussion. Und ohne Erbarmen. Man muß nicht immer der Schuldige sein. Um bestraft zu werden. Es trifft eben auch die Unschuldigen. Und das öfter. Als man glauben könnte. Denn unverhofft. Kommt oft. Und so starben sie alle wie die Fliegen. Sowohl die Normalsterblichen. Als auch die Genies. Die Künstler. Und die Lebemänner. Die Libertins. In Wien. Und in ganz Europa. Waren alle im Schock. Und alle waren sich sicher. Daß nun eine Epoche zu Ende gegangen war. Mit Makart. Und dem war auch so.
Was nun allerdings folgte. War ein beispielloser und kometenhafter Aufstieg. Für die drei. Denn der Platz Hans Makarts war plötzlich freigeworden. Wien hatte keinen Malerfürsten mehr. Und die Künstler-Compagnie füllte diese entstandene Lücke nun aus. Der Malerfürst ist tot! Lang lebe der Malerfürst! Doch hier setzte auch allmählich die leise Paranoia Klimts ein. In Form einer geradezu pathologischen Hypochondrie nämlich. Jetzt war es noch nicht so schlimm. Aber das sollte es noch werden. Er sollte Nacht für Nacht unter Albträumen leiden. Und seine vielen kleinen Wehwehchen sowie seinen Körper ständig und minutiös im Auge behalten. Denn er fürchtete sich. Daß ihn das selbe Schicksal ereilen würde. Wie Makart. Und wie so viele andere auch. Dennoch. Konnte er es nicht lassen. Der Kater. Das Mausen. Ganz im Gegenteil sogar. Und erst in rund fünfzehn Jahren. Sollte es richtig schlimm werden. Geradezu krankhaft. Und auch die Folgen. Würden nicht allzu lange. Auf sich warten lassen. Denn wie man in den Wald ruft. So schallt es heraus.
Obwohl die Aufträge nur so hereinsprudelten. In diesen Tagen. Reichte das Geld dennoch nicht. Um eine achtköpfige Familie durchzufüttern. Geschweige denn. Ihnen eine angemessene und vor allem dauerhafte Unterkunft zu verschaffen. Und so stand wieder mal ein Umzug ins Haus. Nein. Sogar zwei. Und wieder. Mit Sack. Und Pack. Mit all der Wäsche. Und dem Kochgeschirr. Und den kleinen Kindern unterm Arm. Wie Vertriebene. Wie Heimatlose. Wie Obdachlose. Dachte Gustav. Und es war ihm nach wie vor peinlich. (Denn nun begann er auch noch, sich selbst die Schuld dafür zu geben.) Der leidige Dachboden war also nun Geschichte. Gott sei Dank. Vier Jahre waren ohnehin schon viel zu lange gewesen. Nämlich genau vier Jahre. Zu viel. Und was nun kam. War ein Traum. Ein ganz kurzer allerdings nur. Von nur wenigen Monaten. Denn mit dem erhöhten Einkommen der beiden Klimt-Brüder, hatte sich die Familie nun tatsächlich eine bessere Wohnung leisten können. Und zwar eine ruhige Gartenwohnung. In einem Innenhof. Auf der Mariahilferstraße. №75. Ein wenig feucht zwar. Aber dafür hell. Und luftig. Und grün. Für wenige Monate zumindest. Bis auch dieses Gebäude abgerissen wurde. Es war wie ein Fluch. Dachte Klimt. Der auf ihnen allen lastete. Warum auch immer. Denn wo sie auch hinkamen. Wurde ihnen bald darauf schon das Dach abgerissen. Über dem Kopf. Denn sie lebten ja stets in Not- und Übergangsquartieren. Ein gefundenes Fressen also. Für die Spekulanten. Zumal in diesen Tagen. Wo Wien sich anschickte. Eine cosmopolitische Weltstadt zu werden. Und eine Millionenmetropole. Noch dazu. Die den Vergleich mit den anderen Weltstädten und Millionenmetropolen nicht zu scheuen brauchte. Ganz im Gegenteil sogar. Da wurde Wohnraum plötzlich teuer. Und innerstädtischer Wohnraum. Umso mehr. Also ging es wieder weiter. Mit Sack. Und Pack. Mit Kind. Und Kegel. In die Stuckgasse. №6. Immerhin. Ebenfalls im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Also zentrumsnah. Immerhin. Bis ins Jahr 1890. Also ganze sechs Jahre lang.
Obwohl sie ja nun bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt waren, machte diese sich nicht wirklich bezahlt, denn es ging stets über Mittelsmänner. Also entweder über die Firma Kott. Oder über Fellner. Und Helmer. Den Ruhm. Und das große Geld. Strichen stets andere ein. Zudem erfolgten ihre Aufträge immer im Ausland. Aber nie in Wien. Nun konnte man es nicht zu wirklichem Ansehen (und einem guten Salär) bringen, wenn man nicht auch in der Reichshauptstadt Großaufträge erhielt. Deshalb entstand der Wunsch bei der Compagnie, als neugegründete Firma, nicht nur direkt beauftragt zu werden, sondern auch in Wien tätig sein zu dürfen. Doch dies entpuppte sich als recht schwierig. Längst hatten die älteren Platzhirsche ihr Revier untereinander aufgeteilt. Und für drei junge Künstler schien da kein Platz mehr zu sein. Zudem brauchte man gute Beziehungen. Um etwas reißen zu können. Das war ihnen schon längst klar geworden. Ihr bester Kontakt diesbezüglich war ganz sicher Hofrat Rudolf Eitelberger von Edelberg. Angesehener Kunsthistoriker. Und Archäologe. Zudem Gründer ihrer Schule. Nämlich der Kunstgewerbeschule. So sehr dies ihnen auch zuwider war. Sie mußten hausieren gehen. Klinkenputzen. Sozusagen. Zu diesem Zwecke verfaßten sie noch in diesem Jahre einen Brief an ihn, in welchem sie ihn baten, ob er sich nicht gnädigst für sie verwenden möge. Artig und in Schönschrift verfaßt, zierte den Briefkopf ein demütiges „An Hochwohlgeboren, Ritter von Edelberg“, wobei sie den Brief alle drei unterschrieben. Schön artig untereinander. In umgekehrter Reihenfolge ihres Alters. Die Argumente, die sie darin lieferten, lauteten ungefähr in diesem Sinne: Wir sind jung. Wir sind gut. Wir sind schnell. Und wir sind billig. Dem konnte schließlich keiner widerstehen. Auch damals nicht. (Und bei Fellner & Helmer waren es ja schließlich genau die selben Argumente, die sie so groß gemacht hatten.)
Dieser peinliche Bittbrief erfolgte genau im richtigen Moment. Er hätte keine paar Monate später geschrieben werden dürfen. Es war vermutlich Fügung. Des Schicksals. Oder pures Glück. Denn Ritter Eitelberger von Edelberg sollte nur kurz darauf versterben. Wie so viele. In diesen Tagen. Zudem war ja auch Makart, der Ober-Platzhirsch, kürzlich erst gestorben, wobei er alle seine laufenden Arbeiten in Wien unvollendet gelassen hatte. Im K.u.K. Kunsthistorischen Hofmuseum auf der Ringstraße, zum Beispiel, hatte er lediglich die Lünetten im zentralen Stiegenhaus fast zur Gänze vollenden können, doch seine anderen Ausstattungsarbeiten, wie zum Beispiel die Ausmalung der Privaträume der Österreichischen Kaiserin, in deren sogenannter Hermes-Villa, in Lainz, bei Wien, blieben gänzlich unvollendet. Einige der Räume waren zu diesem Zeitpunkt sogar noch vollständig kahl.
Nun. Hofrat Eitelberger von Edelberg verwandte sich tatsächlich für sie. Denn schließlich ging es hierbei ja auch um den Ruf seiner eigenen Schule. Was konnte schließlich Besseres geschehen, als der berufliche Erfolg seiner eigenen Zöglinge. Also vermittelte Eitelberger seine drei jungen Protegés direkt an den Architekten der Hermes-Villa. Und dieser war kein geringerer als Carl Freiherr von Hasenauer. Damals zweifelsohne der berühmteste Architekt Wiens. Von Theophil von Hansen und Gottfried von Semper einmal abgesehen. Ein wahrer Meister des Historismus. Wobei seine Spezialität der sogenannte Römische Stil war. Also eine Mischung aus Italienischer Hochrenaissance. Und Italienischem, eben Römischem, Hochbarock. Als es im Jahre 1871 an die Planung der großen Weltausstellung in Wien gegangen war, wurde kein geringerer als Freiherr von Hasenauer zum Chefarchitekten der gesamten Weltausstellung von 1873 ernannt. Im Jahre 1872 wurde er auch schon mit der Errichtung des K.u.K. Kunsthistorischen Hofmuseums betraut. Und nur zwei Jahre später erfolgte, unter vielem anderen, der offizielle Bauauftrag für das K.u.K. Hofburgtheater auf der Ringstraße, einer schneeweißen, neu-barocken Sahnetorte gleich gegenüber dem neuen Rathaus im neu-hochgotischen Stil, und schräg gegenüber vom Parlament im neo-griechischen Stil, von Theophil von Hansen, wobei er dieses Burgtheater gemeinsam mit Gottfried von Semper plante und auch mit ihm den Bau begann, nach Sempers Weggang aus Wien im Jahre 1876 jedoch allein vollendete. Die Wiener Ringstraße kann man sich also ohne Hasenauer nicht vorstellen. Ohne Semper und Hansen natürlich auch nicht. Aber ohne Hasenauer wäre sie undenkbar. Sie wäre gar nicht da. Beziehungsweise. Wäre sie ganz anders. Denn Hasenauer schuf in Wien nun mal all das. Was man heute mit Wien verbindet.
Diesem durch Eitelberger, kurz vor seinem Tode, hergestellten Kontakt zu Hasenauer, sollte die Künstler-Compagnie nun ihre wichtigsten Großaufträge in Wien verdanken. Der erste bestand darin, die Entwürfe Makarts für die Hermes-Villa im Lainzer Tiergarten auszuführen. Ihr ehemaliger Lehrer und glühender Makart-Verehrer Julius Victor Berger fertigte dabei nach den Entwürfen Makarts präzise Skizzen an, welche nun an den Wänden der Privatgemächer der Österreichischen Kaiserin zur Anwendung kommen sollten. Und zwar unter anderem. In ihrem Schlafgemach. Was für ein Auftrag! Die drei Burschen konnten es zunächst gar nicht glauben. Dann jubilierten sie förmlich. Das Schlafzimmer der Kaiserin höchstselbst! Elisabeth! Sissi! Von der nicht nur ganz Wien redete! Und sogar träumte! Sondern die ganze Welt! (Denn sie galt als schönste Monarchin der ganzen Welt!) Hier müßten sie sich ganz besondere Mühe geben. Schließlich ging es hier ja um die Wurst! Beziehungsweise. Um die Kaiserin. Und somit profitierten sie erstmals von Makarts Tod. So schlimm sich das auch anhören mag.
Doch allmählich wurde es eng. Sie hatten ja daneben auch noch andere Aufgaben zu bewältigen. Die nicht minder prestigiös waren. Und zwar für halb Europa. Während sie sich also bereits an die Arbeit für die Privat-Villa der Österreichischen Kaiserin machen mußten. Liefen die anderen Großaufträge noch nebenher. Denn die leidigen und zeitaufwendigen Arbeiten für die Sommer-Residenz des rumänischen Königspaares, Schloß Pelesch, waren noch längst nicht fertig und würden die drei von jetzt an noch zwei ganze weitere Jahre beschäftigen. Außerdem arbeiteten sie noch für die Theater in Fiume und Karlsbad – und zwar ebenfalls noch für ein weiteres Jahr, beziehungsweise zwei. Als ob dies nicht ohnehin schon genug gewesen wäre, wurden ihnen durch Fellner und Helmer nun auch noch Auftragsarbeiten für das bereits bestehende Nationaltheater der rumänischen Hauptstadt Bukarest angetragen, ebenfalls von einem österreichischen Architekten erbaut, die sie allerdings, aus akutem Zeitmangel, erst im kommenden Jahr hätten in Angriff nehmen können – wenn überhaupt! Aber es sollte noch dicker kommen. Wie gesagt: Der Malerfürst war nun tot. Und die drei jungen Künstler, die sich als Compagnie allmählich einen Namen zu machen begannen, waren die drei Kronprinzen, welche nun seinen Platz einnahmen.
Und so fuhren die drei, im Sonntagsstaat und mit der Droschke, zum Lainzer Tiergarten hinaus, der damals noch außerhalb Wiens lag. Heute ist er mittendrin. Nämlich im XIII. Wiener Gemeinde-Bezirk. Der berühmte Wiener Ringstraßen-Architekt Carl von Hasenauer erwartete sie bereits. Ebenso wie Hofrat Eitelberger von Edelberg. Und Professor Julius Victor Berger.
„Meine Herren!“, Hofrat Eitelberger stützte sich beim Gehen neuerdings auf einen Stock, „Willkommen in Lainz! Darf ich bekannt machen: Der große Architect unserer geliebten Kaiser-Stadt, Freiherr von Hasenauer!“
Die drei jungen Künstler stellten sich der Reihe nach vor und es erfüllte sie mit Stolz, eine weitere jener illustren Persönlichkeiten kennenzulernen, welche Wien in jenen Tagen zuhauf zu bieten hatte.
„Meine Herren!“, Hasenauer kam gleich zum Punkt, „Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit, Franz Joseph I. höchstselbst, hat meine Wenigkeit vor nunmehr drei Jahren, also Anno Domini 1881, mit der Errichtung eines Jagd-Hauses im Kaiserlichen und Königlichen Jagd-Gebiete zu Lainz bei Wien beauftragt, welches Sie ja hier um uns herum sehen können …“, er deutete mit einer vagen Geste in die Botanik sowie auf das sie u-förmig umschließende Gebäude, „Er vertraute mir an, daß er die Anwesenheit seiner Kaiserlichen Gemahlin des öfteren hier in Wien wünsche … Sie müssen wissen, daß Ihre Majestät, die Kaiserin von Österreich, das sehr gestrenge Spanische Hof-Ceremoniell in der Hof-Burg nicht gar so guth verträgt, weshalb sie sich zunehmend absentiert und sich zu diesem Zwecke vor allem in unserem Cron-Lande Ungarn, im Schloße Gödöllő, bei Ofen, respective eher bei Pest, aufhält … Dies sind nicht etwa vertrauliche Informationen des allerhöchsten Erz-Hauses, die ich hier ausplaudere, denn schließlich weiß es ja inzwischen ganz Wien … Meine Aufgabe ist also eine überaus heikle und verantworthungsvolle: Ich selbst soll mit diesem von mir entworfenen Jagd- und Land-Sitze dazu beitragen, daß Ihre Kaiserliche Hoheit sich wieder wohl in unserer schönen Reichs- und Residenz-Hauptstadt fühlen möge und daß sie hier endlich jene Ruhe zu finden vermag, die sie scheinbar so dringend benöthigt … Officiell handelt es sich hierbei natürlich um ein Geschenk zur kürzlich erst begangenen Silbernen Hochzeit … Im Junius 1882 haben wir also mit der Construction begonnen und in nur zwei Jahren, Anno 1886, wird dieser respectable Land-Sitz bereits fertig-gestellt sein!“
„Das ist rasch!“, sagte Franz Matsch.
„Jaja, Seine Majestät, der Kaiser, hat es scheinbar sehr eilig damit – bevor ihm sein geliebtes Vögelchen noch vollends davonfliegt!“, Hasenauer lächelte verschmitzt, „Ich habe sie selbst kennen-gelernt … Nun, sie ist sehr … eigen. Sehr spontan, um es einmal so zu sagen. Aber überhaupt nicht compliciert. Sie werden gar nicht bemerken, daß es sich bei ihr um die Kaiserin von Österreich handelt, das versichere ich Ihnen! Sie werden sie ganz sicher auch noch sehen, denn manchmal, da taucht sie hier einfach ohne Vorwarnung auf, um den Fortgang der Arbeiten zu beguthachten. Denn jetzt geht es bereits an die Innen-Ausstattung, wie Sie ja bereits wissen …“
Die drei nickten.
„Guth. Ich habe meinem guthen Freund Julius Berger die Leitung darüber übertragen. Und es ist eine wahre Auszeichnung für Sie, meine Herren, justament das Domicil der Kaiserin höchstselbst ausstatten zu dürfen – aber das wissen Sie ja schließlich selbst! – zumal Sie hier nur in bester Gesellschaft sein werden. Gleich neben Ihnen, arbeitet heute unter anderem Hugo Charlemont, der ebenfalls von Professor Berger beauftragt wurde. Also geben Sie sich bitte die allergrößte Mühe! Der Kaiserin muß es gefallen – das hat allerhöchste Priorität! Sie soll dieses öde Gödöllő – und Ungarn ganz im Allgemeinen – schlichtweg vergeßen, wenn sie das hier sehen wird, in seiner ganzen Pracht! Es soll ihr als Refugium dienen, ihr heiligster Rückzugs-Tempel sein, deshalb auch der antike Bezug zu Hermes, dem alt-griechischen Götter-Bothen! Die Kaiserin liebt ja alles, was alt-griechisch ist, müssen Sie wissen … Theophil von Hansen erbaut ihr eigens dazu das Achilleion auf Corfu, in diesen Tagen – zumindest aber hat er es entworfen! Eigentlich hatte sie ja auch hier, in Wien, einen antikisierenden Bau bevorzugt, doch der Kaiser und meine Wenigkeit haben es ihr schließlich noch in allerletzter Secunde ausreden können – Sie wissen schon, wegen all dieser kalten, weißen Marmor-Platten, der gestrengen Colonnaden, und so weiter. Nein, diese antike Strenge, das schlägt doch allzu sehr aufs Gemüth, zumal während der langen und ungemüthlichen Winter hier! Diesen spröden Hansen konnte man ja auch nur noch mit größter Müh einbremsen – Sie wissen schon, das Reichs-Raths-Gebäude auf der Ringstraße, also das Parlament, schließlich sind wir hier im schönen Wien und nicht in Athen! Hier, in meiner Villa, die eigentlich ein Schloß geworden ist, wie Sie sehen, wird Ihre Majestät ein wenig barocke Freundlichkeit vorfinden, gepaart mit Elementen der Renaissance und wird sich hier hinterher ganz wie in Rom, der ewigen Stadt, fühlen! Und ein wenig wie in Frankreich ist es schließlich auch, finden Sie nicht? Ein Hauch von Fontainebleau … Deshalb hatte ich auch den großen Makart, Gott sei seiner Seele gnädig, damit beauftragt, das allerwichtigste Gemach in diesem Schloße, nehmlich das Schlaf-Gemach der Kaiserin, auszustatten – aber vor wenigen Wochen hat das Schicksal uns diesbezüglich einen garstigen Streich gespielt, wie Sie ja alle wissen … Nun denn … Professor Berger versicherte mir, Sie drei haben bereits einigen guthen Ruf erlangt – unter anderem für das Architectur-Bureau Fellner und Helmer – und Sie haben Makart sogar persönlich getroffen?“
„Mehrmals sogar!“, erwiderte nun Gustav Klimt. Mit erstaunlichem und für ihn ungewöhnlichem Selbstbewußtsein.
„Nun denn …“, fuhr Hasenauer fort, „Wie Professor Berger mir versichert hat, haben Sie drei sich die … nun, nennen wir es: die üppige, barocke Formen- und Farben-Welt Meister Makarts bereits angeeignet und arbeiten mittlerweile im gleichen Stile wie er?“
„Das ist richtig!“, sagte nun auch Ernst Klimt. Inzwischen war es längst nicht mehr nur Franz Matsch. Der redete.
„Guth …“, Hasenauer wandte sich nun dem Eingang zu, „Folgen Sie mir bitte – es geht hinauf, an Ihre künftige Arbeits-Stätte, nehmlich ins Schlaf-Gemach Ihrer Majestät, der Kaiserin … Ich kann nicht oft genug bethonen, was für ein prestigieuser Auftrag dies doch ist – und daß Sie doch bitte Ihr Allerbestes geben mögen! Nach den Entwürfen Makarts, hat Herr Professor Berger wirklich bezaubernde Scizzen erstellt, die Sie gleich oben sehen werden! Es handelt sich dabei um geradezu märchenhaft anmuthende Scenen aus William Shakespeares ‚Sommernachts-Traum‘, eines der Lieblings-Stücke der Kaiserin, so sagte man mir … Sie drei werden die Hohl-Kehlen und Tondi bestellen, selbstverständlich in Öl auf Stuccatur-Grund. Sie werden also directement auf den Wand-Verputz malen. Haben Sie das überhaupt schon einmal gemacht?“
„In der Schule haben sie es zur besten Zufrieden-Stellung erlernt!“, beeilte sich Julius Berger zu sagen, da er ahnte, daß die drei bislang lediglich auf Leinwand gearbeitet hatten.
„Sie werden nach Möglichkeit noch heuer damit beginnen!“, setzte Hasenauer unbeeindruckt seine Ausführungen fort, „Ich weiß, es ist bereits späth – und das Jahr beinahe zu Ende – aber Sie haben dann ja noch das ganze nächste Jahr; denn erst im Jahre darauf, wird diese Résidence hier schlüßel-fertig an Ihre Kaiserliche und Königliche Majestät übergeben werden.“
Nachdem also im darauffolgenden Jahr, nämlich 1885, das Schlafgemach der Österreichischen Kaiserin vollendet war, wähnte man sich darin geradezu wie in einem Wald. Kein Zentimeter der Decken und Wände war ausgespart worden – überall schimmerte und leuchtete es nur so vor gemaltem Blattwerk und künstlichem Himmel – ganz im Sinne und Geiste Makarts. Das Thema war wie gesagt der Sommernachtstraum – ein passenderes hätte es wohl kaum geben können für ein Schlafzimmer. Zumal das einer Kaiserin. (Übrigens ist diese Hermes-Villa in Lainz, also Wien, nach ihrer systematischen Ausplünderung durch russische Truppen, um ein Haar abgerissen worden. Nämlich in den förmlich nach Moderne und Fortschritt schreienden 1960’er Jahren. Mit ihren Mondraketen. Und Atomkraftwerken. Und Atomwaffen. Da gab es für die Menschen scheinbar nichts Schlimmeres. Als Makart. Und den Historismus. Und Klimt. Übrigens auch. Nur der beherzte Protest einiger weniger Bürger und Anrainer, hatte diese Katastrophe noch in allerletzter Sekunde verhindern können. Ironischerweise ist der Erhalt dieses Bauwerks wohl auch einem Amerikaner, nämlich ausgerechnet Walt Disney, zu verdanken, der hier im Jahre 1963 einen Film drehte. Man sollte es sich also durchaus ansehen. Der Eintritt ist sogar gratis.)
Da die Künstler-Compagnie ihre Arbeit zu aller Zufriedenstellung abgeschlossen hatte, trug man ihnen noch einen weiteren Auftrag an. Und zwar fehlte in dem davor gelegenen, langen und schmalen Salon der Kaiserin das gesamte Deckenfresko. Und da Makart vor seinem plötzlichen Tode hierzu keinerlei Entwürfe mehr hatte anfertigen können, war die Künstler-Compagnie nun in ihrer Wahl vollkommen frei: Die drei jungen Künstler durften diese Decke komplett nach eigenen Entwürfen gestalten. Sie wählten ein typisches Barock-Sujet, eine Allegorie des Frühlings, welche sie noch im selben Jahre, 1885, in Öl direkt auf den Stukkaturgrund ausführten. Dabei arbeiteten sie erstmals alle drei wild durcheinander, weil derzeit einfach viel zu viel auf einmal zu tun war und sie kaum mehr wußten, wie sie all ihre Aufträge unter einen Hut bringen konnten. Vermutlich war es auch deshalb, warum sie die gut zehn Meter lange Decke des Salons kaum mit Objekt und Zierrat bedeckten, sondern die ganze Sache erstaunlich schlicht hielten. Ihr Frühling, reduziert sich lediglich auf einen babyblauen Himmel mit weißen Wattewölkchen und einige wenige allegorische Figuren. Natürlich weibliche. Und leichtbekleidete. Das kannten sie ja bereits. Das ging schnell. Denn das hatten sie ja schließlich schon oft genug gemacht. Nämlich im Palais Sturany. Und im Palais Zierer. Aber auch in allen Theatern von Fellner und Helmer, für die sie engagiert worden waren. Sowie im Sommerschloß des Rumänischen Königspaares. Dieser stark reduzierte – also bezüglich der Farbe und des Zierrats äußerst sparsam gehaltene – Bildraum, stieß übrigens bei der Kaiserin, die es eher schlicht mochte, auf wesentlich mehr Wohlwollen als das üppig ausgestattete Schlafzimmer im Stile Hans Makarts. Es grenzt schon wirklich an ein Wunder. Und an Ironie. Daß die drei jungen Künstler sich gerade dann vom üppigen Stil ihres Meisters und Idols abkehrten, als sie, nach dessen überraschendem Tode, seine Arbeiten übernahmen. Der Malerfürst war tot. Und scheinbar. Blieb er das auch. Denn sein allzu üppiger Stil, schien in diesen Tagen vielen gegen den Strich zu gehen. Auch der Kaiserin.
Und diese erschien dann tatsächlich auch. Und zwar höchstpersönlich. Und ohne Voranmeldung. Schon hatten die drei nicht mehr damit gerechnet. Sie überhaupt noch zu Gesicht zu bekommen. Doch da stand sie nun. Plötzlich. Aufgetaucht. Ex Machina. Wie aus dem Nichts. Während die drei hoch oben, unter der Decke, rücklings auf ihrem Holzgerüst lagen. Und malten. Stand sie einfach da. Tief unter ihnen. Und zwar allein. Sie wirkte geradezu wie ein Geist. In ihrem schlichten, schwarzen Taftkleid. Und ihrem äußerst blassen Teint. Sie trug das lange, schwarzbraune Haar in kunstvoll geflochtenen Kränzen um ihr Haupt gelegt. Und ihre Taille. Die betrug tatsächlich nur vierzig Zentimeter. Und zwar höchstens! Das konnten die drei jungen Künstler schon von hier oben aus sehen. In ihrer Rechten trug sie einen Fächer. Aus schwarzem Stoff. Den sie sich immerzu vor den Mund halten sollte. Wenn sie sprach. Oder lächelte. Vermutlich. Um ihre Zähne zu verbergen. Eine Schwachstelle. Des Hauses Wittelsbach.
Umgehend stiegen die drei, einer nach dem anderen, über die wackelige Leiter hinab.
„Eure Majestät!“, Franz Matsch, der als erster unten angelangt war, verbeugte sich tief. Fast bis zum Boden. Die anderen beiden taten es ihm nach, sobald sie ebenfalls unten angekommen waren.
„Soso …“, sagte sie und sprach dabei erstaunlich leise, „Sie sind also die drei jungen Talente, von denen wir bereits so einiges gehört haben …“
Die drei fühlten sich ob dieser Worte überaus geschmeichelt, wagten es aber nicht, etwas darauf zu entgegnen.
„Wissen Sie …“, sie schaute hinauf, wo man aufgrund der Holzgerüste nur einen Teil der gut zehn Meter langen Decke sehen konnte, welcher allerdings bereits vollendet zu sein schien, „Ihre Arbeit da oben, gefällt uns um einiges beßer als das, was man da drüben, in unserem künftigen Schlaf-Gemache, fabriciert hat …“
„Aber, mit Verlaub, Eure Majestät … Es ist doch wunderschön geworden!“, wagte nun der junge Ernst Klimt einen Einwand. (Wofür er gleich einen Rippenstoß von seinem Bruder kassierte. Denn einer Kaiserin widersprach man nicht.)
„Nun … schön ist es fürwahr …“, die Kaiserin lächelte, vermutlich, denn sie hielt sich den Fächer vor den Mund, „Aber ein wenig zu exubérant – also nicht so ganz nach unserem Geschmacke … Wir bevorzugen es lieber schlicht, eher im anticen Stile … Ganz genauso wie dies hier, was Sie da oben gefertigt haben!“
Die drei verneigten sich. Und zwar völlig synchron.
„Von wem stammt der Entwurf?“, fragte sie. Hinter ihrem Fächer.
„Von uns selbst!“, beeilte sich Franz Matsch nun zu sagen.
„So?“, entgegnete die Kaiserin, wobei sie nicht ihn, sondern Gustav Klimt musterte, „Sie zwei sind Brüder, nicht wahr?“
Ernst und Gustav nickten.
„Das ist schön …“, sagte sie, und ihr einst stechender und lebenslustiger Blick wirkte dabei abwesend. Irgendwie gebrochen. Längst war sie nicht mehr die schönste Frau der Welt. Das war den Dreien sofort aufgefallen. Und doch. Hatte sie etwas. Das jedoch tief unter ihrer sorgsam kontrollierten Oberfläche lag. Längst zeigte sie sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Menschen waren ihr ein Graus. Nur Künstler nicht. Die ließ sie ab und zu noch an sich heran. So auch heute.
„Die Familie ist das allerhöchste Guth!“, sagte sie schließlich, „Es ist das einzige, was uns allen am Ende noch bleibt … Von jedem und allen werden wir ein Leben lang stets enttäuscht – von der Familie natürlich auch, aber am Ende ist sie trotz alledem noch da … Und wenn es nur im Grabe ist, in der Gruft, wo man uns schließlich neben unseren Vätern und Müttern sowie unseren Geschwistern, zur ewigen Ruhe bettet … Es ist das Bluth, verstehen Sie?“
Die drei nickten. Und doch fanden sie ihre Rede ein wenig befremdlich. Viel zu offen. Zumal. Für eine Kaiserin.
„Pflegen Sie Ihre Liebe und Ihre Achtung füreinander!“, fügte sie schließlich hinzu, „Sie ist nicht selbstverständlich! Zwei Brüder erreichen in dieser schnell-lebigen Welt nun einmal mehr als nur einer … Geben Sie guth auf sich Acht! Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu … Und vernachläßigen Sie bitte auch den Dritten in Ihrer Mitte nicht! Er ist ein braver Mann. Und schließlich kann er ja nichts dafür, daß er nicht mit Ihnen verwandt ist …“
Sprach’s. Und wandte sich noch im selben Augenblick ab. Und um. Eine Kehrtwende. Sozusagen. Eine Halbdrehung. Um die eigene Achse. Sportlich. Und elegant. Das war sie. Das sah man. Das war den Dreien schon von oben aufgefallen. Aber zu dünn. Viel zu dünn. Geradezu hager. Das Gesicht wirkte eingefallen. Geradezu krank. So sieht ein glücklicher Mensch nicht aus. Und eine glückliche Frau erst recht nicht. Dachte Gustav Klimt. (Und vermutlich dachten es wohl alle.)
Irgendwie ließ sie die drei mit einem seltsamen Gefühl zurück. In ihren Augen hatten sie die Leere gesehen. Es war geradezu unheimlich gewesen. Wie ein Orakel. Wie eine altertümliche Prophetin. Hatte sie ihnen von der Bedeutung der Familie gesprochen. Und nur vier Jahre später. Sollte ihr eigener Sohn, der Österreichische Thronfolger und Kronprinz, Rudolf von Habsburg, auf tragische Weise sein Leben verlieren. Und nur dreizehn Jahre später, sollte die Kaiserin selbst, einem heimtückischen Mord-Attentat zum Opfer fallen. Der Bruder des Kaisers, Kronprinz Maximilian von Habsburg, war bereits vor nunmehr achtzehn Jahren als Kaiser von Mexiko von den Franzosen, den ewigen Widersachern der Casa de Austria, in eine Falle gelockt und anschließend verraten worden, wobei ganz Europa tatenlos zusah, wie er irgendwo, mitten in der mexikanischen „Pampa“, standrechtlich erschossen wurde. Wie ein gemeiner Hund. Und ihr geliebter Cousin, König Ludwig II. von Bayern, sollte bereits im kommenden Jahre heimtückisch niedergemeuchelt werden. Auch hier hatte es nach billigem Selbstmord aussehen sollen. Ja. Es war tatsächlich eine Epoche zu Ende gegangen. Beziehungsweise. Tat sie es. Und zwar genau jetzt. In diesen Tagen. Da starben sie. Wie die Fliegen. Alle Großen. Und Wichtigen. Alles änderte sich. Alles veränderte sich. Und die Menschen kamen gar nicht mehr mit. So schnell ging es.
Im darauffolgenden Jahr. Nach dieser ominösen Begegnung. Mit der Kaiserin. Sollte in Stuttgart auch schon das Automobil erfunden werden. Von Gottlieb Daimler. Und Carl Friedrich Benz. Diese Erfindung. Welche die Welt veränderte. Verdeutlicht diesen enormen Umbruch. Diese Zeitenwende. Wohl am allerdeutlichsten. (Und elektrifiziert. Wurde man ja schließlich auch schon. In diesen Tagen.)