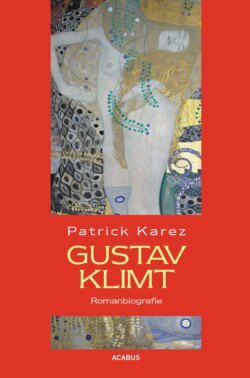Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 23
17
ОглавлениеIm darauffolgenden Jahr, 1883, beendeten die drei ihre Ausbildung an der Kunstgewerbeschule. Jetzt waren sie also fertige, ausgebildete Maler, sogar selbständige Künstler, und durften sich auch offiziell so nennen. Ihre Arbeiten für das Stadttheater im nordböhmischen Reichenberg – also die vier Deckengemälde, das Proszeniumsbild und der Theatervorhang – waren gleichzeitig ihre Abschlußarbeit für den Atelierkurs von Berger, welche in diesem Jahr zunächst in der Schule, und dann schließlich im benachbarten K.u.K. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie ausgestellt wurde. Eigentlich hätten sie den Vorhang, laut Vertrag, bereits zum ersten Juni nach Liberec schicken sollen, doch in einem Schreiben an die Bauleitung, vom 14. August, erbat sich die Compagnie eine Verschiebung des Abgabetermins auf den 10. September, um die vollendete Arbeit, die ja auch ihre offizielle Diplomarbeit war, eben in der Kunstgewerbeschule ausstellen zu können. Deshalb wurden ihre Auftragswerke erst Mitte September nach Reichenberg geschickt – recht knapp, denn das Theater wurde ja bereits am 30. September 1883 eröffnet.
Professor Berger entließ sie mit den besten Wünschen. Und mit einer ganzen Menge an gutgemeinten Ratschlägen. Das war nun mal so seine Art. Ohne Fleiß. Kein Preis. Sagte er. (Und dem war auch so.) Wer zuerst kommt. Mahlt zuerst. Beziehungsweise. Malt zuerst. (In diesem Falle.) Morgenstund. Hat Gold im Mund. Und der frühe Vogel. Fängt den Wurm. Beziehungsweise. Findet. Auch ein blindes Huhn. Mal ein Korn. Und so weiter. Und so fort. Doch nun stellten sich ihnen gleich zwei Probleme in den Weg. Die nicht unerheblich waren. Und die ihnen einiges an Sorgen bereiteten. Zum einen, mußten sie fortan auf ihr monatliches Stipendium von 20 Gulden pro Person verzichten. Zum anderen, hatten sie ja nun kein eigenes Atelier mehr. Das war tatsächlich ein Riesenproblem. Denn schließlich waren ihre Auftragsarbeiten zum Teil von nahezu gigantischen Ausmaßen. Die konnte man nicht einfach mal so herstellen. Zwischen Tür. Und Angel. Und schon gar nicht. In einer kleinen Dachbodenwohnung. In der ganze acht Personen hausten. Und wo es im Sommer unerträglich heiß war. Und im Winter eiskalt. Doch woher nehmen. Und nicht stehlen. Zumal. Wenn man kein Geld hat. Kein regelmäßiges Einkommen. Und keine Aufträge.
Und so war es nicht nur ein unglaubliches Glück für sie. Sondern auch ein wahrer Segen. Daß Berger sie mit dem Silberwaren-Fabrikanten Markowitsch bekanntmachte. Der ihnen daraufhin einen Raum zur Verfüg stellte. Und zwar unter dem Dach. Seiner Fabrik. In der Sandwirtgasse. № 8. Im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Praktisch. Mitten in der Stadt. Und unweit des Wien-Flußes. Diesen Raum würden sie also als Atelier nutzen. Und zwar ganze neun Jahre lang. Von 1883. Bis 1892. Und was noch besser war: Er verlangte keinen Zins. Dafür revanchierten sie sich gleich. Indem sie Entwürfe verfertigten. Für kleinen Silberschmuck. Aber sie malten auch. Und zwar Miniaturen. Auf Porzellan. Sowie auf kleinen Elfenbein-Plättchen. Die von Markowitsch als Broschen verkauft wurden. In Silber gefaßt. Natürlich. (Denn er war ja schließlich Silberwaren-Fabrikant.) Nun konnten sie also endlich durchstarten. Als Künstler-Compagnie. Gemeinsam. Uno. Pro omnibus. Et omnes. Pro uno. Das Individuum gibt sich auf. Zum Wohle der anderen. Einer für alle. Alle für einen.
Doch die ersten Aufträge für die nun eigenständige Künstler-Compagnie kamen nur spärlich herein. Zizerlweise. Eher kleine Fische. Die sie an Land zogen. So führten sie zum Beispiel in diesem ersten Jahre ihrer Selbstständigkeit lediglich Schablonen aus. Für Sgrafitti. An einem Privathaus. In der Goldschmiedgasse. In der Ersten Stadt. Also unweit des Stephansdomes. Den Rest besorgten die Handwerker. Denn so war es nun mal üblich. (Wenn man fertiger Künstler war.) Dann folgten elf kostümierte Figuren. Als Dekor. In Öl. Auf Holz. Also auf einem Schrank. Eines gewissen Herrn Munck. Im feinen Döbling. Nichts Besonderes. Eher unter ihrer Würde. Ein regelrechter Rückschritt. (Aber was tut man schließlich nicht alles. Wenn man jung ist. Und das Geld braucht.) Währenddessen ging natürlich auch die leidige – und schier unendliche – Arbeit an dem Mappenwerk ‚Allegorien und Embleme‘ weiter. Wofür Gustav Klimt erstmals nicht nur zeichnete. Sondern auch malte. Und zwar in Öl. Auf Leinwand. Das gab mehr her. Das war mehr wert. (Und wurde dementsprechend besser bezahlt.) Er malte eine Allegorie. Der Fabel. Als Vorlage. Diente es. Und dienten ihm. Die Klassischen Fabeln. Von Äsop. Und Jean de La Fontaine. Sowie die Alten Meister. Im Kaiserlichen und Königlichen Hofmuseum. Klimt erwies sich hierbei – und zwar zur völligen Überraschung seiner beiden Kollegen – als virtuoser Tiermaler11. Zwecks Recherchezwecken verbrachte er also in diesen Tagen sehr viel Zeit in den Kaiserlichen Sammlungen. Im Hofmuseum. Und im Belvedere. Denn Zeit. Die hatte er ja jetzt. Mehr. Als ihm lieb war. Beziehungsweise. Mehr. Als ihm lieb sein konnte. Und schon begannen die drei sich ernsthafte Sorgen zu machen. Nämlich um ihre Zukunft. (Und die ihrer Familie. Was die beiden Klimt-Brüder anbelangte.)
Von daher kam ihnen der Großauftrag des rumänischen Königs Carol I. gerade recht, den Fellner und Helmer an die Künstler-Compagnie vermittelten, wobei sie die drei jungen Künstler an die Wiener Ausstattungsfirma Kott weiterempfahlen. Ein wahres Mammutprojekt. Und ein Prestigeprojekt zugleich. Und gut bezahlt. Sehr gut sogar. (Aber es war auch eine Heidenarbeit. Die sie ganze drei Jahre lang beschäftigen sollte.) Und zwar gedachte Seine Majestät, Carol I., seine neu errichtete Sommer-Residenz, ein pittoreskes, historistisches Schloß in den Karpaten, in Peleş, Sinaia, gebührend einzurichten, weshalb er die Firma Kott verpflichtete, welche sich, ob des immensen Auftragsvolumens, wiederum an Fellner und Helmer wandte, die schließlich Experten auf diesem Gebiet waren und bei denen oft alle Fäden zusammenliefen, auch wenn sie selbst nicht direkt am Auftrag beteiligt waren, so daß letztendlich die Künstler-Compagnie mit der Ausstattung einiger Räume im Schloß beauftragt wurde. Dabei erwies sich das Rumänische Königspaar als äußerst schwierige Klientel, der offenbar nichts wirklich recht zu machen war, und die ihre Ideen, bezüglich der Errichtung des Schlosses, als auch der Einrichtung desselben, häufig änderte, wodurch sich sowohl die Bau- als auch die Ausstattungsarbeiten, empfindlich in die Länge zogen. Bereits im Jahre 1872, hatte der König dem Wiener Architekten Carl Wilhelm Christian Ritter von Doderer die Planung für Schloß Peleş übertragen. Im darauffolgenden Jahre, 1873, konnte mit dem Bau begonnen werden, wobei das Schloß letztendlich nicht im Sinne Doderers ausgeführt werden konnte. Wegen Unstimmigkeiten mit dem Bauherrn. Wegen „unüberbrückbarer künstlerischer Differenzen“ (wie man es heute beschönigend nennen würde), wurde dem verzweifelten Architekten im Jahre 1876 der Auftrag kurzerhand entzogen, weshalb dessen Assistent, Johannes Schultz, nun die Planung übernahm und das Schloß, zwischen 1879 und 1883, nach eigenen Entwürfen vollendete. (Eine Schmach. Für Doderer. Und nicht unbedingt von Vorteil. Für das Schloß selbst.)
Nach insgesamt zehnjähriger Bauzeit also, ging es nun an die Innenausstattung, wobei sich das Königspaar auch hier als äußerst heikel entpuppen sollte. Zig Künstler aus halb Europa wurden gleichzeitig mit der Einrichtung des Schlosses betraut, was mitunter ein heilloses Durcheinander ergab. Ein Stil-Mischmasch. Einen wilden Eklektizismus. Der nur schwerlich zu verdauen war. Denn die betreffenden Künstler kannten sich ja untereinander gar nicht, weshalb sie also ihre jeweiligen Auftragsarbeiten weder mit denen der anderen Ausführenden vergleichen- noch diesen anpassen konnten. Das sah letztendlich wohl auch der König. Und vor allem die Königin. Die sich hauptsächlich um alles kümmerte. Weshalb dann vieles wieder umgeplant und umgestellt wurde. Und zwar in letzter Minute. Allein der Auftrag an die Künstler-Compagnie, war umfassend. Und beinhaltete fünf große Auftragsgruppen. Zum einen waren zahlreiche Kopien nach alten Meistern aus dem K.u.K. Hofmuseum in Wien zu verfertigen. Zusätzlich sollten auch Gemälde für die Ahnengalerie entstehen – genauer gesagt zehn Ahnenbildnisse nach den Zollern und Hohenzollern. Ferner zwei Deckengemälde. Sowie ein ellenlanger Wandfries, der ursprünglich, bei Auftragserteilung, für den Musiksalon der Königin gedacht war, letztendlich aber im Schloßtheater landete. Dazu kamen noch neun Kartons mit Schablonen für Sgrafitti im Innenhof des Schlosses, wobei die drei Künstler diesen Auftrag als ersten erledigten, da sie ja schon aufgrund der Dekoration des Privathauses in der Goldschmiedgasse in Übung waren – außerdem war es von allen Teilaufträgen jener, der am wenigsten Zeit und Mühe erforderte. Für die neun Kartons, nach denen schließlich die Schablonen gestochen wurden, wählten sie, von Makart und Wagner inspiriert, das derzeit sehr moderne Thema der deutschen Nibelungen-Sage. Zudem folgten, wobei dieser Wunsch erst später deponiert wurde, noch weitere Schablonen für ein großes Sgrafitto-Bildnis, welches die große Turm-Uhr umrahmen sollte sowie eines, welches die Kreuz-Abnahme darstellen sollte, und zwar für die Außenwand der Schloßkapelle.
Was die geforderten zehn Ahnenbildnisse anbelangt, malte Gustav Klimt die eine Hälfte davon, während Franz Matsch die anderen fünf übernahm. Diese Arbeit knöpften sie sich als nächstes vor. Denn anfangs erschien ihnen dieser Auftrag als Kinderspiel. Und als reizvoll zugleich. So etwas hatten sie ja schließlich noch nie gemacht. Nämlich real existierende, historische Persönlichkeiten völlig neu und eigenständig zu interpretieren. Dennoch sollte sich gerade dieser Auftrag als große Herausforderung entpuppen. Denn der König hatte ihnen, eigens zu diesem Zwecke, ein Buch mit Stichen seiner Ahnen aus dem 16. Jahrhundert zugesandt, welches jedoch, wie sich schon bald herausstellen sollte, absolut nicht zu gebrauchen war, da die Stiche allesamt sehr grob und indifferent ausgeführt worden waren. Aus diesem Grunde hielten sich weder Gustav Klimt noch Franz Matsch (und das will schon was heißen!) an diese geradezu phantasmagorischen Stichvorlagen, die teilweise Herrscher aus der Jahrtausendwende abbildeten, also reine Hirngespinste waren, sondern erschufen, notgedrungen, vollkommen eigenständige Werke, wobei sie bei der Vergabe dieser Ahnenbilder untereinander, tatsächlich das Los entscheiden ließen. Mehr als die Hälfte dieser zehn Ahnenbildnisse wurde noch in diesem Jahre begonnen und in Öl auf großformatiger Leinwand ausgeführt. Sogar noch in diesem Jahr, konnte Gustav Klimt die Arbeit am ersten seiner fünf Bildnisse beenden, an jenem des ‚Philipp Friedrich Christoph Graf von Hohenzollern‘, wobei die nächsten beiden, ‚Eitel Friedrich VII., Graf von Zollern‘, sowie ‚Johann Georg Graf von Hohenzollern‘, noch im selben Jahre begonnen- aber erst im darauffolgenden Jahre, 1884, vollendet werden konnten. Überhaupt erst im kommenden Jahre angelegt und ausgeführt, wurden die letzten beiden Bildnisse, die des ‚Wolfgang Graf von Zollern‘ und ‚Friedrich I., Graf von Zollern‘. Wobei es hier eine schöne Anekdote gibt:
So standen sie also alle drei an ihren Staffeleien, die Palette in der Linken, den Pinsel in der Rechten, während draußen die Schwalben ihre Kreise vor dem Fenster zogen. Es war Sommer in Wien – und die Sommer in Wien sind für gewöhnlich sehr heiß, weswegen es in ihrem Dach-Atelier auch brütend heiß war, trotz geöffneter Fenster. Hätte es damals bereits Radios oder gar CD-Player gegeben, so wäre mit Sicherheit Musik gelaufen – aber es war still, und man hörte, außer dem Geschrei der Schwalben draußen, lediglich das leise Schaben der Pinsel auf den Leinwänden. Ab und zu pfiff einer von ihnen eine Melodie, oder begann ein Liedchen zu summen, in welches die anderen beiden sogleich einstimmten. Aber geredet wurde kaum. Eigentlich so gut wie gar nicht. Wegen der Konzentration. (Das hassen Maler nämlich für gewöhnlich. Sich bei ihrer Arbeit unterhalten zu müssen.) Deshalb war es umso ungewöhnlicher, als ausgerechnet Gustav Klimt plötzlich lautstark nach seinem Kollegen rief.
„He, Matsch!“, er lachte.
„Was?“, Franz Matsch schaute erst gar nicht von seiner Leinwand auf.
„Beweg Dich mal hier rüber und halt’ still!“
„Wieso?“
„Thu’s einfach!“
Franz Matsch legte also seinen Pinsel und die Palette auf das Stockerl neben ihm und schritt zu Gustav Klimt rüber, welcher auf der rechten Seite der Fenster arbeitete.
„Stell Dich ganz grad hin!“, sagte dieser, „Und versuch irgendwie majestätisch dreinzuschauen!“
„Wie?“
„Ja, wie ein Aristocrat!“
„Was soll der Schmarr’n?“
„Ach, ich soll da einen gewißen ‚Friedrich I., Graf von Zollern‘, portraitieren …“
„Na und? Dann thu’s doch! Seine Königliche Hoheit hat uns doch diesen Almanach mit Stichen seiner Ahnen zukommen lassen …“
„Ach, Franz! Du weißt doch genauso guth wie ich, daß man dieses Dingen gleich verfeuern könnt’! Das taugt wirklich zu gar nichts!“
„Und was hab ich jetzt damit zu thun? Wieso steh ich hier – wie bestellt und nicht abgeholt?“
„Na, weil ich Dich jetzt portraitieren werd’, Depperter!“
(Im Hintergrund hörte man Ernst Klimt lachen.)
„Bist wo ang’rennt? Wieso ausgerechnet mich? Nimm doch verflixt noch mal die Vorlage!“
„Ach so?“, Klimt legte den Pinsel und die Palette beiseite und griff nach dem Almanach, „Wie zum Teufel soll ich das hier als Portrait malen?“, er hatte die betreffende Seite aufgeschlagen und hielt sie seinem Kollegen unter die Nase.
„Oh …“
„Ja, genau: Oh!“, Gustav Klimt lachte, „Dieser Kerl lebte doch thatsächlich Anno 980!“
„Aber warum mich?“
„Na, weil Du ihm a bissi ähnlich schaust, find’st ned?“
„Naa, wirklich nicht …“
„Oh ja! Ernsti! Komm mal her! Schau mal!“, er hielt den Stich aus der Jahrtausendwende nun auch seinem Bruder unter die Nase, „Der Matsch schaut doch ganz genauso deppert aus wie dieses Krixi-Kraxi hier, find’st ned?“
Ernst Klimt prustete los.
„Nein, Gustl, wirklich nicht!“, begann Franz Matsch vehement zu protestieren, „Außerdem habe ich überhaupt gar keine Zeit dafür! Wer malt schließlich an meinem Bildnis weiter?“
„Wird schnellgeh’n!“, sagte Gustav knapp, während er bereits die Umrisse von Matschens Gesicht mit Kohlestift auf die Leinwand brachte, „Und jetzt halt still, verflixt und Eins!“
Und so kommt es, daß man heute, sobald man Schloß Pelesch in den Karpaten betritt, im zentralen Treppenhaus ein hochherrschaftliches Ahnenbild von Friedrich I., Graf von Zollern, erblickt, welches eigentlich ein exaktes Portrait Franz Matschens ist – und zwar in nahezu photographischer Genauigkeit ausgeführt. (Hätte das doch nur der König gewußt!) (Und die Königin erst!)
Da die Vorlagen, die der rumänische König ihnen zugesandt hatte, für eine seriöse Arbeit tatsächlich nicht zu verwenden waren, recherchierten die beiden Künstler, um die Darstellungen historisch so korrekt wie nur möglich zu gestalten, in der Kaiserlichen Hofjagd- und Rüstkammer in Wien. Bezüglich adäquater, historischer Vorlagen für die Harnische und Waffen auf ihren Gemälden. Und diese Arbeit zog sich wie gesagt über zwei Jahre hin, weshalb sie den dritten Teil ihrer Mammut-Aufgabe (die ihnen allmählich wie eine regelrechte Sisyphos-Aufgabe erschien), nämlich die Kopien nach den Alten Meistern, komplett ins zweite Jahr, also 1884, verlegen mußten. Der König von Rumänien wünschte nun mal im zentralen Treppenhaus sowie in einigen Sälen seines Schlosses, neben der besagten Ahnen-Galerie, auch einige Kopien Alter Meister aus dem Wiener Hofmuseum. Gustav Klimt jedoch, mochte derlei Kopier-Arbeiten, die er „stupide“ fand, überhaupt nicht. Franz Matsch hingegen war es egal. Aber Ernst Klimt, der ja immer die unliebsamen Aufträge für die anderen beiden übernahm und stets so lange brav und geduldig daran arbeitete, bis es perfekt war, liebte diese Tätigkeit. Und so kam es auch, daß Gustav und Franz jeweils nur ein Meisterwerk kopierten, Ernst hingegen zwei. Während Ernst also den ‚Jungen Feldherrn in Rüstung‘ nach van Dyck, sowie die ‚Katharina Cornaro‘ nach Tizian, kopierte, wählte Franz Matsch das ‚Portrait eines alten Mannes‘ nach Rembrandt, wohingegen Gustav Klimt sich für eine Kopie des Portraits der ‚Isabella d’Este‘ von Tizian entschied. Damit am Ende alles perfekt war, arbeiteten sie direkt vor den Originalen im Hofmuseum, beziehungsweise in der Kaiserlichen Galerie. (So ist unter anderem auch vermerkt, daß Gustav Klimt laut Copistenbuch des K.u.K. Hofmuseums am 28. April und am 5. Juni an seiner Kopie des Portraits der ‚Isabella d’Este‘ nach Tizian gearbeitet hat.) (Denn ein jeder Künstler mußte sich stets aus Sicherheitsgründen registrieren lassen, damit er am Ende nicht etwa das Original heraustrug und an seiner statt die Kopie aufhängte.) (Und so ist es auch heute noch.)
Doch nicht nur, daß die Kopien auch wirklich perfekt werden mußten, sie mußten auch perfekt wirken, weshalb sich die drei, die ihre Aufgabe sehr ernst nahmen, ebenfalls die größte Mühe bezüglich des Materials machten. Besonders große Schwierigkeiten bereiteten ihnen die verschiedenen Leinwände, denn sie wollten sich unbedingt, und zwar bis ins kleinste Detail, ans Original halten. Vor allem Gustav Klimt mußte für seine Tizian-Kopie sehr lange nach einer dessinierten, also struktural gemusterten, Damast-Leinwand suchen, was die Arbeiten natürlich noch zusätzlich in die Länge zog. Da er nun schon einmal bei der Sache war, fertigte er übrigens, gleichzeitig mit seinem Tizian-Portrait, ein Portrait seiner älteren Schwester Klara an. Während seiner Studienzeit bei Laufberger hatten sie jede Woche im Wiener Belvedere (denn dort hingen die Alten Meister noch vor der Fertigstellung des neuen Kunsthistorischen Hofmuseums auf der Ringstraße) Kopien nach Rubens und Tizian anfertigen müssen. Schon damals hatte Gustav es, im Gegensatz zu seinem Bruder, gehaßt. Und es stets als „fade G’schicht“ bezeichnet. Aber jetzt zahlte es sich plötzlich aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. (Außerdem war er ein wahrer Meister darin, wie sich nun herausstellen sollte.) Wie immer bei ihren Aufträgen, erfolgten zunächst Aquarelle, die schließlich eingeschickt wurden und bestätigt retour kamen. Dann erst konnte es an die Ausfertigung mit Öl auf Leinwand gehen.
Obwohl inzwischen alle gleich stark mit Arbeit eingedeckt waren, begann sich allmählich ein leiser Konkurrenzkampf zwischen Gustav Klimt und Franz Matsch anzubahnen. Bislang war ja stets Franz Matsch das Alphatier gewesen. (Zumindest hatte er sich dafür gehalten.) Doch nun, wo auch Gustav Klimts Selbstbewußtsein, proportional zu seinem beruflichen Erfolg, zunahm, kam es des öfteren zu Revierstreitigkeiten zwischen den beiden. Ernst, der jüngste (und der vernünftigste), hielt sich wie immer aus allem raus, tendierte aber im Zweifelsfalle naturgemäß eher zu seinem Bruder, was es wiederum auch für Franz Matsch nicht einfacher machte. Dazu kam noch, daß Gustav zwar ein sehr ruhiger und introvertierter Mensch war, daß er aber auch aufbrausend und sogar jähzornig werden konnte, wenn ihm etwas gegen den Strich lief. Stets hielt er so lange mit seinem Unmut hinterm Berg, bis dieser sich zu regelrechtem Ärger – oder gar Wut – angestaut hatte und sich dann sogar in lautem Geschrei entladen konnte. Besonders unangenehm in dieser Konstellation, konnte sein natürlich vorhandener Zynismus sein, der dann aber für seinen jeweiligen Kontrahenten sehr verletzend werden konnte.
Zum ersten wirklichen Konkurrenzkampf zwischen den beiden kam es noch in jenem Jahre, als nämlich alle drei ihre Entwürfe für zwei Deckengemälde – und zwar für das Musikzimmer sowie die Bibliothek der rumänischen Königin Elisabeth – einreichten. Gustav Klimts Entwurf ‚Dichter und Muse‘ war (wie so oft – beziehungsweise wie immer öfter) weitaus besser als jene seiner beiden Kollegen. Ernst war es (wie immer) egal, er riß sich schließlich nicht darum – außerdem war ihm nicht jener Ehrgeiz zu eigen wie den anderen beiden, die plötzlich damit begannen, zwar nicht wirklich gegeneinander zu arbeiten, aber sich zumindest gegenseitig auszuspielen. Und tatsächlich war das Ganze eher spielerisch zu verstehen, eine Art natürlicher Konkurrenz- und Machtkampf zwischen jungen Männern, die gerade erst volljährig geworden waren. Da Franz Matsch erkannte, daß er mit seinem Entwurf ‚Poesie‘ keine Chance hatte, griff er kurzerhand zu einer Finte. Er änderte, kurz vor dem Abgabetermin, noch ein kleines, aber nicht gerade unerhebliches Detail. Dieser Griff in die Trickkiste, sollte denn auch tatsächlich dazu führen, daß sein Entwurf, obwohl er, wie gesagt, um Längen schlechter war als jener Gustav Klimts, von der Königin bevorzugt wurde. Denn auch eine Königin ist vor Eitelkeit nicht gefeit. Und genau diese bediente Franz Matsch nun mal in seinem kurzerhand abgeänderten Entwurf:
„Oha!?“, mehr brachte Gustav Klimt nicht heraus, nachdem sie gemeinsam das Couvert mit der Antwort der Königin höchstpersönlich aufgeschnitten hatten.
Ernst schwieg, sah aber kurz und verstohlen zu seinem Bruder, in dessen Gesicht er die Enttäuschung sehen konnte.
„Gratulation, Franzl!“, sagte Gustav schließlich. Aber es klang nicht sehr herzlich.
„Danke, danke!“, entgegnete dieser. Und ließ seiner Freude über die Wahl seines Entwurfes freien Lauf.
„Moment mal …“, Ernst beugte sich über Matschens Aquarellzeichnung, auf der sich, als einziger, der Vermerk: „approuvé“ befand, um sie genauer betrachten zu können, „Du hast da doch wohl nicht …“
„Oh, doch!“, Franz war außer sich vor Freude. Zumal er soeben seinen schärfsten Konkurrenten aus dem Wege geräumt hatte – und das, obwohl er selbst zugeben mußte, daß dessen Entwurfszeichnung wesentlich besser war als seine eigene.
„Schau mal, Gustl!“, Ernst hielt seinem Bruder, der sich bereits wieder seiner Arbeit zugewandt hatte, das Blatt hin, „Sieh Dir das Gesicht der ‚Poesie‘ nur einmal genauer an!“
„Was? Was soll schon damit sein?“, fuhr Franz Matsch entnervt dazwischen, „Ja! Ich habe die Poesie eben mit den Zügen der rumänischen Königin ausgestattet! Ist das etwa verbothen?“
„Nein. Verbothen ist es nicht …“, erwiderte Gustav mit frostiger Miene, „Aber abgesprochen war es nicht!“
„Ach …“, Franz sah sich theatralisch im Atelier-Raum um, „Ich wußte gar nicht, daß es bei uns diesbezüglich eine Satzung gibt!?“
„Eine Satzung brauchen wir auch gar nicht, weil es völlig normal ist, daß wir alles untereinander absprechen, bevor die Entwürfe zu den Clienten gehen! Schließlich hängen wir da ja alle mit drin!“, rief Gustav nun aufgebracht.
„Willst Du es jetzt etwa halten wie dieser verrückte Marx?“, keifte Franz erregt zurück, „Ich habe ja schließlich wohl das Recht auf eine eigene Arbeits-Weise!?“
„Das ist keine eigene Arbeits-Weise, sondern eine eigene Arbeits-Taktik – und zwar eine hundsgemeine, Du elender Schleimer!“
„Wieso?“, Franz verstand scheinbar die Welt nicht mehr.
„Na, Du weißt schließlich ganz genau, was für eine eitle Gans das ist!“
„Wie?“, Franz schien ein etwaiges Fehlverhalten seinerseits beim besten Willen nicht einzusehen, „Nur weil ich ihr Conterfei in meinen Entwurf eingefügt habe?“
„Nun …“, Gustav unterdrückte nur mit Mühe seinen Ärger über das in seinen Augen unkollegiale Verhalten seines Associés, „Du weißt genauso guth wie wir – denn wir alle hatten uns ja noch kurz vor der Abgabe darüber unterhalten – daß die Königin von Rumänien eine verkappte Schriftstellerin ist, die unter dem Pseudonym Carmen Sylva, welches schon alles über die Qualität ihrer literarischen Ergüße aussagt und welches zudem natürlich nieeeemand in Rumänien kennt, weshalb sich ihre Machwerke ganz sicher ausschließlich aufgrund ihrer extrem hohen literarischen Qualität zu Abertausenden verkaufen, vor sich hin schreibselt … Und jetzt fügst Du in Deinen klammheimlich abgeänderten Entwurf, der – ausgerechnet! – auch noch Poesie lautet, für ein Deckengemälde in – ausgerechnet! – ihrer Bibliothek, auch noch – ausgerechnet! – ihr Conterfei ein!? Das ist unlauterer Wetterwerb! Das ist gemeinste und niederträchtigste Lèche-culerie! Reinste Schleimerei! Und Augenauswischerei! Das ist unseriös! So arbeiten wir hier nicht, Du Gfrast12!“
„Na und?“, Franz zuckte mit den Schultern, „Ich bediene eben nur die Wünsche und die Eitelkeiten meiner Clientel! Sonst nichts weiter! Wie hat Meister Makart damals noch so schön gesagt: ‚Gebt den Menschen, was sie wollen!‘ – ‚Was ihr wollt!‘ – Shakespeare! Respective ‚Lection Numero Eins‘! Ihr erinnert euch?“
Diese zynische Antwort seines Kollegen/Konkurrenten brachte Gustav fast auf die Palme.
„Na, dann merk Dir jetzt einmal Lection Numero Null, Du Beutel13 …“, fuhr er Franz aufgebracht an, wobei er voll in seinen Wiener Dialekt hineinrutschte und es ‚Beidl‘ aussprach, „Wir arbeiten hier alle gemeinsam – und zwar genau so, wie wir das von Anfang an abgesprochen hatten! Es gibt hier weder Extra-Würschterl noch Sonder-Behandlungen – noch anderweitige persönliche Eitelkeiten zu bedienen! Es geht nicht an, daß einer von uns, kurz vor der Abgabe, seinen eigenen Entwurf noch einmal verändert, ohne Absprache mit den anderen! Es gibt hier bei uns kein Ich! Es gibt nur ein Wir! Hast Du das etwa schon vergeßen? Denn sonst kannst’ gleich Deine eig’ne G’schicht anfang’n! Da brauchst’ uns beide and’ren nehmlich gar ned dazu, Du Koffer14 …“
Damit war die Sache geklärt. Und doch. Sollte es unterschwellig weiterbrodeln. Zwischen den beiden Streithähnen. Und in acht Jahren. Als der jüngste von ihnen plötzlich und tragisch versterben sollte. Da würde letztendlich auch die Künstler-Compagnie daran zerbrechen. Denn bei einem Trio. Ist schließlich stets ein Puffer dazwischen. Wo drei sich zusammentun. Entsteht eine Kirche. Sagt man. Aber wo zwei übrigbleiben. Gibt es nurmehr zwei Möglichkeiten. Entweder sie bilden ein Duo. Ein Tandem. Eine Ehe. Oder sie bilden eben Rivalität aus.
Noch während sie an den Kopien nach den Alten Meistern sowie an den letzten Ahnenbildnissen saßen – und nun auch noch die Deckenbilder am Hals hatten – begannen sie mit dem Fries für das Musikzimmer der Königin, mit dem Titel ‚Allegorie der Musik‘, in Öl auf Leinwand, welcher insgesamt ganze fünfzehn Meter lang werden sollte, weshalb sie ihn aus acht Teilen anfertigen mußten. Darauf folgten dann noch sieben weitere Arbeiten für den Theater-Saal. Die Königin jedoch schien an den Arbeiten der Compagnie nicht wirklich interessiert zu sein (längst hatte sie andere Künstler gefunden, die ihr mehr zusagten), weshalb sie deren Arbeiten halbherzig von einem Raum in den anderen tragen ließ. Von Links. Nach Rechts. Von Oben. Nach Unten. Und so geschah es auch, daß der fünfzehn Meter lange Fries, der ja ursprünglich für ihr Musikzimmer gedacht war, letztendlich im Schloß-Theater landete, welches jedoch recht klein geraten war, weshalb der Fries kurzerhand auseinander- und zurechtgeschnippelt wurde – ein Sakrileg, vor allem wenn man bedenkt, daß der große Meister selbst, Gustav Klimt, dabei Hand angelegt hatte. Wenn auch weitaus weniger als sein Bruder, der den Löwenanteil an dieser monotonen und repetitiven Klein- und Feinarbeit übernommen hatte. Ihre Arbeit wurde ihnen also in diesen ersten Jahren nicht wirklich gedankt. Sie waren ja, wie gesagt, auch noch sehr jung. Zudem waren sie auch noch keine wirklich anerkannten Künstler. Nicht einmal in Wien. Geschweige denn. Im Ausland.