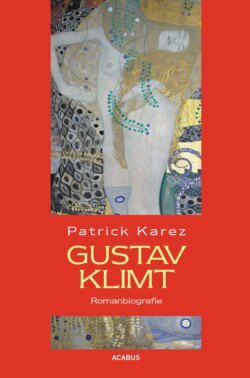Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 16
11
ОглавлениеDoch bei Professor Ferdinand Julius Laufbergers Worten, so anstrengend seine ellenlangen Vorträge für manche Schüler mitunter auch sein mochten, handelte es sich keineswegs bloß um heiße Luft! Er war schließlich ein höchst professioneller Vollblut-Künstler, zudem extrem gut vernetzt, der alles und jeden ganz genau im Blick hatte. So erkannte er auch die außergewöhnliche Begabung seiner drei Schüler sofort. Und bald schon sah er in ihnen seine Thronfolger heranwachsen – jene, die eines Tages sein Werk weiterführen sollten. Und dies sollte schon sehr bald sein, denn Professor Laufberger starb, völlig unerwartet, nur zwei Jahre später. Da war er erst zweiundfünfzig Jahre alt.
Er beteiligte die drei deshalb, wie bei der ersten Unterredung versprochen, sehr bald an seinen öffentlichen Aufträgen. Vor allem für die Gebrüder Klimt bedeutete dies einen schier unglaublichen finanziellen Aufstieg. Ihre gesamte Familie profitierte nun davon. Sie waren plötzlich der ganze Stolz des Vaters, Heilige für die Mutter, und Helden in den Augen ihrer Geschwister. Vor allem der jüngeren. Seitdem sie die Klasse für Malerei besuchten, fielen ihnen die Aufträge förmlich nur so zu. Ihr Stipendium, das an sich schon sehr großzügig und ein Segen für die ganze Familie war, konnten sie bald schon dadurch aufbessern, indem sie zum Beispiel Zeichnungen von Ohrenpräparaten für den damals bekannten Ohrenarzt Professor Adam Pollitzer anfertigten. Vor allem Gustav interessierte sich sehr für die menschliche Anatomie. Außerdem sollten immer mehr private Aufträge für Portraits hinzukommen, die sie hauptsächlich nach Photographien anfertigten. Und tatsächlich. Sie verlangten sechs Gulden. Und sie bekamen auch sechs Gulden.
„Meine Herren!“, Laufberger betrat das Atelier, in welchem all seine Kunststudenten sich soeben in Farbschattierungen übten, „Matsch, Klimt und nochmals Klimt, bitte zu mir!“
Gustav, Ernst und Franz tauschten irritierte Blicke aus und folgten schließlich ihrem Meister in sein Zimmer.
„Klimt … Klimt …“, murmelte dieser, nachdem die Tür verschlossen war, „Was ist das überhaupt für ein Name? Etwa böhmisch? Nein. Das klingt ja schon fast scandinavisch, finde ich …“
„Unser Vater stammt aus Böhmen!“, beeilte sich Ernst Klimt zu sagen.
„Ach so?“, Laufberger horchte auf, „Von wo denn da?“
„Aus Drabschitz, bei Leitmeritz, in Nord-Böhmen!“
„Ach!“, Professor Laufberger schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte vor ihm, „Das gibt es doch gar nicht! Kinder, wie klein die Welt doch ist!“
Die drei Burschen tauschten leicht irritierte Blicke aus.
„Stellen Sie sich nur vor: Ich selbst habe sieben Jahre lang, nehmlich von 1837 bis 1844, in Schüttenitz, bei Leitmeritz, gelebt – also in exact derselben Gegend, aus der scheinbar Ihre Vorfahren stammen! Ich selbst war da erst acht Jahre alt, als es meinen Vater dorthin verschlug – und lebte dort, bis ich fünfzehn Jahre alt war …“, er schien plötzlich mit seinen Gedanken ganz woanders, „Ach, Kinder, wie die Zeit vergeht! Kaum zu glauben, wohin es einen im Laufe eines Menschenlebens verschlägt! In Italien und in Paris war ich ja auch …“
„Ja, Sie haben dort im Atelier von Léon Cogniet Act-Malerei studiert!“, beeilte sich Matsch hinzuzufügen.
„Oha! Na, wir sind aber guth informiert!“, Laufberger schien wirklich beeindruckt, „Ja, die Act-Malerei ist nach wie vor mein Steckenpferd! Man sagt mir nach, daß ich sehr begabt darin sei. Also geben Sie alle in Zukunft guth Acht! Sie werden es in Ihrem Leben ganz sicher noch guth gebrauchen können. Jeder Maler thut dies!“
Nun nickte vor allem Gustav Klimt. Ah! Akt-Malerei! Also Nackt-Malerei! Endlich! Modelle. Frauen. Nackte Frauen! Rote. Blonde. Brünette. Schwarze … Aber vor allem Rote! Ja. Das war es. Die Aktmalerei. Und tatsächlich. Sollten seine Aktzeichnungen später für Furore sorgen. Von Frauen nämlich. Von nackten Frauen. Von Roten. Und Blonden. Und Brünetten. Und Schwarzen … Aber vor allem von Roten.
„Ach, Paris …“, Laufberger war nun offensichtlich ins Träumen geraten, „Im Jahre 1863 machte ich dort meine Zusatz-Ausbildung … Da war ich zwar bereits vierunddreißig Jahre alt – aber, mein Gott, was für ein süßes Leben, in Paris … War einer von Ihnen schon einmal dort?“
Nun nickten alle drei in der Horizontalen. Und zwar völlig synchron.
„Na, was rede ich da auch – Sie sind ja grad erst einmal um die Fünfzehn, Sechzehn, nicht wahr? Aber warten Sie’s nur ab – Sie alle werden noch dahinkommen! Ein jeder Künstler muß dahinkommen! Paris … Ach, Paris …“
Und tatsächlich versuchten sich die drei jungen Männer diese Stadt vorzustellen. Die Hauptstadt der Kunst. Die Hauptstadt der Liebe. Des Vergnügens. Des Lasters. Der Sünde. Der fleischlichen zumindest. Und zumindest einem von ihnen sollte es nicht vergönnt sein, Paris mit eigenen Augen gesehen zu haben.
„Nun, weshalb ich Sie eigentlich hierher bestellt habe …“, Laufberger setzte eine bedeutungsvolle Miene auf, „Ich habe guthe Nachrichten für Sie drei! Sehr guthe sogar! Und zwar gibt es bereits den ersten Auftrag für Sie!“
Die drei begrüßten diese Ankündigung mit großem Hallo. Obwohl sie noch nicht lange bei Professor Laufberger studierten, war das Eis zwischen ihnen mittlerweile gebrochen und man traute sich, etwas mehr aus sich herauszugehen.
„Wie Sie alle vermuthlich wissen, begeht das ehrwürdige Kaiser-Paar heuer seine Silberne Hochzeit. Deshalb wird auf der Ring-Straße ein großer Fest-Zug vorbereitet, der, wie ich gehört habe, geradezu fulminant werden soll, denn kein Geringerer als Hans Makart hat sich seiner Ausrichtung angenommen …“
Hans Makart! Die Augen der drei Studenten wurden ganz groß. Und das sah auch Professor Laufberger.
„Ja, Sie haben richtig gehört!“, sagte er, „Wiens Maler-Fürst höchst-persönlich, wurde mit der gesamten Organisation betraut – und Sie können sich sicherlich vorstellen, wie prächtig das Ganze dementsprechend ausfallen wird. Schließlich ist Makart berühmt für seine … nun, nennen wir es … Extravagance!“
Dies war den Dreien sehr wohl bekannt. Jedem in Wien war es das. Und nicht nur in Wien. Denn Hans Makart war ein Phänomen. Ein Unikat sowieso. Und über die Reichs- und Landesgrenzen hinaus bekannt.
„Man nennt diesen Fest-Zug zur Ehrung und Huldigung des Kaiser-Paares deshalb schon im Vorfeld den ‚Makart-Festzug‘!“, Laufberger lächelte, „Der officielle Titel lautet natürlich: ‚Festzug zur fünfundzwanzigjährigen Vermählungs-Feier des Allerhöchsten Kaiser-Paares, veranstaltet von der Haupt- und Residenzstadt Wien‘, aber kein Mensch nennt ihn so … Am 27. April ist es übrigens schon so weit – das Allerhöchste Kaiserpaar hat zwar an einem 24. April geheirathet, doch heuer fällt der 24. April auf einen Donnerstag, weshalb die Festivitäten mit dreitägiger Verzögerung, am darauffolgenden Sonntage, stattfinden werden … Sie sehen also, es bleibt weiß Gott nicht mehr viel Zeit übrig, um diesen Jubiläums-Festzug vorzubereiten!“
„Am 27. April schon?“, fragte Franz Matsch, „Aber das ist ja wirklich schon sehr bald! Wie weit ist man denn mit den Vorbereitungen?“
„Nun …“, Professor Laufberger lächelte, „Nicht sehr weit, um ehrlich zu sein … Meister Makart ist ja nicht gerade für seine lang-fristigen Planungen bekannt … Aber er arbeitet außergewöhnlich rasch! Das ist sein großes Steckenpferd. Und gleichzeitig auch seine Achilles-Ferse, sein wunder Angriffspunkt, bezüglich all seiner Neider – und derer gibt es ja viele, wie Sie sicherlich bereits gehört haben … Nein, er arbeitet wirklich außer-ordentlich schnell! Also mache ich mir diesbezüglich keine großen Sorgen … Allerdings hat er sich gestern an mich gewandt – und an einige andere Künstler ebenso – denn selbstverständlich muß er einiges an Arbeit delegieren … Die Arbeit an einigen Fest-Wagen zumindest, denn der Meister gibt nur höchst ungern etwas aus der Hand, müssen Sie wissen … Nun, wir Künstler, die er mit dieser Arbeit betraut hat, benöthigen selbstverständlich die Hilfe unserer Schüler – denn ohne sie, könnten wir diesen wahrhaftigen Berg an Arbeit wohl kaum bewältigen … Und nun kommen also Sie ins Spiel, meine Herren!“
Die drei Burschen staunten nicht schlecht. Für sie war es nicht nur eine wichtige berufliche Erfahrung, sondern eine wahre Ehre, an diesen Vorbereitungen beteiligt zu sein. Zumal in diesem Alter! Der erst sechzehnjährige Gustav Klimt, würde erst im Juli seinen siebzehnten Geburtstag begehen. Und sein Bruder Ernst, war überhaupt nur knapp fünfzehn Jahre alt.
„Sie kennen den Meister persönlich?“, fragte Franz Matsch voller Bewunderung.
„Aber selbstverständlich kenne ich Hans Makart persönlich!“, entgegnete Laufberger, nicht ohne Stolz, „Ich kenne sie alle! Mit Hans Makart, oder etwa auch mit Emil Jacob Schindler, verbindet mich sogar eine enge, jahrelange Freundschaft!“
Schindler! Makart! Vor allem Makart! Der unbestrittene Malerfürst Wiens! Die drei Studenten bekamen ihren Mund gar nicht mehr zu.
„Natürlich könnte ich da auch etwas arrangieren …“, Laufberger lächelte etwas selbstgefällig, „Ich kann mir vorstellen, wie wild Sie darauf sein müssen, Makarts legendäres Atelier in der Gußhaus-Straße zu besichtigen!“
Makarts Atelier! Oh ja! Die drei tauschten untereinander freudige – und vor allem erwartungsvolle – Blicke aus.
„Wir werden sehen, was sich diesbezüglich thun läßt … Sie werden ihn ja im Rahmen der Planungen ohnehin kennenlernen, denn er beguthachtet alles stets höchst-persönlich – und darüber hinaus überaus acribisch!“
Na, wenn das heute Abend die Eltern erführen! Und die Geschwister. Aber allen voran der Vater. Er würde vor lauter Stolz auf seine beiden ältesten Söhne glatt übergehen!
„Sie wissen ja, daß Hans Makart bereits zu Lebzeiten zur Legende geworden ist …“, fuhr Professor Laufberger fort, „Ganz Wien spricht ja nurmehr vom Makart-Stil, von der Makart-Einrichtung – gar vom Makart-Kragen und vom Makart-Bouquet! Derzeit ist wirklich alles Makart, hier bei uns im schönen, neuen Wien! Und während der kommenden Ball-Saison, da werden die Festivitäten vermuthlich nicht etwa mit ‚Alles Walzer!‘ eingeläutet, wie sonst üblich, sondern mit: ‚Alles Makart!‘…“, er lachte, „Und nun stellen Sie sich einmal vor – ich selbst weiß es auch erst seit kurzem und zwar aus äußerst vertrauens-würdiger Quelle – daß heuer noch der Beschluß gefaßt werden soll, in der Stadt Salzburg, den Hannibal-Platz in Makart-Platz umzubenennen! Stellen Sie sich das nur einmal vor! Wann erlebt man so etwas schon? Zumal als Künstler! Zumal in Österreich! Ausgerechnet! Nein, welch unglaubliche Ehre für den Meister! Wem wird die schon zutheil? Zumal noch zu Leb-Zeiten?“
Diese Worte Laufbergers waren ein regelrechter Ansporn für Gustav Klimt. Denn Makart war schon seit jeher sein großer Held gewesen. Und er selbst, sah sich seit jeher schon als dessen glühender Bewunderer. Als sein Adept. Sein Schüler. Sein Jünger. Sein Novize. Sein Neophyt. Sein Initié. Sein Eromenos. Und nicht nur das. Eines Tages wollte er genauso werden wie der große, berühmte Meister. Das war sicher. Und er würde es auch. Während Franz Matsch eher wie Professor Laufberger werden würde. Sollte Klimt zu einem neuen Makart werden. Denn er sollte den Platz einnehmen. Des Malerfürsten. Der bald schon frei werden würde. Sehr bald sogar. Obwohl niemand damit rechnete. In diesen Tagen. Denn da war Makart ja erst neununddreißig Jahre alt. (Aber bereits syphilitisch.)
„Makart hat nicht etwa bloße Scizzen angefertigt“, fuhr Professor Laufberger fort, „sondern gleich, und zwar in aller-kürzester Zeit, einen ganzen Gemälde-Cyclus geschaffen! Ich habe ihn gestern mit eigenen Augen gesehen! Darin stellt er sehr … nun, sagen wir: in überaus opulenter Arth und Weise, die einzelnen Gruppen in ihren Costümierungen dar, vornehmlich im Gewandt der Dürer-Zeit. Ganze vierzehntausend Personen sollen übrigens costümiert an diesem Fest-Zuge theilnehmen!“
„Vierzehntausend Personen?“, Franz Matsch sprach das aus, was sie alle drei dachten, „Und alle costümiert?“
„Jawohl, so ist es! Sie sehen also, meine Herren, es wartet ein ganzer Haufen Arbeit auf uns! Gehen wir es an!“
Und der 27. April kam rasch. Rascher als erwartet jedenfalls. Noch während der allerletzten Tage (sogar Stunden!) wurde gehämmert. Und befestigt. Genäht. Und gesteckt. Gesägt. Und verdeckt. Geschmückt. Und bestückt. Damit alles auch ja perfekt werden sollte. Denn Makart war ein unverbesserlicher Perfektionist. Das hier war zweifelsohne sein ganz großer Tag. Ein Triumph. Der Höhepunkt seiner Karriere. Am heutigen Tage. Einem Sonntag. Strömte alles auf die Ringstraße. Nicht nur ganz Wien. Sondern auch die Vororte. Und nicht nur das. Es kamen ganze Delegationen. Und Vertretungen. Aus den Österreichischen Ländern. Aus den Kronländern sogar! Auch die Familie Klimt machte sich auf. Mit Sack. Und Pack. Mit Kind. Und Kegel. War man zeitig aufgebrochen. Um einen guten Stehplatz zu ergattern. Mit freier Sicht. Auf das Spektakel. Aber auf diese Idee waren Zehntausende andere auch schon gekommen. Deshalb wurde es ein ganz schönes Gedränge. Über dreihunderttausend Zuschauer sollten kommen. Die Gendarmen hatten alle Hände voll zu tun. Um die schier unendlichen Menschenmassen gefahrlos zu leiten. Denn eine Massenpanik hätte bei dem Ganzen grad noch gefehlt. Schließlich war ja das allerhöchste Kaiserpaar anwesend. Franz Joseph. Und Elisabeth. Von Österreich. Und nicht nur das. Die gesamte Kaiserliche Familie würde diesem Spektakel beiwohnen. In einem offenen Festzelt. Vor dem Äußeren Burgtor. Während sich der Festzug im Prater längst in Bewegung gesetzt hatte.
Das Défilé erreichte die Ringstraße. Jubel und Applaus machte sich breit. So etwas bekam man nur sehr selten zu Gesicht. In diesen Tagen. Als es weder Fernsehen noch Kino gab. War dies ein noch weitaus größeres Erlebnis als die Theater- oder Opernbühne. Als ein Konzert. Oder eine der gängigen öffentlichen Darbietungen. Und es spielte sich zudem vor der prächtigen Kulisse der nagelneuen Wiener Ringstraße ab. Noch war natürlich längst nicht alles fertig. Aber es nahm allmählich Gestalt an. Die unansehnlichen Baustellen hatte man mit Tüchern verdeckt. Mit Fahnen. Und Wimpeln. Und anderen Draperien. Auf strikte Anweisung Hans Makarts hin. Denn alles sollte perfekt sein. Und das wurde es auch. Ein besseres Ambiente für diesen Jubiläums-Festzug, zu Ehren des Kaiserpaares, hätte man sich gar nicht denken können. Und hätte es die Ringstraße nicht gegeben, so hätte man sie eigens dafür erfinden müssen.
Und so artete der Festzug zu einem Gesamtkunstwerk aus. Zu einem Wiener Gesamtkunstwerk. Muß man sagen. Denn nirgends auf der Welt hätte man sich eine derartige Mühe gemacht. Zumal für sein Kaiserpaar. Das man in Wien über alles liebte. In diesen Tagen. Geriet der Zug tatsächlich zu einer gelungenen Huldigung an das vollständig versammelte Kaiserhaus. Sogar das Wetter spielte mit. Wobei tatsächlich ganze vierzehntausend Personen daran teilnahmen. (Und nicht etwa bloß als Zuschauer. Sondern als Darsteller. Um und auf den Umzugswagen.) Und überdies allesamt kostümiert. Und wie! Das ellenlange Spektakel, das von Musikkapellen begleitet wurde, begann mit einer Gruppe von Fahnen- und Standartenträgern. Alle Flaggen der Österreichischen Monarchie wurden geschwenkt – unter großem Jubel und Beifall der Vertreter der jeweiligen Kronländer, welche ebenfalls die Ringstraße säumten. Nach diesem bunten Fahnenmeer marschierten die Berufszeichen, mitsamt ihren diversen Berufsprodukten, auf. Die Kostüme reichten vom Hochmittelalter bis in die frühe Neuzeit. Also die Renaissance. Die Dürerzeit. Wie Makart es nannte.
Auf den prächtig geschmückten Festwagen präsentierten sich nun die Zünfte. Die jeweiligen Handwerker stellten stolz ihre Waren zur Schau, natürlich ebenfalls à l’ancienne kostümiert, wobei sie den Zuschauern auch die Abläufe der einzelnen Produktionsprozesse veranschaulichten. So druckte zum Beispiel auf einem der Wagen ein offensichtlich gut gelaunter (beziehungsweise gut betankter) „Johannes Gutenberg“ seine Chroniken auf einer altertümlich anmutenden Presse. (Wobei ihm sein monströser Hut immer wieder ins Gesicht rutschte.) Und nicht nur das! Anschließend verteilte er sie sogar unter den Zuschauern. Überhaupt war man sehr spendabel heute. Die Handwerks-Zünfte verteilten großzügig ihre Waren – ein jeder Zuschauer sollte schließlich eine Erinnerung an diesen unvergeßlichen Tag mit nach Hause nehmen können. Aber unvergeßlich würde dieser Tag ohnehin bleiben. Kein Mensch, der heute hier anwesend war, würde ihn jemals wieder vergessen können. Auch Gustav Klimt nicht. Diese gewaltigen Menschenaufläufe waren ihm zwar suspekt (und beinahe schon zuwider), doch er erkannte, welche Macht von einem einzelnen Künstler ausgehen kann. Dies alles entstammte schließlich der Phantasie eines einzigen Mannes! Nein. Wirklich. Die Illusion war nahezu perfekt. Das mußte auch er zugeben. Die Kostüme und die Wagen waren derart gut gemacht, wirkten derart authentisch, daß man sich tatsächlich in die Dürerzeit hineinversetzt fühlen konnte. Zumal, wenn die Festwagen just die Prachtbauten im Stile der Neo-Renaissance passierten.
Nach dem Handwerk und den jeweiligen Zünften, zogen nun auch die Großhändler ein. Sowie die Schiffahrt. Die Eisenbahn. Der Berg- und Maschinenbau. Und so weiter. Und so fort. Das hatte mit der Dürerzeit nicht mehr viel gemein. Aber schließlich wollte man nicht nur in alten Zeiten schwelgen. Sondern zeigen. Was man hatte. Und wer man war. Österreich war ein hochmodernes Land. Damals. Und Wien war das Zentrum. Eine Großmacht. Eine Weltmacht sogar. Damals. Und doch ist es wirklich noch nicht so lange her. Überraschend. Machte auch der Adel an jenem Tage mit. Er präsentierte sich mit einer historischen Jagd. In atemberaubenden Kostümierungen. Und demonstrierte so seine Verbundenheit. Mit dem allerhöchsten Kaiserhause. Woraufhin nun die Künstlerschaft folgte. Hans Makart hatte diese ganz bewußt ans Ende des Zuges gestellt. Als Höhepunkt sozusagen. Als Finale furioso. Des weiteren setzten sich die Künstler mittels ihrer Kostüme ab. Denn die Dürerzeit stand nicht unbedingt für das Klischeebild des Künstlers. Zumal eines Malerfürsten. Für das Fürstliche mußte vielmehr die Barockzeit herhalten. Also war man plötzlich in der Rubenszeit. Ein gewaltiger Zeitsprung. Ein wilder und nur schwer verdaulicher Eklektizismus4. Aber alle verziehen es ihm. Denn keinem fiel es auf. Schließlich sah ja die ganze Ringstraße so aus.
Was hier am heutigen Tage präsentiert wurde, war, trotz allem, doch mehr Schein. Als Sein. Es war schlichtweg eine Vorstellung. Eine Wunschvorstellung. Denn dies alles spiegelte nicht unbedingt die krude Realität wider. Man verschwieg ganz einfach. Und verschleierte. Man überspielte. Und lenkte ab. Nämlich vom großen und fatalen Börsenkrach. Von 1873. Und das war ja schließlich erst sechs Jahre her. Also erst gestern. Den Handwerkern – und dem Handwerk im Allgemeinen – ging es seither auch nicht mehr so gut. Zumal ja die immer stärker einsetzende Massenproduktion in diesen Tagen das Handwerk allmählich verdrängte. Statt der Handwerker zogen also Fabrikarbeiter in die Vorstädte. Einfache Tagelöhner. Womit eine völlig neue Gesellschaftsschicht entstand. Die nicht zu leugnen war. Und auch nicht zu übersehen. In diesen Tagen. Nämlich das Proletariat. Das hatte mit der Dürerzeit nun wahrlich nichts zu tun. Es war übrigens auch das letzte Mal, daß sich die menschenscheue Kaiserin Elisabeth von Österreich in der Öffentlichkeit zeigte. Genau neunzehn Jahre später sollte sie von einem Fanatiker in Genf heimtückisch ermordet werden. Und der Kronprinz und designierte Thronfolger Rudolf von Österreich sollte nur zehn Jahre später in Mayerling ein nicht minder tragisches und gewaltsames Ende finden. Überhaupt sollte es nurmehr neununddreißig Jahre dauern, bis die glorreiche Donaumonarchie – ja, das gesamte Deutsche Reich – in seinen letzten Zügen lag, um schließlich, nach beinahe tausend Jahren seines Bestehens, ein für allemal abgeschafft zu werden. Die Zeiten änderten sich einfach viel zu schnell. In diesen Tagen. (Und nicht unbedingt zum besseren). (Aber im Nachhinein ist man immer schlauer als zuvor.)