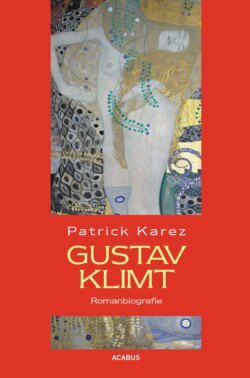Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 7
3
ОглавлениеAber das alles war bereits ein Jahr her. Inzwischen hatte sich einiges verändert. Die Welt hatte sich verändert. Wien hatte sich verändert. Die Wirtschaftslage hatte sich verändert. Die Auftragslage hatte sich verändert. Der Vater hatte sich verändert. Und der Sohn hatte sich verändert. Inzwischen war er zwölf Jahre alt. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. In diesem Alter. Ob man nun elf. Oder zwölf Jahre alt ist. Mit elf Jahren ist man noch ein Kind. Da sieht man die Welt noch durch eine rosarote Brille. Durch die Augen eines Kindes eben. Mit zwölf hingegen, ist man fast schon erwachsen. Da sieht man die Welt dann plötzlich klar und nüchtern. Eben so. Wie sie nunmal ist. Auch den Vater. Und der beschwerte sich immerzu. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. So kam es dem Sohne jedenfalls vor. Der Vater jammerte. Und beklagte sich. Und schließlich. Bemitleidete er sich sogar. Selbst. Ach! Und. Oh! Weh! Wäre seine Familie doch niemals von Böhmen hierher nach Wien gezogen! Pflegte er immerzu zu sagen. Schließlich traf es ja bei einem Börsenkrach und bei einer Wirtschaftskrise die Hauptstadt stets zuerst. Und zudem noch unmittelbarer. Und um ein Vieles härter. Als die Provinzen.
Die Mutter weinte oft. In letzter Zeit. Tat es der Vater vermutlich auch. Aber wenn, dann nur heimlich. Und nicht vor den Kindern. Natürlich. War er ein eigenbrötlerischer Typ. Nicht ungesellig. Aber ein ruhiger und wortkarger Mensch. Der seinen Kummer stets in sich hineinfraß. Und cholerisch war er auch. Wenn ihm alles zu viel wurde. Da wußte er sich nicht besser zu helfen. Als zu schreien. Und zu brüllen. Wie ein Affe. Wie ein Pavian. Und zu toben. Und sogar Watschen auszuteilen. Das hatte er wiederum von seinem Vater geerbt. Es vererbte sich. Das Übel. Von Vater. Auf Sohn. Von Generation. Zu Generation. Auch Gustav würde dies noch zu spüren bekommen. Es sollte ihm sehr vieles verbauen. Genauso wie dem Vater. Andere, die nicht cholerisch waren, die sich beherrschen konnten, wurden sogar mitunter in den Adelsstand erhoben. Choleriker hingegen nicht.
Die Mutter jedoch, eine „waschechte Wienerin“, wie sie sich selbst zu bezeichnen pflegte (obwohl ihre Familie aus dem Burgenland stammte) war genau das Gegenteil. Sie hielt nicht lange mit ihrer Meinung zurück. Und hinterm Berg. Das konnte sie nicht. Denn ihr fehlte es an Selbstkontrolle. Ihr Temperament war es. Das ging stets mit ihr durch. Oftmals weinte sie. Und schrie. Um im nächsten Augenblick wieder zu lachen. Stets redete sie drauflos. Ohne zuvor überhaupt nachgedacht zu haben. Eigentlich immer. So zumindest empfand es der junge Gustav. Sie plapperte. Und schnatterte. Und übertrieb. Und bauschte auf. Und sah schwarz. Wo noch Licht war. Und keinen Ausweg. Wo ein letzter Funke Hoffnung war. Zerstörte Träume. Rächen sich. Immer. Und führen stets zu großem Frustrationspotential. Und somit zu großen Emotionsausbrüchen. Zumal bei Menschen mit Temperament. Zumal bei kreativen Menschen. Deren Kreativität niemals gefördert wurde. Deren Kreativität brutal im Keim erstickt wurde. Und somit niemals ausgelebt wurde. Das führte dann zu diesen ganz großen Emotionsausbrüchen. Bühnenreif. Das ganz große Drama.
Wüste Streitereien zwischen den Eltern waren daraufhin die unausweichliche Folge. Stets wurde alles nach Außen gekehrt. Laut. Und theatralisch. Zumindest von Seiten der Mutter. Die keinen Hehl daraus machte, daß sie gerne Opernsängerin geworden wäre. Wenn sie gutgelaunt war (was immer seltener war). So sang sie fröhliche Arien. Cosi fan tutte. La Traviata. La Cenerentola. Während sie die Wäsche aufhängte. Ging es ihr jedoch schlecht (was immer öfter der Fall war). So glich es der Aufführung eines Dramas. Norma. Medea. Macbeth. Der Gesang wurde dann schnell zum Geschrei. Hoch. Schrill. Und durchdringend. Es drang. Durch Mark und Bein. Und es ging. Einem ans Herz. Vor allem den Kindern. Denn die Kinder vermochten es nicht auseinanderzuhalten. Was denn nun Theater war. Und was bitterer Ernst. Wenn die Mutter fröhlich war. Dann richtig. (Und zwar so, daß es der halben Nachbarschaft zuteil wurde.) War sie aber unglücklich. Dann ebenfalls richtig. (Und zwar so, daß die ganze Nachbarschaft die Fensterläden schließen mußte.) Himmelhoch jauchzend. Und zu Tode betrübt. Eigentlich hätte sie die Böhmin sein müssen. Und der Vater der Wiener. Aber es war genau umgekehrt. Dann hieß es stets: „Ich hätte eine große Carrière im K.u.K. Hof-Opern-Theater machen können! Alle meine Musik-Lehrer bescheinigten mir stets ein ausgesprochenes Talent! Doch was ist statt dessen geschehen? Da sitze ich nun in der Vorstadt, in einem Loch von Behausung, mit sieben Kindern am Hals – und weiß nicht einmal, wie ich sie durchfüttern soll!“
Für Gustav und seine Geschwister lag es auf der Hand. Sie waren das Problem! Gäbe es sie nicht, so hätte das Leben der Mutter keine derart unerfreuliche Wendung genommen. Dann wäre sie heute eine gefeierte Operndiva. Mit Audienzen. Beim Kaiser. Und mit einer Villa. Nahe Schönbrunn. Doch es war alles ganz anders gekommen. Eben weil sie gekommen waren. Seine um zwei Jahre ältere Schwester, Klara, pflegte ihn in derartigen Situationen stets beiseite zu nehmen und zu trösten. Der Vater sagte zu alledem nichts. Er schwieg sich aus. Und so waren es die Frauen. Welche das Leben des Jungen bestimmten. Allem voran die Mutter. Mit ihrem ausgeprägten Sinn für Theatralik. Vom Gemüt folgte der Sohn ganz seinem Vater. Und doch verstand er sich besser mit der Mutter. Eben weil sie so lebhaft war. Und irrational. Denn war schließlich nicht das ganze Leben so? Sind nicht gerade dies die beiden Hauptattribute des Lebens? So dachte er. Lebhaftigkeit. Und Unvernunft. Schienen ihm zudem auch die Hauptattribute einer jeden Frau zu sein. Schließlich kannte er es ja nicht anders.
Außerdem förderte die Mutter seine Phantasie. Sie bestätigte ihn. Sie bestärkte ihn. Im Zeichnen. Und zwar im freien Zeichnen. Kritisiert ein Vater seinen Sohn durchaus. Und zwar immerzu. Zumal, wenn er selbst ein Künstler ist. Also ein Fachmann. In diesen Dingen. Dann weist er stets auf die falsche Proportion hin. Selbst wenn diese vom Sohne durchaus beabsichtigt war. Er weist auf die schiefe Optik und auf die unschlüssige Perspektive hin. Selbst wenn diese vom Sohne beabsichtigt war. Er kritisiert die unzulängliche Schraffur. Selbst wenn diese vom Sohne beabsichtigt war. Muß er es einfach tun. Ob er will. Oder nicht. Denn schließlich obliegt ihm die korrekte Schulung seines Sohnes. Eine Mutter hingegen, die lobt ihren Sohn. Sie findet alles gut. Was er macht. Und zwar immer. Selbst wenn er ein Meuchel- und Massenmörder ist. Das liegt in der Natur. Der Sache. Und einer Mutter. Denn Mutter und Sohn. Das ist eine ewige, verzwickte und vertrackte Geschichte.
Sie ermunterte ihn. Zum Malen. Mit Farben. Fehlte natürlich das Geld. Und zwar völlig. Also zeichnete er. Mit Stift. Und Papier. Allerdings auch nicht. Denn dafür fehlte das Geld ebenfalls. Aber er zeichnete dennoch. Und trotz alledem. Und zwar mit allem. Was er finden konnte. Manchmal. Wenn der Köhler kam. Und dem Jungen ein paar Bruchstücke Kohle in die Hand drückte. Manchmal. Bei Aushubarbeiten. Unweit des Hauses. Wenn alte Tonziegelscherben zum Vorschein kamen. Wurden diese schnell eingesackt. Denn mit ihnen ließ es sich ebenfalls vortrefflich zeichnen. Auf dem Boden. Vor dem Haus. Kohlrabenschwarz. Und Ziegelrot. Was bei den Nachbarn natürlich immer wieder auf grobes Unverständnis stieß. Und ihm regelmäßig Ärger einbrachte. (Denn die Bewunderung für sein Genie hielt sich in diesen jungen Jahren noch in Grenzen.) Die zwei kläglichen Schulstifte. Und die drei teuren Schulhefte. Dienten wohl kaum als Zeichenmaterial. Obwohl er es heimlich dennoch versuchte. Aber er hatte da natürlich auch die Kreiden. Und die kleine Schiefertafel. Die dienten ihm bald täglich als Zeichenwerkzeug. Ein sehr vergängliches allerdings. Aber war es nicht mit allem so? Wie gewonnen. So zerronnen. Dachte er. Nichts ist für die Ewigkeit. Und ins Grab geht man schließlich nackt. Und so weiter. Und so fort. Alles schlaue Sprüche der Mutter. Die ja nun wirklich nichts hatte. Was sie ins Grab hätte mitnehmen können. Sie hatte ja nicht einmal etwas. Zu verlieren.
Längst schon hatten sich die Lehrer damit abgefunden. Der junge Klimt ist ein fleißiger Zeichner. Sagten sie. Und überdies sehr talentiert. Ständig wurde er nach vorn gerufen. An die Tafel. Weil er die schönste Handschrift hatte. Und zwar mit Abstand. Und wie er es liebte! Da vorn zu stehen. So prominent. Und von allen bewundert. Wenn schon nicht daheim. Dann hier. In der Schule. Ja. Er liebte es. Zur Schule zu gehen. Denn hier war es besser als daheim. Viel besser. Man hatte mehr Platz. Man hatte sogar ein eigenes Pult. (Mit einem Geheimfach sogar!) Und eine eigene Sitzbank. Hier war es warm. Auch im Winter. Immer geheizt. Was man von seinem Zuhause nicht unbedingt behaupten konnte. Er liebte die Schule. Und er war ein außerordentlich guter Schüler. Sehr gut sogar. Niemals hatte er schlechte Noten. Er liebte es. Dieses Gefühl. Gebraucht zu sein. Zu etwas nütze zu sein. Eine Aufgabe zu haben. Eine Beschäftigung. Denn wahres Genie muß beschäftigt werden. Und zwar immerzu. Es muß lernen. Und er liebte es. Zu lernen. Zu schreiben. Und zu zeichnen. Auf dieser Tafel. Vor den Augen aller. Mit diesen Kreiden. Das war pure Magie für ihn. Ein Inbegriff der Schönheit. Und der Vergänglichkeit. Alle Liebesmüh war bald schon wieder hinweggewischt. Mit einem nassen Schwamm. Und dennoch. Auf zu neuen Taten! Die Übung macht ja schließlich und bekanntlich den Meister! Sie hatten ebenfalls einen Löwenanteil an seiner späteren Künstlerkarriere. Diese Tafel. Und diese Kreiden. Sogar farbige Kreiden gab es! Die Reste, die zu Boden fielen, die steckte er sich manchmal in die Tasche, um daheim damit arbeiten zu können. Eigentlich mehr spielen. Als arbeiten. Denn ein anderes Spielzeug hatte er selbstverständlich nicht.
Den Lehrern war es nur recht so. Daß da wer an der Tafel stand. Und ihnen die Arbeit abnahm. Die halbe Arbeit. Zumindest. (Denn kein Lehrer liebt es, an die Tafel zu schreiben.) Und mehr noch. Einige von ihnen förderten und unterstützten ihn noch darin. Ein Handwerk konnte schließlich niemals schaden. Zumal in Zeiten wie diesen. Wo Wien praktisch neu entstand. Wo es völlig neu erfunden wurde. Da brauchte man Handwerker. Aller Art. Und gute obendrein. Das sagte nicht nur der Vater. Das sagte auch der Zeichenlehrer. Der dem Jungen ab und an Bleistifte und Papier zusteckte. Damit er üben könne. Brav. Und fleißig. War er selbst unverheiratet. (Wie fast alle Kunstlehrer. Ergo gescheiterten Künstler.) Und verdiente recht passabel. Somit konnte er den Jungen fördern. „Er hat nun mal ein ausgesprochenes Talent, dieser Klimt.“ Pflegte sein Zeichenlehrer stets zu sagen. Nicht zu ihm direkt. Aber zu den anderen. Zu seinen Mitschülern. Und die bewunderten ihn dafür. Neidisch waren sie nicht. Als Kind ist man neidisch auf anderes. Auf die Glasmurmeln der anderen. Zum Beispiel. (Weil man selbst nur eine Handvoll Murmeln aus Ton besitzt.) Auf die Bonbons der anderen. Auf die schönen Zöpfe. Oder auf die neuen Strümpfe. Aber niemals auf Talent. Das kommt erst später. Wenn man erwachsen ist.
Aber schließlich fällt der Apfel ja nie weit vom Stamm. Immerhin verfügte sein Vater als Graveur über eine außerordentlich ruhige Hand. Und war selbst ein sehr guter und genauer – wenn auch ein wenig phantasieloser – Zeichner. Aber dieses Manko an Phantasie, machte dann seine Mutter mit einem Streich wieder wett. Auch wenn es ihnen, materiell gesehen, am schlechtesten ging, fertigte sie für die Kinder rasch Kostüme aus Stoffresten, Decken oder Laken an. Und ließ sie damit Szenen aus den derzeit modernen Opern nachspielen. Durch sie empfing der junge Gustav sein gutes Gehör und seine tiefe Liebe zur Musik. Und was war es schließlich anderes. Das Malen. Als lediglich eine Art visuelle Umsetzung kosmischer Musik. Die man als Künstler immerfort empfängt. Entweder, man gibt sie, mittels eines Instruments, wieder. Oder aber man sublimiert sie. Und läßt sie, lediglich mittels eines anderen Mediums, sich manifestieren. Zu Materie werden. Die sich dann sehen lassen kann. AN.sehen. Und AN.fassen. Also ER.fassen. Beziehungsweise. AN.greifen. Und BE.greifen. Und zwar für alle. Auch für jene, welche nicht imstande sind, diese kosmische Musik zu hören.
Da das Geld für ein Piano oder eine Violine bei weitem fehlte, übertrug der junge Klimt seine Musik in Striche und Kurven. Unter besseren Umständen wäre er wohl ein Klaviervirtuose geworden. Doch die Umstände dienen stets dem Schicksal. Das konnte er in diesen jungen Jahren noch nicht wissen, aber bald wüßte er es. Das Schicksal hatte Größeres mit ihm vor. Wäre er als verzogener Sohn reicher Eltern zur Welt gekommen, so hätte er wohl die Bank- oder Produktionsgeschäfte seines Vaters übernommen. Sie übernehmen müssen. Zumindest damals. Wäre dann, in seinem pflichterfüllenden Alltagsleben, mit Sicherheit kein Platz mehr für Musik, oder gar für Malerei, gewesen. Da er jedoch in völliger Armut heranwuchs, lernte er bereits sehr früh, sich in die Welt der Kunst zu flüchten. Seine Phantasie auszuleben. Auf sein Gefühl zu vertrauen. Und nicht auf das Gefühl anderer. Auf die göttliche Stimme zu hören. Und nicht auf die Stimmen anderer. Somit schult man sich im Schöngeistigen. Denn ein Schöngeist, der ist und bleibt immer ein Schöngeist. Und ein Künstler, der ist und bleibt immer ein Künstler. Komme, was wolle. Denn er ist es. Schon vom Augenblicke seiner Geburt an. Und er bleibt es. Auch lange über den Augenblick seines Todes hinaus. Ein Künstler ist immerwährend. Er ist universell. Wie die göttliche Musik. Die er immerzu empfängt. Oder die Worte. Oder die Bilder. Er wird aber erst durch seine Lebensumstände zu dem, was er ist. Zu dem, was er sein soll.
Das alles wußte der junge Mann noch nicht. Der sich soeben auf der Schwelle befand. Vom Kindsein. Zum Mannesalter. Dessen Bartflaum erst in den letzten Tagen zu sprießen begann. Ganz vorsichtig. Und am liebsten. Spielte er. Mit Tieren. Oder mit der Stoffpuppe seiner Schwestern. Auf der anderen Seite aber. War er für sein junges Lebensalter ausgesprochen ruhig. Und vernünftig. Teilweise. Nahezu. Weise. Denn er verstand es bereits in jungen Jahren. Im Einklang mit der Natur zu leben. Was bedeutet: im Einklang mit seiner Natur. Im Einklang mit sich selbst. Er erkannte seine Aufgabe. Er erkannte seine Bestimmung. Und die lautete: Künstler werden. Und der Welt Schönes zu geben. Sie an seiner inneren Schönheit teilhaben zu lassen. Eine Welt, die an sich nicht gerecht war. In der es unbeschreiblich mehr Verlierer als Gewinner gab. Das wußte er. Denn das hatte er am eigenen Leibe erfahren müssen. Seine ganze Familie gehörte eindeutig dazu. Zu den Verlierern.
Wenn man kein Geld für Schönes hat. Dann muß man das Schöne eben ersinnen. Man muß es sich ausdenken. Es zum Vorschein bringen. Mittels weniger Striche. Oder Gesten. Es in die Welt bringen. Es sich materialisieren lassen. Ein Künstler ist ein Medium. Er vermittelt zwischen zwei Welten. Der sichtbaren. Und der unsichtbaren. In der sichtbaren Welt. Lebten die Klimts wie Vagabunden. Zu neunt in einem Zimmer. In Bassena-Wohnungen. Mit morschen und knarrenden Pawlatschengängen. Winzigen Fenstern. Und feuchten Wänden. Die Jüngsten weinten. Immerzu. Weil sie Hunger litten. Die Ältesten hielten tapfer den Mund. Immerzu. Doch da gab es noch die innere Welt. Die Welt des Lichts. Die Welt des Reichtums. Die Welt des Glücks. Im Grunde, so sollte er später erkennen, ist der Künstler nichts anderes als ein Priester. Ein Geistlicher. Auch er erkennt die andere Welt. Auch er sieht sie als gegebene Realität an. Auch er macht sich diese andere Welt zu nutze. Um anderen Menschen zu helfen. Um sie glücklich zu machen. Denn ein Künstler schafft stets für andere. Niemals. Für sich allein.
Und schließlich, doch auch das sollte er erst viel später erkennen, gibt es kein Glück. Ohne Leid. Keine Schönheit. Ohne Häßlichkeit. Denn erst das Leid. Erzeugt das Glück. Es erzeugt die Fähigkeit. Das Glück überhaupt erst erkennen zu können. Und genauso verhält es sich mit der Häßlichkeit. Nur wer die Häßlichkeit kennt. Wer sie gesehen hat. Der kann sie von der Schönheit unterscheiden. Und der. Der nichts hatte. Der die absolute Armut und den totalen Verzicht am eigenen Leibe erfahren hat. Nur der ist überhaupt in der Lage. Das zu schätzen. Was er später hat. Und überdies. Anderen etwas davon zu geben. Etwas von Herzen zu geben. Zu teilen. Und sei es nur sein Mitgefühl. Es ist insofern nur gerecht. Unter Umständen. Daß man als Künstler Geld dafür bekommt. Einen Lohn. Eine Entschädigung. Eine Kompensation. Für all die aufgebrachte Mühe. Und Zeit. Denn auch ein Künstler. Lebt nicht. Allein. Von Luft. Und Liebe. Aber es ist keine Voraussetzung. Fürs Geben. Zudem mindert dieser Lohn die Art der Gabe nicht. Und genauso wenig vergrößert er sie. Denn ein Meisterwerk ist. Und bleibt. Für immer. Und ewig. Ein Meisterwerk. Auch wenn es nichts kostet. Kostet es viel. Umso besser. (Für den Künstler.)