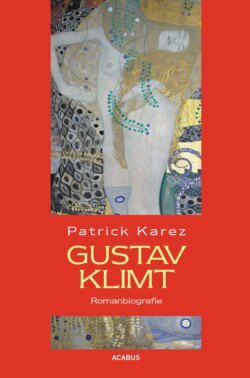Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 25
19
ОглавлениеWährend also, parallel zu der Ausstattung der Privat-Villa der Österreichischen Kaiserin, die umfassenden Ausstattungsarbeiten für das Stadttheater von Fiume noch immer in Gange waren und jene für das Nationaltheater in Bukarest eigentlich bald in Angriff genommen werden mußten, während jene für das Stadttheater von Karlsbad demnächst schon eingeschickt werden sollten und zudem auch die scheinbar kein Ende nehmen wollenden Ausstattungsarbeiten für Schloß Pelesch in Sinaia fortliefen, kam nun auch schon der nächste Großauftrag herein. Und was für einer! Die drei waren ja davon ausgegangen, daß ihre Arbeiten für Ihre Majestät, die Kaiserin von Österreich, durch nichts mehr zu übertreffen seien, doch sollte noch im Jahre 1885 der erste Staatsauftrag hereinkommen. Und zwar in Wien, im Rahmen der imposanten Ringstraßenbauwerke, welche immer noch nicht alle vollendet waren. Zumal dieser exklusive Auftrag, bei dem die Künstler-Compagnie erstmals die gesamten Ausstattungsarbeiten auszuführen hatte, ohne sich den Kuchen mit anderen Künstlern teilen zu müssen, erstmals direkt vom Architekten, ohne Mittelsleute und zwischengeschaltete Firmen, an die Künstler-Compagnie vergeben werden sollte. Ein kometenhafter Aufstieg. Für die drei. Und eine ungemeine Bereicherung. Für die Stadt Wien.
Es war also in jenem Jahre, als eines Tages plötzlich kein geringerer als Ritter Eitelberger von Edelberg, begleitet vom berühmten Ringstraßenarchitekten Freiherr von Hasenauer, ohne Vorankündigung im Dachatelier der Künstler-Compagnie in der Sandwirtgasse erschien, unter dem unverbindlichen Vorwand, sich die Deckengemälde für das neue Stadttheater in Fiume ansehen zu wollen, welche bereits kurz vor ihrer Vollendung standen. Nachdem der erste Schrecken verdaut war, bat Ernst Klimt, welcher die Tür geöffnet hatte, die beiden Herren herein. Während man noch dabei war, den Herrschaften Kaffee oder Tee anzubieten, schritten diese geradewegs auf die großformatigen Leinwände zu, um diese eingehend zu studieren.
„Aha!“, machte Hofrat Eitelberger, während er Gustav Klimts zukünftiges Plafondgemälde mit dem Titel ‚Allegorie der Musik‘, welches eine Orgelspielerin darstellte, genauer unter die Lupe, beziehungsweise unter den Zwicker, nahm, „Der Einfluß Michelangelos ist unverkennbar!“
„Jawohl, Hochwohlgeboren!“, erwiderte Gustav Klimt, „Ich habe ihn im vergangenen Jahre eingehend studiert – die Herrschaften können an der gegenüberliegenden Atelier-Wand übrigens auch mein Werk mit dem Titel Idylle erkennen, welches im vergangenen Jahre entstanden ist …“
„Bemerkenswerth!“, sagte Eitelberger, während er, auf seinen Gehstock gestützt, zur gegenüberliegenden Atelierwand schritt, „Ganz bemerkenswerth! Es wurde ja im Gerlach’schen Mappen-Werk der ‚Allegorien und Embleme‘ publiciert, nicht wahr?“
Gustav Klimt nickte.
„Nun, es sieht im Original noch um ein Vieles beßer aus als in der Reproduction! Geradezu meisterhaft, diese Muskel-Partien … Ist es Stein oder Mensch? Eine vom Menschen gestaltete Sculptur oder Gottes eigenhändig erschaffene Sculptur, nehmlich der Mensch selbst? Wirklich respectabel, zudem durchaus eines Michelangelo würdig, wenn nicht gar ebenbürthig …“
„Auch ich darf Ihnen Dreien gratulieren!“, schaltete sich nun auch Hasenauer ein, „So etwas in der Arth, hatte ich mir nehmlich auch für mein neues Hofburg-Theater auf der Ring-Straße vorgestellt, welches ja bereits in drei Jahren eröffnet werden soll, wie Sie vielleicht wissen …“
Die Augen der drei jungen Künstler wurden immer größer.
„Nein, wirklich – ich bin mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden!“, fuhr Hasenauer fort, „Und diese Plafond-Gemälde hier, erscheinen mir sogar noch um einiges beßer als das, was Sie zur Zeit in meiner Hermes-Villa vollenden … Sie arbeiten um einiges beßer, so scheint es mir, wenn Sie die völlige Freiheit bei der Ausführung – oder überhaupt bei der gesamten Conception – haben, nicht wahr?“
Die drei nickten.
„Nun denn …“, Hasenauer war bereits im Gehen begriffen, wandte sich schließlich aber noch einmal zu den drei Künstlern um, „Natürlich muß ich zunächst noch die Ateliers anderer Wiener Künstler inspicieren …“, sagte er, „weshalb ich Ihnen jetzt noch keine definitive Zusage machen kann … Aber bereiten Sie sich bitte nun allmählich darauf vor, daß Sie vermuthlich, so ab dem kommenden Jahre, das gesamte Hofburg-Theater auf der Ringstraße ausmalen werden – und zwar Sie drei allein! Was bedeutet: Es könnte durchaus sein, daß Sie bald den Auftrag für die insgesamt zehn, wirklich überaus groß-dimensionierten Plafond-Bilder in den beiden Haupt-Stiegen-Häusern des Theaters – der wichtigste, sozusagen der neuralgische Punkt, des gesamten Bau-Werkes also – erhalten werden … Ich empfehle mich, die Herrschaften …“
Nachdem die beiden hohen (und für ihre Verdienste vom Kaiser in den Adelsstand erhobenen) Herren das Atelier wieder verlassen hatten, war das Hallo herinnen kaum zu überhören. Umgehend legten die drei jungen Künstler ihre Pinsel und Paletten weg, um sich unten, in einem Weinlokal, ein gutes Gläschen zu genehmigen. Oder zwei. Oder sogar drei. Zur Feier des Tages. Auch hier hatten sie wieder mehr Glück gehabt. Als Verstand. Denn nur wenige Wochen darauf, verstarb Ritter Eitelberger von Edelberg. Der auch kein methusalemisches Alter erreichte. Aber immerhin etwas älter wurde. Als all die anderen. Nämlich. Achtundsechzig.
Erst am 20. Oktober des darauffolgenden Jahres, also 1886, ging dann schließlich der offizielle Auftrag bei der Künstler-Compagnie ein. Das war ihnen auch nur recht so, denn die Arbeiten für Fiume sowie für die Privat-Villa der Kaiserin in Lainz hatten noch im Vorjahre abgeschlossen werden können. Das Stadttheater von Karlsbad sowie Schloß Pelesch in den Karpaten wurden noch im Laufe des Jahres mit den angeforderten Arbeiten beschickt. Die drei jungen Künstler waren also ihre größten Aufträge los. Und somit auch ihre größten Sorgen. Denn ein geradezu gigantisches Volumen wie das Burgtheater war unter gar keinen Umständen zu bewältigen, zumal in nur zwei Jahren, wenn man nebenher noch auf vielen anderen Hochzeiten tanzen mußte. Also fuhren sie mit der Droschke hin, über die neue Ringstraße, welche endlich ihre endgültige Gestalt anzunehmen begann. In diesen Tagen. (Nur das sogenannte Kaiserforum, von Gottfried von Semper entworfen, mit den geplanten Zwillingsbauten der Neuen Hofburg, welche, à la Louvre, bzw. à la Bernini-Kolonnaden am Petersplatz, an die Zwillingsbauten der beiden großen Museen anschließen- und über zwei prächtige Triumphbögen über die Ringstraße mit diesen verbunden werden sollten, würde niemals vollendet werden können. Weil ja dann schon, noch während der Arbeiten daran, der Erste Weltkrieg ausbrechen sollte. Und weil es danach keine Monarchie mehr gab. In Österreich. Und nicht nur dort. Womit bereits die Saat gesät war. Des Bösen. Nämlich für einen weiteren Weltkrieg. Der noch viel schlimmere Blüten treiben sollte. Als der erste. Nur zwanzig Jahre später.)
Im neuen Burgtheater wurden sie bereits vom Architekten, Carl Freiherr von Hasenauer, sowie vom artistischen Direktor des Burgtheaters, Adolph von Wilbrandt, empfangen. Beim Betreten des Gebäudes war ihnen sofort die absolute Kahlheit und Leere der Decken und Wände ins Auge gestochen, ein strahlendes und makelloses Weiß, welches Gustav Klimt – in seiner ‚Ehrlichkeit‘, wie er fand – jedoch schwer beeindruckte. Man müsse schließlich nicht immerzu alles ausmalen, zumal bis in den allerletzten Winkel, dachte er. Und doch sollte er hier genau dies tun müssen.
„Meine Herren!“, Hasenauer schritt auf die drei jungen Künstler zu. „Darf ich vorstellen: Hofrath Adolph von Wilbrandt, künftiger artistischer Director dieses wunderschönen neuen Kaiserlichen und Königlichen Hof-Burg-Theaters, für welches auch Gottfried von Semper verantwortlich zeichnete – zumindest bis zu dessen Weggang aus Wien im Jahre 1876, also nur drei Jahre vor seinem Thode, Gott hab ihn selig! – und welches wir beide gemeinsam im Jahre 1874 begonnen haben …“
Die drei Künstler stellten sich artig beim künstlerischen Leiter des künftigen Burgtheaters vor.
„Sie drei werden mir die gesamten Plafonds hier in den beiden Stiegen-Häusern sowie den centralen Plafond mit Frescen bedecken!“, kam dieser ohne Umschweife zur Sache, während er auf die kahlen, weißen Wände ringsherum deutete. „Eine überaus ehren- aber auch verantwortungsvolle Aufgabe, wie Sie sich sicherlich denken können! Schließlich wird ja ein jeder hierherkommen – vom Hofrath bis zu Seiner Majestät, dem Kaiser, persönlich – und das für viele Jahrhunderte lang, denn dieses Gebäude ist äußerst solide gebaut – ich selbst habe mir davon einen fundierten Überblick verschaffen können …“
Hasenauer nickte zufrieden. Und sichtlich geschmeichelt.
„Sie werden zwei Jahre Zeit dazu haben!“, fuhr Adolph von Wilbrandt fort, „Das klingt zunächst nach sehr viel, aber Sie werden schon noch sehen, wie enorm zeitaufwendig diese Arbeiten sein werden. Es handelt sich um riesige Flächen, wie Sie ja sicherlich bereits von hier unten aus erkennen können!“
Alle drei schauten nach oben.
„Und natürlich sind diese gar riesenhaften Flächen nicht mit Staffel-Bildern zu bewältigen, weshalb Sie also directement auf den Marmor-Verputz hier arbeiten werden, und zwar in Öl …“
„Dieses Procedere kennen Sie ja bereits aus der Hermes-Villa!“, bemerkte Hasenauer kurz, woraufhin die drei jungen Künstler bejahend nickten.
„Ich habe dazu eigens ein Programm erarbeitet …“, führte Wilbrandt seine Erläuterungen weiter aus, „Wie Sie diese dann schließlich im Détail ausführen werden, bleibt ganz und gar Ihnen überlassen. Mit der Arbeit an den Plafond-Frescos, werden Sie also dann unverzüglich beginnen, nachdem Sie mir freundlicherweise Ihre détaillierten Aquarell-Scizzen vorgelegt haben – und diese von mir als geeignet befunden wurden. Für die Giebel-Felder über den Eingängen allerdings, eilt es nicht so sehr. Damit können Sie sich derweil noch Zeit lassen …“
Alle drei nickten.
„Das Programm, welches ich ersonnen habe, soll die Entwicklungs-Geschichte des Theaters von der Antike bis Heute aufzeigen – und zwar hier, an den beiden Stiegen-Aufgängen… In jedem der beiden Treppen-Häuser sind jeweils vier Plafond-Bilder sowie eine Darstellung im Giebel-Feld über dem Eingang geplant … Wer von Ihnen was macht, werden Sie ja sicherlich untereinander auftheilen, nicht wahr?“
Die drei nickten.
„Nun denn …“, fuhr er fort, „Im rechten, südlichen Stiegen-Hause, beginnen wir zunächst mit dem antiken Thema, also dem Ur-Theater, wenn man so will, nehmlich mit dem ‚Thespis-Karren‘, einer Arth fahrende Wander-Bühne der Antike, was schließlich, weiter oben, im ‚Theater Shakespeares‘ gipfeln wird, wobei es schön wäre, sein Drama ‚Romeo und Juliet‘ darzustellen … Zum dazu-gehörigen Giebel-Feld hatte ich mir den ‚Altar des Dionysos‘ vorgestellt, wegen der theatralischen dionysischen Fest-Gelage, der sogenannten Symposien, wo sich sowohl Satyr, als auch Mänade, ein wildes Stell-Dich-Ein gaben. So etwas kommt in einem Theater schließlich immer guth bei den Besuchern an …“
Die drei nickten. Und wie es später das Los entscheiden sollte, würde Gustav Klimt dieses südliche Stiegenhaus übernehmen.
„Es folgen dann eine weitere ‚Griechische Theater-Scene‘, wobei mir das Sophocles-Stück ,Antigone‘ sehr am Herzen läge – sowie das ‚Theater Molières‘ natürlich, mit dessen wohl berühmtesten Stücke, ‚Der eingebildete Kranke‘!“
Diese beiden Arbeiten sollten, per Los-Entscheid, zum einen Franz Matsch, zum anderen Gustavs Bruder Ernst, zugewiesen werden.
„Weiter geht es nun im linken, respective im nördlichen Stiegen-Hause …“, die drei jungen Künstler sowie der Architekt, Carl von Hasenauer, folgten Adolph von Wilbrandt, der allerdings nur einige wenige Stiegen empor schritt. Man sah die Plafonds ja schließlich auch von hier unten, „Hier, in der Mitte, dem neuralgischen Punkt des Theaters, wünsche ich mir das ‚Theater in Taormina‘ – falls Sie es nicht persönlich gesehen haben, so schauen Sie bitte dementsprechend in den Kaiserlichen Sammlungen nach – es ist wirklich einer der schönsten und zauberhaftesten Orthe unseres Erden-Rundes, überdies mit einer geradezu dramatischen und wildromantischen Topographie – also fordere ich von demjenigen von Ihnen, der es ausführen wird, aller-größte Erhabenheit und antike Elegance!“
Diese Aufgabe sollte, per Los, Gustav Klimt zufallen.
„Es folgen nun der ‚Antike Improvisator‘ – Sie sehen, die Antike ist natürlich die Wiege des Theaters – allein dieses Wort ist ja bereits aus dem Alt-Griechischen entlehnt – aber dann kommt denn doch etwas anderes, nehmlich die ‚Mittel-Alterliche Mysterien-Bühne‘ sowie, im Giebelfeld, paßend zu jenem südlichen, der ‚Altar des Apoll‘…“
Diese Arbeiten sollte, ebenfalls per Los-Entscheid, Franz Matsch besorgen.
„Und zu guther Letzt bleibt uns da noch der ‚Hans-Wurst auf der Stegreif-Bühne zu Rothenburg‘ – auch ein sehr wichtiges Bild und eine wichtige Entwicklungs-Station des Theaters, nehmlich die spontane, comédiantische Improvisation auf der Bühne – das, was man in diesen Tagen wohl neumodisch als Cabaret bezeichnen würde …“
Dieser Auftrag sollte, per Los, Ernst Klimt zugeteilt werden, der die Szene übrigens auch zusätzlich als Staffeleibild ausführen sollte. Somit sollten sowohl Gustav Klimt, als auch Franz Matsch jeweils vier der zehn Deckenfresken, in Öl auf Marmorputz, ausführen, Ernst Klimt hingegen nur zwei. Was die beiden Giebelfelder anbelangt, konnten die drei jungen Künstler selbst bestimmen, was sie dort dem Publikum zeigen wollten. Sie orientierten sich allerdings nach den antiken Sujets, also den jeweiligen antiken Göttern – Dionysos und Apollon. Da der wissenschaftliche Historismus jener Tage, wie er sich selbst nannte, die höchsten Ansprüche an die Authentizität seiner jeweiligen Kunstwerke stellte, bedeutete dies aufwendigste und zeitraubende Recherche von Seiten der Künstler bezüglich der Kostüme, der Architektur und des gesamten Dekors. Zudem war dies eine einmalige Gelegenheit für die Künstler, nicht nur sich selbst, sondern auch Mitglieder ihrer Familie zu verewigen. So taucht etwa Hermine Klimt auf der ‚Bühne Molières‘ ihres Bruders Ernst auf, während er seine andere Schwester, Johanna Klimt, als Dritte von Links, in der Zuschauermenge vor der ‚Stegreif-‘ beziehungsweise ‚Jahrmarktbühne zu Rothenburg‘ für alle Zeiten festhielt. Um den sterbenden Romeo so detailgetreu wie nur irgend möglich darstellen zu können, ließ Gustav Klimt von seinem Bruder Georg Photographien in besagter Pose anfertigen und verewigte somit auch ihn in seinem Fresco. Unter den Zuschauern des elisabethanischen Globe-Theatre, hat Gustav Klimt letztendlich alle drei Mitglieder der Künstler-Compagnie für alle Zeiten festgehalten. Der Künstler schuf ein detailgenaues Bildnis seiner selbst, mit großer, weißer Halskrause, wobei hinter ihm sein Bruder Ernst zu sehen ist – und neben ihm, also im Vordergrund, Franz Matsch. Alle drei hat er photographisch genau dargestellt – und es ist zudem das einzige bekannte Selbstbildnis des Künstlers überhaupt.
Gustav Klimt war erst vierundzwanzig Jahre alt, als er zusammen mit seinen beiden Kollegen mit der Ausmalung der Decken- und Lünettenbilder in den beiden Stiegenhäusern des neuen Burgtheaters begann. Bei Hans Makart, dem Malerfürsten, hatte es, nach dessen Berufung nach Wien, ganze zwölf Jahre gedauert, bis er, nur drei Jahre vor seinem Tode, einen öffentlichen Auftrag erhielt. Gustav Klimt und die Künstler-Compagnie hingegen hatten ihr Studium gerade erst seit drei Jahren abgeschlossen und sich seitdem als Firma in Wien etablieren können. Ein Aufstieg also. Sondergleichen. Und kometenhaft. Vor allem. Wenn man die Bezahlung bedenkt. Ganze zehntausend Gulden. Für die drei jungen Künstler. Eine geradezu astronomische Summe. Jenseits aller bisherigen finanziellen Vorstellungen. Und Einkünfte. Eine Unsumme. Die ihr Leben total verändern sollte. Radikal. Grundlegend. Und plötzlich. Wurden sie zudem auch einem größeren Publikum bekannt. Zumal bereits im folgenden Jahre, also 1887, ein weiterer Auftrag ins Haus stehen sollte: Sie wurden damit beauftragt, den gesamten Innenraum des alten Burgtheaters, welches zwar zu diesem Zeitpunkt immer noch stand, aber demnächst abgerissen werden sollte, auf einem Bildnis für die Nachwelt festzuhalten. Da dies den Künstlern jedoch momentan aus Zeitgründen unmöglich war, baten sich Gustav Klimt und Franz Matsch bei ihrem Auftraggeber aus, zunächst die Beendigung der Stiegenhausbemalung abzuwarten. Da diesem Wunsch stattgegeben wurde, sollten sie mit dieser Arbeit also erst im Jahre 1888 beginnen.
Während die drei jungen Künstler damit begannen, auf den hohen hölzernen Baugerüsten, auf dem Rücken liegend, die gesamte Entwicklungsgeschichte des Theaters aufzuzeigen, also weit in die menschliche Kulturgeschichte zurückgingen, machte die Menschheit förmlich einen Quantensprung. Eines Morgens, während sie gemeinsam in dem kleinen Kaffeehaus unweit ihres Ateliers ihr Frühstück zu sich nahmen, konnten sie es lesen. Schwarz. Auf Weiß. Daimler. Und Benz. Hatten das erstes Automobil mit einem Verbrennungsmotor als Antrieb erfunden! Und das schon im Jahre 1886! Um sich die ganze Tragweite dessen vorstellen zu können, muß man freilich wissen, wie die Welt im Jahre 1886 aussah. Ein Automobil schien da ganz und gar nicht hineinzupassen. Und doch. Gab es keine Epoche in der Menschheitsgeschichte, in der man nicht versessener auf technische Innovation und Modernität gewesen wäre. Mehr sogar noch. Als in der gesamten Nachkriegszeit. Und viel, viel mehr sogar noch. Als heute. Als das Automobil in Stuttgart erfunden wurde, war Gustav Klimt erst vierundzwanzig Jahre alt. Beziehungsweise. Schon. Je nachdem. Wie man das nun sehen mag.
„Wieder so eine blöde und völlig unnöthige Erfindung, die die Welt nicht braucht!“, kommentierte dieser auch sogleich den Zeitungsartikel, während die anderen beiden zustimmend nickten.
„Ganz ehrlich …“, sagte er, während er von seinem Kipferl abbiß, welches er zuvor in den Kaffee getaucht hatte, „Wozu um Himmels Willen ausgerechnet eine Motor-Kutsche, wenn man doch die normale Kutsche hat – und die es ja schließlich auch thut – und zwar seit was weiß ich wie vielen Jahr-Tausenden!? In unsere Kutschen, da thut man bloß ein wenig Heu hinein – und sie fahren! In diese neuen Monstren da, muß weiß der Teufel was hineingefüllt werden – hier steht’s! – und das wird es auch nur in der Apotheke zu kaufen geben … Natürlich um ein Vieles mehr als das Heu, welches wir an unsere Kutschen verfüttern … Nein, in diesen Tagen wird so viel Unsinn erfunden – und ich bin mir sicher, daß die spätheren Generationen, sagen wir, in einhundert Jahren, aus vollem Halse über uns lachen werden – über unsere Naivität, uns eine völlig neue, moderne Welt erschaffen zu wollen! Einerseits flanieren die Damen in ihren ausladenden Crinolinen und wagenradgroßen Hüthen auf der Ring-Straße daher – und die Herren mit ihren Redingotes und ihren Chapeaux Claques, respective15 Cylinder-Hüthen – andererseits will man aber plötzlich telegraphieren, telephonieren, photographieren – und jetzt auch noch mit einer drei-rädrigen Motor-Kutsche durch die Gegend fahren … Wozu das alles? Die Welt ist doch schließlich guth so, wie sie ist, respective, wie sie war, oder etwa nicht?“
Und wieder nickten die anderen beiden zustimmend. Niemand nahm diese deutsche Erfindung damals wirklich ernst. In diesen Tagen. In den ersten Tagen. Ihrer Bekanntmachung. Aber das würde sich schnell ändern. Sehr schnell sogar. Und es würde die gesamte Welt verändern. Ob zum Besseren. Das sei einmal dahingestellt. Zumindest aber. Würde es sie extrem beschleunigen.
„Der Mensch wird aufhören, Mensch zu sein, wenn es so weitergeht!“, fügte Gustav mahnend hinzu, „Wo kommen wir denn hin, wenn wir nurmehr miteinander telegraphieren und telephonieren werden? Dann werden die Menschen verlernen, von Angesicht zu Angesicht miteinander zu communizieren! Es wird sich nurmehr um Pseudo-Conversation und um Pseudo-Communication handeln! Die Photographie wird die Malerei, also die wahre Kunst, verdrängen und schließlich zur Gänze ersetzen – und zwar durch eine Pseudo-Kunst! Und durch die drei-rädrige Motor-Kutsche, werden die Menschen verlernen, sich eigenständig zu bewegen! Sie werden nurmehr in Pseudo-Bewegung unterwegs sein – nehmlich, indem sie selbst sich nicht mehr bewegen! Außerdem wird ihnen dadurch das Gefühl für die Creatur abhanden kommen, für das Vieh – denn, ich bitte euch, einen waschechten Wiener Droschken-Gaul, denn kann man doch nicht durch einen unbeseelten Motor ersetzen! Beim besten Willen nicht …“
Und doch sollte es so kommen. Und zwar Punkt. Für Punkt.