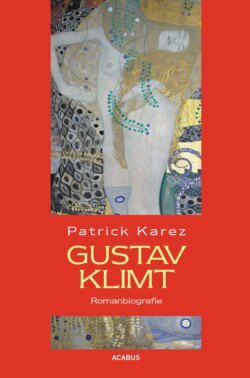Читать книгу Gustav Klimt. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Gustav Klimt - Patrick Karez - Страница 15
10
ОглавлениеIm dritten Jahr, Anno 1879, hatten alle drei die für den Abschluß erforderlichen Prüfungen abgelegt. Und wollten nun zur Staatsprüfung für Zeichenlehrer an Mittelschulen zugelassen werden. Lehrer werden! Das war der eigentliche Plan. Und wer weiß, was gekommen wäre, wenn es denn so gekommen wäre. Die Welt hätte dann höchstwahrscheinlich verzichten müssen. Auf einen ihrer größten Künstler.
Und so geschah es, daß Hofrat Eitelberger, Ritter von Edelberg, der Gründer der Kunstgewerbeschule, wieder einmal die Schul-Ateliers besuchte. Wahrscheinlich wurde er von Professor Rieser auf die drei Burschen aufmerksam gemacht, denn er ging geradewegs auf sie zu und ließ sich ihre Arbeiten eingehend zeigen.
„Soso …“, sagte er, „Das sind also Ihre Arbeiten … Soso … Nun, Ihre Übertragungs-Zeichnungen für die Fenster der Votivkirche habe ich ja bereits gesehen. Respectabel, muß ich sagen, respectabel … Nicht gerade einfach, bei dieser enormen Größe, nicht wahr?“
Die drei nickten. Keiner von ihnen getraute sich, Herrn Hofrat Eitelberger von Edelberg direkt anzusprechen. Selbst Matsch nicht.
„Sie arbeiten sehr präcise!“, fuhr dieser fort, während er weitere Blätter durchsah, „Und wer von Ihnen hat dies hier gemacht?“, er deutete auf eine großformatige, allegorische Zeichnung, welche die vier Jahreszeiten versinnbildlichen sollte.
„Wir alle zusammen, Hochwohlgeboren!“, beeilte sich Matsch zu sagen. Und senkte dabei den Kopf.
„Sie alle zusammen?“, Eitelberger setzte seinen Zwicker auf, um die Details der Zeichnung eingehender studieren zu können, „Und wer macht was? Ich meine … man sieht ja gar keinen stilistischen Unterschied!“
„Wir arbeiten alle gleich!“, entgegnete wieder Matsch, „Das haben wir schließlich so gelernt … Bei Meister Rieser …“
„Aha!“, Eitelberger richtete sich plötzlich auf, „Einer für Alle – Alle für Einen! Alexandre Dumas, nicht wahr?“
Die drei nickten. Keine Ahnung, wovon er da sprach. Aber es mußte wohl in Ordnung sein. Denn er lächelte.
„Ich habe die ornamentalen Verzierungen ringsherum gezeichnet!“, brach nun Ernst Klimt sein Schweigen, „Sowie das allegorische Mittelfeld, mit den Früchten und Blumen …“
„Ich selbst habe die beiden linken Figuren gezeichnet“, fügte Matsch rasch hinzu, „Also Frühling und Herbst …“; und da Gustav einfach nicht seinen Mund aufbekam, ergänzte er: „Und die beiden rechten Figuren hier, Sommer und Winter, die stammen von meinem Kollegen hier, Gustav Klimt …“
„Aha, dem Bruder …“, Hofrat Eitelberger beugte sich wieder über das Blatt Papier, nachdem er einen kurzen Blick auf Gustav Klimt geworfen hatte, „Das ist wirklich erstaunlich … Man sieht kaum einen Unterschied zwischen diesen vier allegorischen Gestalten! Die beiden rechten erscheinen mir vielleicht etwas bewegter – aber das liegt wohl an der Dramatik der beiden extremen Jahreszeiten, Sommer und Winter, während ja Frühling und Herbst eher gemäßigt und verträumt dargestellt werden möchten – wenn nicht gar ein wenig melancholisch …“
„Genauso ist es!“, sagte Franz Matsch. Und es klang ein wenig vorlaut.
„Und woher stammt die Vorlage?“, Eitelberger setzte nun seinen Zwicker ab und musterte alle drei Schüler eingehend.
„Es gab keine. Wir haben uns dies alles hier selbst ausgedacht!“, entgegnete umgehend Franz Matsch. Und man sah ihm seinen Stolz an. (Und seine Selbstsicherheit sowieso.)
„So?“, Hofrat Eitelberger von Edelberg setzte seinen Zwicker auf, „Hm …“
Eine längere Pause trat ein. Und allmählich wurden die drei Burschen etwas unruhig. Vor allem Franz Matsch. Er mochte es gar nicht, auf die Folter gespannt zu werden. Außerdem befürchtete er, daß er doch ein wenig zu vorlaut gewesen war.
„Hm …“, schließlich legte Professor Eitelberger alle Blätter wieder zusammen und sah die drei eindringlich an, „Zeichenlehrer?“, und er schüttelte dabei verneinend den Kopf, „Ihr müßt Maler werden!“
„Maler?“, entfuhr es Matsch, während es Gustav Klimt innerlich vor Glück förmlich zerriß.
Ja! Dachte er. Das ist es! Heureka! Maler! Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen?
„Jeder von Ihnen wird ein Stipendium von monatlich zwanzig Gulden bekommen und Sie werden dann in die Abteilung für Malerei und Decorative Kunst zu Herrn Professor Ferdinand Laufberger eintrethen …“; und da von den dreien offensichtlich keinerlei Reaktion kam, fügte Hofrat Eitelberger süffisant hinzu: „Das ist den drei jungen Herren doch wohl hoffentlich genehm?“
„Aber ja doch!“, sprudelte es nun nur so aus Matsch heraus, „Das ist einfach unglaublich! Einfach wunderbar!“
„Wirklich!“, ergänzte nun auch Ernst Klimt, „Vielen, vielen und vor allem aller-herzlichsten Dank, Hochwohlgeboren!“
Gustav Klimt hingegen blieb stumm. Wie ein Fisch. Aber ihn freute diese völlig neue Wendung wohl am allermeisten. Es war also beschlossen. Er würde Maler werden. Und das war auch besser so. Viel besser sogar. Die Welt würde es ihm danken. (Beziehungsweise gebührt der Dank dazu wohl in erster Linie Hofrat Rudolf Eitelberger von Edelberg.)
Wenig später standen sie bereits vor Professor Ferdinand Julius Laufberger. Vor einer Ikone also. Der Ringstraßen-Dekorationskunst. Vor einer lebenden Legende. Er wollte die drei jungen Burschen, von denen zur Zeit hier an der Schule jeder sprach, einmal näher kennenlernen. Zu diesem Zwecke hatte er sie in seinem Sprechzimmer empfangen. Einem dunkel getäfelten Raum. Der altertümlich wirkte. Obwohl er doch brandneu war. Und wo es Kaffee gab. Auch den drei Studenten wurde jeweils eine Tasse gereicht. Jetzt waren sie schließlich Männer! Und tatsächlich hatten sich alle drei, wie um es zu demonstrieren, erst kürzlich einen Bart stehen lassen. Das gehörte zu einem Künstler einfach dazu. Zumal in diesen Tagen. Einen Künstler oder gar Intellektuellen ohne Bart – das gab es einfach nicht!
„Soso!“, begrüßte er sie, „Sie sind also unsere drei Hoffnungsträger für die Zukunft, habe ich gehört … Meine Herren, nehmen Sie bitte Platz! Milch und Zucker?“
Alle drei nickten.
„Franz Matsch und… Gustav Klimt …“, er schaute in irgendein Formular, „Sie haben vor drei Jahren inscribiert, nicht wahr? Im Jahre 1876 …“
„Jawohl. Das ist richtig“, entgegnete Franz Matsch.
„Und Sie … Ernst Klimt, der Bruder, Sie kamen ein Jahr späther zu uns …“
„Jawohl“, entgegnete dieser knapp.
„Nun … Die beiden Erst-Genannten stehen ja jetzt unmittelbar vor ihrem Abschluß als Zeichenlehrer… Beim jüngeren Bruder fehlt uns aber noch ein ganzes Jahr … Zudem ist er noch sehr jung … Jahrgang 1864 … Hm … Das ist allerdings ein Problem …“
Ernst Klimt sah verschreckt zunächst den Herrn Professor und dann seinen Bruder an.
„Sie müßten mir dann natürlich noch die eine oder andere Arbeit abliefern – respective bei Herrn Professor Rieser – aber guth, wir sind ja hier schließlich alle im selben Hause, nicht wahr?“
Alle drei nickten. Sie saßen wirklich sehr brav und artig da. Alle nebeneinander. Genau in einer Reihe. Wie die Hühner. Auf der Stange. Oder wie Donald Duck’s Neffen. Hinten. Im Automobil. Tick. Trick. Und Track.
„Herr Hofrat Eitelberger, Ritter von Edelberg, ein großer Kunsthistoriker und Archäologe – sowie natürlich der Gründer dieser Schule, wie Sie ja wissen – war von Ihren Arbeiten recht angethan …“, Laufberger nippte an seiner Kaffeetasse, die mit einem hübsch dekorierten Goldrand versehen war, „Und er versicherte mir, daß man Sie drei nach Möglichkeit nicht trennen sollte, da Sie … wie nannte er es doch gleich? Ach ja: Da Sie drei eine Art Kumpanie, nein: Compagnie, bilden!“
Ein gutes Wort. Dachte Matsch. Das könnte man vielleicht sogar verwenden. Und zwar glattweg.
„Nun denn … Wir schreiben zwar bereits das Jahr 1879, doch die Arbeiten an der Ring-Straße sind alles andere als vollendet! Es gibt noch haufenweise zu thun – allem voran auf der Baustelle des künftigen Kaiserlichen und Königlichen Kunsthistorischen Hof-Museums! Dort fehlt nehmlich noch die gesamte Innen-Ausstattung – doch darauf komme ich späther wieder zurück – sowie im neuen Kaiserlichen und Königlichen Hof-Burg-Theater, das ja bald errichtet werden soll, et cetera, et cetera … Von all den privaten Palais’ an der Ring-Straße, welche sich derzeit im Bau befinden, und die alle nach einer Innen-Decoration verlangen, einmal ganz zu schweigen!“, er legte eine kurze Pause ein, während er die drei Studenten eingehend betrachtete, „Sie sehen also, meine Herren: Es gibt alle Hände voll zu thun in Wien! Man benöthigt – und sucht sogar hände-ringend! – junge Talente, wie Sie es sind! Justament in diesen Tagen, ist Ihre Fähigkeit also gefragt wie nie. Es ist Ihre aller große Chance – und ich selbst werde Sorge dafür tragen, daß Sie diese auch ergreifen und nützen werden!“
Die drei jungen Studenten nickten zustimmend.
„Wenn Sie also nun zu mir, in die Classe für Malerei und Decorative Kunst, eintrethen, verlängert sich Ihr Studium dadurch um weitere drei bis vier Jahre! Insgesamt würden Sie damit ganze sieben Jahre lang an dieser Schule ausgebildet – der jüngste von Ihnen sechs …“, er warf Ernst Klimt einen kurzen Blick zu, „Erst im Jahre 1883 wären Sie dann alle gemeinsam frei! Eine lange Zeit, nicht wahr? Natürlich können Sie alle drei nicht so lange mit privaten und öffentlichen Aufträgen zuwarten – denn schließlich muß ja ein jeder Mensch von etwas leben und Geld verdienen, nicht wahr?“
Alle drei nickten. Unisono. Völlig synchron.
„Ja, dem ist nun mal so: Der Mensch lebt leider nicht von Luft und Liebe allein …“, Laufberger lächelte, „Also werde ich dafür Sorge tragen, daß Sie drei mir auch nicht verhungern, in all der Zeit! Haben Sie mich verstanden?“
Und wieder Nicken.
„Nicht nur, daß Sie alle drei ein monatliches Stipendium von zwanzig Gulden erhalten werden – auch werde ich Sie laufend mit Aufträgen eindecken. Mit bezahlten, wohlgemerkt!“
Die drei Studenten bedankten sich. Ihre Freude war ihnen anzusehen.
„Sie könnten also bereits während Ihres Studiums reich werden!“, Laufberger lachte, „Nein, ganz im Ernst! Herr Professor Rieser sagte mir, Sie verdienten bereits etwas, indem Sie Portrait-Zeichnungen nach Photographien anfertigen, also daß Sie klein-formatige Photographien wohlhabender Wiener in ein größeres Format übertragen, wie Sie es hier an der Schule gelernt haben, um sich damit ein gewißes Zubrot zu verdienen. Ist das richtig?“
„Jawohl“, entgegnete Franz Matsch. Und die anderen beiden nickten.
„Nun, sehen Sie …“, Professor Laufberger setzte eine bedeutungsschwere Miene auf, „Für eine Zeichnung können Sie ja nicht gar so viel verlangen, obgleich die Arbeit daran fast die selbe Mühe macht wie bei einem gemalten Portrait, à l’huile … Wenn Sie drei fortan meinen Malerei-Curs besuchen werden, dann können Sie in Zukunft für so ein gemaltes Portrait guth fünf, wenn nicht gar sechs Gulden verlangen!“
Mein Gott! Dachten alle drei. Sechs Gulden! Das war ja ein halbes Vermögen. Das machte gut ein Drittel ihres monatlichen Stipendiums aus! Gelänge es ihnen, sagen wir, vier Portraits im Monat anzufertigen, dann ergäbe dies immerhin vierundzwanzig Gulden – plus der zwanzig Gulden Stipendium – also beinahe fünfzig Gulden monatlich! Das war mehr als bloß ein Taschengeld. Zumal in diesen Tagen. Zumal als Künstler. Beziehungsweise als Kunststudent.
„Und bedenken Sie!“, der Professor schien es wirklich ernst mit ihnen zu meinen, „Wenn Sie dann erst einmal Ihre Ausbildung hier abgeschloßen haben, und allesamt fertige Künstler sind, dann können Sie letztendlich für Ihre Werke verlangen was Sie wollen! Und sollte es jemand von Ihnen zu einer gewißen Bekanntheit – oder gar Berühmtheit – bringen, dann können Sie sich überhaupt Ihre Hände vergolden lassen, oder was weiß ich …“
Diese Worte waren ein unglaublicher Motivationsschub für die drei. Vor allem für Gustav Klimt. Der es satt hatte. Arm zu sein. Der seiner Mutter endlich ein Leben ermöglichen wollte. Ein Leben. Das sich ziemte. Und das ihrer würdig war.
„Bei mir sind Sie da in allerbesten Händen!“, Laufberger setzte ein nicht unbescheidenes Lächeln auf, „Ich bin ausgebildeter Maler, Radierer und Lithograph – und seit dem Jahre 1868 Professor für Figürliches Zeichnen an dieser Schule. Sie sehen also, ich war ganz von Anfang an dabei – ein Mann der ersten Stunde sozusagen …“
Alle drei nickten. Und tatsächlich sollte Ferdinand Julius Laufberger den größten Einfluß auf die drei Kunststudenten ausüben – vor allem auf den jungen Gustav Klimt, der sich erst dreizehn Jahre später, allmählich, von diesem Einfluß Laufbergers befreien sollte.
„Sie wissen ja, daß ich selbst zu den erfolgreichen Malern Wiens zähle, überdies mit der decorativen Ausstattung einer Vielzahl öffentlicher Bauten an der Ring-Straße betraut … Das sage ich nicht, um vor Ihnen zu glänzen oder gar zu prahlen – das habe ich ja auch gar nicht nöthig – sondern um Ihnen zu garantieren, daß Sie bei mir nicht bloß hohles Geschwätz zu hören bekommen, sondern auch in die Praxis eingeführt werden! Sehen Sie … Es gibt, vor allem an der Academie, eine Vielzahl von Professoren, die halten sich, warum auch immer, für etwas Beßres … Die schauen dann stets auf uns Kunst-Gewerbler herab und meinen, wir seien keine richtigen Künstler, da unsere Kunst eben einem ganz handfesten Zwecke dient, nehmlich der Gebäude-Decoration und somit der Verschönerung des öffentlichen Lebens im Allgemeinen … Aber ich frage Sie: Was sollte daran verwerflich sein? Weshalb sollte ein Kunstwerk weniger werth sein, wenn es an einem öffentlichen Gebäude angebracht ist – als ein anderes, das sich in einem privaten Boudoir befindet, an der Wand, wo es, außer dem Haus-Herren natürlich, kein Mensch je zu Gesichte bekommt? Ich sage Ihnen: Das ist pure Hypocrisie! Denn schließlich verlangen die Herren Professoren von der Kunst-Academie doch ebenfalls etwas für Ihre Bilder – nehmlich bare Münze! Auch in den heiligen Hallen der Kunst-Academie, ist doch ohne Moos nichts los!“
Die drei kicherten.
„So ist es nunmal …“, fuhr Professor Laufberger fort, „Auch ein Künstler muß schließlich von etwas leben! Sie sehen also: Bei mir gibt es nicht etwa bloß dummes Geschwätz, sondern auch eine enorme Praxis-Erfahrung! Überdies werden Sie hier – zumal was die Technik und Materialkunde anbelangt – wesentlich mehr lernen können als an der Academie! Und dadurch, daß Sie bereits während Ihres Studiums allerlei Aufträge entgegen-nehmen werden – ja, sogar Staats-Aufträge, wenn Sie Glück haben, von allerhöchster Hand! – da werden Sie mittels Ihrer Aufgaben wachsen! Sie verstehen hoffentlich, was ich meine! Während die Studenten der Kunst-Academie hoch oben in ihrem Elfenbein-Thurme sitzen, und sich für etwas Beßres halten, da stehen wir Kunst-Gewerbler schon längst mitten im Leben – mitten im Arbeits-Leben – denn unsere Kunst wird ja schließlich auch angewandt! Sie dient einem ganz speciellen und specifischen Zwecke! Deshalb könnte man hier auch von einer Angewandten Kunst sprechen …“
Die drei Studenten nickten. Und führten ihre drei Kaffeetassen synchron zum Mund. Obwohl diese schon längst leer waren.
„Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen …“, fuhr Laufberger fort, der sich in der Rolle des Heroen offensichtlich sehr gut gefiel, „Mein erster öffentlicher Auftrag hier in der Reichs-Hauptstadt war es, den zweiten Vorhang des Wiener Hof-Opern-Theaters zu gestalten, den ich übrigens im Jahre 1869 vollendete … Da war ich nun schon ein ganzes Jahr lang Professor hier an der Schule. Sie können sich nun sicherlich denken, daß ich all meine Studenten – es war der aller-erste Jahrgang hier bei uns! – zur Mitarbeit verpflichtete … Nicht nur, daß diese jungen Burschen ungemein viel lernten – nein, wenn sie heute ins Opern-Haus gehen, mit ihren Familien – und vielleicht sogar bereits mit ihren Kindern, wer weiß? – dann können Sie – und dies völlig zu Recht – voller Stolz sagen: ‚Schaut her, an diesem Opern-Vorhange habe ich selbst mitgewirkt! Von mir stammt diese oder jene Figur, hier oder dort!’. Verstehen Sie nun, was ich meine? Praxis ist alles! Die Kunst dient nicht der Kunst allein – so wie es manche Professoren an der Academie wohl gerne sehen würden! Nein: Sie muß auch angewandt werden! Sie muß einen Zweck erfüllen …“
Was für eine Rede! Gern hätten die drei Jungs laut applaudiert. Und „Bravo!“ gerufen. Und „Vivat!“. Und „Heil Dir!“. Aber das trauten sie sich nun doch nicht.
„Anschließend wurde ich mit der Ausmalung der Stiegenhäuser unseres anhängigen Österreichischen Museums für Kunst und Industrie betraut – nun, zumindest war ich daran betheiligt – und ich führte auch die Medaillons an der Faßade eben dieser Kunst-Gewerbe-Schule hier aus“, er deutete vage in die Luft, „wobei dieser Neubau ja zwischen 1873 und 1877 errichtet worden ist, wie Sie ja alle wissen! Schließlich haben Sie die Baustelle ja noch selbst miterlebt! Und der Jüngste von Ihnen, der ist doch justament im Vollendungs-Jahre desselben zu uns dazugestoßen, nicht wahr?“
Ernst Klimt nickte.
„Eines, meine Herren, müssen Sie immer beachten – auch über Ihr Studium hinaus: Die angeforderten und bei Ihnen in Auftrag gegebenen Ausmalungen, müssen stets und unter allen Umständen mit der zu decorierenden Architectur correspondieren! Die Malerei muß der Architectur dienen und nicht etwa umgekehrt! Deshalb darf die Malerei auch keine selbständige oder gar dominierende Rolle einnehmen! Verstehen Sie?“
Gustav Klimt nickte. Dennoch sollte er sich diesem heiligen Gebot widersetzen. In knapp zwanzig Jahren. Und es sollte zur Katastrophe führen.
„Ja, aber wirkt dann nicht alles thot und leer?“, wagte er einen Einwand. Es war das erste Mal, daß er heute den Mund auftat.
„Das ist eine guthe Frage!“, dennoch schien Professor Laufberger überrascht, „Sie sprechen die Gefahr einer allzu musealen Wirkung an, ich verstehe … Nun, der Gefahr, daß die Malerei etwa leer und formelhaft wirken könnte, müssen Sie mittels einer melodiösen Formen-Sprache – also mittels eines beseelten, geradezu lyrisch anmuthenden Formen-Typus’ – beherzt entgegen-wirken! Aber keine Sorge – ich werde Ihnen schon noch zeigen, wie man dies bewerkstelligt … Schließlich werden meine Fähigkeiten auf diesem Gebiete, also der Decorations-Malerei, in ganz Wien hoch geschätzt!“
Die drei Studenten nickten. Er mußte ja Recht haben. Schließlich war er der Professor. Und erfolgreich noch obendrein.
„Meine Principien – also allem voran die Integration der decorativen Malerei in einen architectonischen Zusammenhang – sind das Um und Auf in meinem Cursus! Und dann natürlich die Technik! Wer die Technik nicht beherrscht, dessen Schaffen wirkt auf die Betrachter unglaubwürdig – so guth er als Künstler auch sein mag! Schauen Sie … das alles, was in diesen Tagen auf der Ring-Straße entsteht, ist ein historistisches, respective eclecticistisches, Programm … Wenn man also ein Parlament im griechischen Stile erbaut, wie zur Zeit bei uns in Wien, dann muß der es Betrethende wahrhaftig der Illusion erliegen, sich in einem altgriechischen Bauwerke zu befinden! Mit der Votiv-Kirche ist es genau das Gleiche! Die schönste gothische Faßade wäre vollkommen sinn- und zwecklos, gäbe es in ihrem Innern ein wahl- und heilloses barockes Misch-Masch! Sie verstehen hoffentlich, was ich meine!?“
Die drei nickten.
„Und nehmen Sie selbst unser Museum hier! Es ist im Stile der florentinischen Hoch-Renaissance errichtet worden – also spiegelt auch sein Inneres eben jene Epoche wider! Anders ergäbe es auch gar keinen Sinn … Und à propos Italien: Ich habe durch meinen Aufenthalt in Italien nicht nur mein eigenes Kunst-Schaffen vorangetrieben und dementsprechend verändert – ja, die italienische Kunst hat mein Schaffen unverkennbar beeinflußt! – sondern ich brachte auch bereits längst verloren geglaubte Recepturen und Techniken der verschiedensten Arth nach Wien mit … Nehmen Sie zum Beispiel die Sgrafitto-Technik, ferner die alte Arth und Weise des Fresco-Malens, dann die Bemalung von Terracotten, et cetera, et cetera … Ich lernte es in Italien, von alten Meistern, diese diversen, alterthümlichen Techniken tadellos zu beherrschen – sowohl theoretisch als auch in der Praxis … Sie werden es in meinem Cursus noch selbst sehen – und natürlich auch erlernen! Der hoch-verehrte Hofrath Eitelberger, Ritter von Edelberg, weiß sehr wohl, was er an mir, als Lehr-Kraft für diese Schule, gewonnen hat! Und Sie werden es eines schönen Tages auch noch zu schätzen wissen …“
Ein wenig selbstverliebt war er schon. Dieser Laufberger. Dachte Gustav Klimt. Und Ernst dachte es auch. Nur Franz Matsch dachte es nicht. Der dachte diesbezüglich ganz anders. Nämlich: Der ist ja ganz genau so wie ich! Beziehungsweise: Der ist ja ganz genau so, wie ich selbst es eines Tages gern sein würde. Und das wurde er auch.