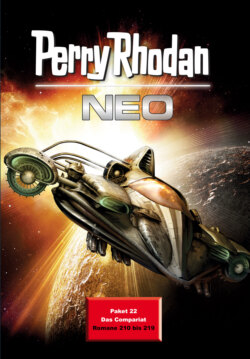Читать книгу Perry Rhodan Neo Paket 22 - Perry Rhodan - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.
Unheilvolle Träume
Der Gang zur Zentrale scheint kein Ende zu nehmen. Sophie Bull-Legacy beschleunigt ihre Schritte. Sie hat es eilig, denn sie muss eine wichtige Nachricht überbringen. Aber wem? Perry Rhodan? Oder Conrad Deringhouse? Sie hat es vergessen. Aber sie weiß, dass sie in die Zentrale muss. Die Nachricht hat etwas mit dem MINSTREL zu tun. Er hat sie gewarnt, und diese Warnung muss unbedingt weitergegeben werden. Sophie beißt sich auf die Lippen, während sie mechanisch einen Fuß vor den anderen setzt. Ist die Nachricht vielleicht für Mentro Kosum? Er muss stets über alle Neuigkeiten zur FANTASY informiert werden, selbst wenn er als Emotionaut einen tieferen Einblick in die Steuerung hat als normale Piloten. Dass es ihr nicht einfällt, macht Sophie fast wahnsinnig.
Sophie folgt dem Gang um eine Kurve – und prallt erschrocken zurück. Quer vor ihr auf dem Gang liegt ein längliches, weißes Gebilde. Davon gehen weiße Fäden aus, die das Ding mit den Wänden und der Decke verbinden wie ein Spinnennetz. Sophie nähert sich dem Ding langsam und vorsichtig.
Ist das ein Kokon? Sie überwindet ihren Ekel und berührt das Gebilde vorsichtig mit den Fingerspitzen. Es ist weich und scheint aus den gleichen Fäden zu bestehen, die es mit den Wänden verbinden. Sie sind ein bisschen klebrig und warm – das Ekelgefühl in Sophie verstärkt sich. Als sie die Hand zurückzieht, erklingen aus dem Kokon Geräusche. Es ist Gesang, ähnlich der Fuge, die der MINSTREL von sich gibt. Aber Sophie ist sicher, dass er nicht von einem Wesen wie dem MINSTREL stammt – es ist eine menschliche Stimme, die sie summen hört. Und irgendwie kommt ihr die Stimme bekannt vor.
»Hol ihn raus!«
Sophie blickt erschrocken auf. Auf der anderen Seite des Kokons steht ihre Mutter. Autum Legacy starrt angstvoll auf den Kokon hinunter. »Mach schon, hol ihn raus!«
»Mama?«, fragt Sophie ungläubig. »Was machst du hier?« Ihre Eltern sind dagegen, dass die Zwillinge an Bord der FANTASY mitfliegen. Warum also sollte ihre Mutter plötzlich auftauchen?
Autum Legacy reagiert nicht auf die Frage, deutet auf den Kokon. »Hol ihn raus! Ich kann es nicht. Ich bin zu alt!«
Der Gesang im Innern des Kokons verändert sich. Er klingt auf einmal ... erstickt. Sophie beugt sich vor und greift mit beiden Händen in das Fadengewebe, reißt es auseinander. Es ist fester, als sie erwartet hat, und es gibt mehrere Schichten. Ungeduldig zerrt Sophie an den Fäden. Endlich dringt sie ins Innere durch und erkennt ein Gesicht.
»Papa!« Der Schreck fährt Sophie wie ein Messer durch die Wirbelsäule.
Reginald Bull liegt mit geschlossenen Augen in dem Kokon. Der Summton kommt noch immer über seine Lippen. Auf Sophies Schrei hin reißt er die Augen auf. Sie sind vollkommen weiß.
»Hilf mir!«, krächzt er. Seine roten Haare verfärben sich ebenfalls weiß, sein Gesicht wird faltig und nimmt die Farbe von altem Pergament an. Er streckt die Hände nach ihr aus – die Hände, die immer kräftig und muskulös gewesen sind, mutieren zu gichtigen Krallen.
Sophie weicht zurück. In ihren Ohren rauscht das Blut. Tränen laufen ihr über die Wangen. »Papa ...«, schluchzt sie.
Die Wirkung der Zelldusche ist abgelaufen, das ist ihr klar. Ihr Blick fällt auf ihre Mutter. Auch Autum Legacys Haare verfärben sich, werden erst grau und dann weiß. Ihre Haut vertrocknet, sie wird zu einer lebendigen Mumie.
Sie streckt die Arme nach Sophie aus. »Wo ist deine Schwester? Nimm deine Schwester, und verschwindet von hier ...«
Sophie stürzt in Panik wie in ein tiefes Loch. Sie dreht sich um und rennt den Gang zurück. Sie muss Laura finden und fliehen, so schnell wie möglich. Da hört sie einen Schrei – so gequält und voller Entsetzen, dass diese Gefühle direkt auf Sophie überspringen.
»Laura! Ich komme!«
Der Schrei dringt aus einem Raum, dessen Tür einige Schritte vor ihr einen Spaltbreit offen steht. Sophie Bull-Legacy reißt die Tür auf und rennt hinein ...
... und Gucky steht in einem Teil der FANTASY, den er noch nie zuvor gesehen hat. Ungläubig sieht er sich um. Er ist absolut sicher, dass er mittlerweile das ganze Raumschiff erkundet hat – immerhin hatte er genug Zeit, um sich sogar an die unzugänglichsten Orte zu teleportieren. Und doch ist er gerade durch eine normale Tür spaziert und steht plötzlich – ja, wo eigentlich? Der Raum ist erstaunlich groß und so hoch, dass Gucky die Decke nicht sehen kann. Tatsächlich ist es eher ein Himmel, der sich über ihm spannt – ein Firmament von ungesunder, graugrüner Farbe, keine Raumschiffhülle.
Gucky ist davon abgestoßen, will zurück zur Tür. Doch da ist keine Tür mehr. Da ist auch keine Wand mehr.
Gucky blinzelt verwundert. »Was soll das denn?«
Aber der Retter des Universums lässt sich nicht leicht austricksen. Er konzentriert sich, um zurück in den Gang zu springen. Nichts geschieht. Seine Kräfte lassen ihn im Stich. Es ist, als ob er einfach leer gesaugt sei, jedoch ohne dass er seine Gaben übermäßig eingesetzt hätte. Er fühlt keine Erschöpfung. Seine Kräfte stehen ihm schlichtweg nicht zur Verfügung.
Angst überfällt Gucky wie eine Kreatur aus den Schatten. Ohne seine Kräfte ist er nackt – man hätte ihm ebenso gut das Fell abziehen können. Vielleicht ist es diese Vorstellung, die ihn veranlasst, die Arme schützend vor sich zu verschränken – eine Geste, die für ihn absolut untypisch ist. Aber nun gibt sie ihm etwas Halt.
Weil es keine Tür mehr gibt, wendet er sich in die andere Richtung. Er stapft langsam los. Der Boden ist von Gras und Moos überwuchert. Mit einem Mal sprießen überall seltsame Pflanzen in die Höhe: Farne und Schachtelhalme, aber auch knorrige Urwaldriesen und üppige Blütenstauden mit roten und gelben Kelchen. Letztere verströmen einen seltsamen Duft. Zuerst erscheint er dem Mausbiber verlockend und fruchtig. Doch je länger er ihn einatmet, desto vergorener und verdorbener kommt er ihm vor. Schon bald atmet Gucky durch den Mund, wenn er an den Blüten vorbeikommt. Der Geruch verursacht ihm Übelkeit.
Er hört ein seltsames Wispern. Es scheint von überall zu kommen. Gucky versucht zu espern, erfolglos. Wenn er seinen telepathischen Kräften glaubt, ist er völlig allein.
Etwas streift den Rand seiner runden Ohren. Gucky sieht auf: In den Wipfeln der Bäume hängen seltsame Kreaturen: blasig und wabbelig wie Quallen, von denen grauer Schleim tropft. In den runden Köpfen sitzen untertassengroße Augen, die ihn beobachten – insgesamt sind Tausende von Augen auf ihn gerichtet.
Gucky will einen flapsigen Spruch an die unheimlichen Gestalten richten – aber es will ihm keiner einfallen. Jedes einzelne seiner Haare steht aufrecht. Er fühlt Bewegung an seinen Füßen. Aus dem moosbewachsenen Boden schießen Hände hervor, halb verweste Leichenhände, die nach ihm greifen. Gucky quietscht erschrocken und springt zur Seite. Das führt dazu, dass an anderer Stelle die Hände ebenfalls aus dem Boden schießen und nach ihm fassen. Gleichzeitig schnellen aus den Bäumen glitschige Tentakel in seine Richtung.
So bedrängt von oben und unten, stolpert Gucky davon. Er entdeckt eine Höhle – nicht mehr als ein Loch in einem Felsen, der von Kletterpflanzen überwuchert ist – und rennt hinein. Dorthin können ihm zumindest die Tentakelwesen nicht folgen. Zu seiner Erleichterung kommen auch keine Hände mehr aus dem Boden.
Gucky lehnt sich gegen die Wand. Er atmet durch. Ein Todesschrei erklingt und lässt ihn bis in die Schwanzspitze vibrieren. Mit einem entsetzten Keuchen stößt sich Gucky wieder ab. Er hat solche Schreie schon einmal gehört. Er weiß nun, wo er sich befindet: Er ist im Innern eines Mobys! Ungläubig starrt er die Wände an, die eindeutig aus Fels bestehen. An einigen Stellen glühen sie nun auf. Gucky kneift die Augen zusammen und sieht genauer hin: Nein, es sind leuchtende Zeichen, die dort erscheinen. Keine Buchstaben oder Zahlen, die er kennt, weder von der Erde noch arkonidisch. Es sind seltsame Runen, und ihr Leuchten pulsiert unheilvoll. Mit jedem Pulsschlag ziehen sich die Wände der Höhle etwas zusammen, rücken näher auf den Mausbiber zu, umschließen ihn enger und enger.
Gucky empfängt einen Gedankenimpuls, der ihn mit der Wucht eines tosenden Brüllens trifft: »Verschwinde!«
Mit einem Aufschrei rennt er hinaus ...
... und Laura Bull-Legacy sieht sich Merkoshs Vitron im hell erleuchteten Hangar gegenüber. Das seltsame Raumboot, das an eine leicht flach gedrückte Kugel erinnert, ist über und über mit Zeichnungen bedeckt. Laura geht darauf zu.
Nein, das sind keine Zeichnungen – das scheint so etwas wie eine Bilderschrift oder Runen zu sein.
Neugierig nähert sich Laura weiter der transparenten Raumschiffswand. Die Runen leuchten – sie sind mit einer fluoreszierenden, grünen Farbe aufgebracht worden. Irgendwie wirken die Runen gleichzeitig vertraut und fremdartig.
Merkosh malt sich manchmal Zeichen auf den Körper. Hat der Oproner vielleicht dieses Mal aus irgendeinem Grund sein Fahrzeug verziert? Doch die Runen sehen ein wenig anders aus, meint Laura. Irgendwie abstrakter, sie erinnern an Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten. Vielleicht kommt ihr diese Assoziation aber nur wegen ihrer Ausbildung zur NATHAN-Interpreterin in den Sinn.
Sie streckt die Hand aus und berührt eine der Runen mit den Fingerspitzen. Sie ist fasziniert – bis sich die Farbe der Rune ändert. Sie wird blutrot – nein, sie blutet wirklich. Dickflüssige, rote Tropfen rinnen an dem Vitron herab wie grausige Tränen. Erschrocken zieht Laura ihre Hand zurück, doch es ist zu spät: Auch alle anderen Runen verfärben sich blutig – und mit ihnen wechselt die Beleuchtung im Hangar in ein düsteres, unheilvolles Rot.
»Ist hier jemand?« Laura sieht sich beunruhigt um. »Merkosh?«
Die Bluttränen, die vom Vitron herunterfallen, sammeln sich in einer Lache zu ihren Füßen. Sie bilden einen riesigen Tropfen, der sich wie Quecksilber verhält und davonrollt, weg vom Vitron. Von einer morbiden Neugier getrieben, läuft Laura hinterher. Das Blut führt sie in einen anderen Teil des Hangars, in dem das rötliche Licht noch intensiver ist und ein aufdringlicher Geruch nach Verwesung in der Luft liegt. Laura rümpft angewidert die Nase, geht jedoch weiter. Sie schiebt mit spitzen Fingern ein paar transparente Plastikvorhänge beiseite, die von der Decke hängen und sie an das Vitron erinnern – oder an Scheiben davon.
Sie fühlen sich warm und pulsierend an. Als sie den letzten passiert, steht sie vor Merkosh. Sein Anblick ist wie ein Kübel Eiswasser, das Laura über den Kopf gegossen wird. Der exotische Fremde liegt auf dem Rücken, Arme und Beine seltsam verdreht. Sein Körper ist mit kleinen Wunden übersät. Aus seinem Rüsselmund tropfen schaumige, mit Blutklumpen durchsetzte Flocken. Winzige Nadeln stecken in seinem Fleisch. Über dem Oproner schwebt der MINSTREL. Einige der Metallkästchen haben sich aus der Kugel gelöst und driften planlos darum herum.
»Was geht hier vor?«, fragt sich Laura panisch.
Ein gurgelndes Geräusch lenkt ihren Blick wieder auf Merkosh. »Hilf mir, Laura – bitte!« Bei jedem Wort blubbert etwas Schaum aus dem Rüsselmund des immer noch so fremden Außerirdischen. »Töte mich!«
Laura schüttelt abwehrend den Kopf, doch schon während ihrer Bewegung schießen zwei Würfel des MINSTRELS nach unten und bohren sich mit einem schmatzenden Geräusch in den Körper des Oproners. Merkosh stöhnt auf.
»Aus, MINSTREL!«, ruft Laura, als würde sie mit einem unartigen Hund sprechen.
Sie wünscht sich, sie hätte ihre Ausrüstung bei sich, um den MINSTREL von seiner pervertierten Tätigkeit abzuhalten. Weil sie jedoch nicht auf diese Technik zurückgreifen kann, streckt sie die Hände nach dem MINSTREL aus. Auf diese Geste hin stimmt der NATHAN-Ableger seine Fuge an – doch sie erklingt nicht in Lauras Ohren, sondern in ihrem Kopf. Gleichzeitig krachen mehrere Dutzend der kleinen Würfel auf Merkosh herunter und fügen ihm weitere tiefe Wunden zu.
Laura will schreien, doch sie bekommt kein Wort heraus. Es ist, als hätte jemand ihre Stimme abgeschaltet. Sie greift panisch mit den Händen nach ihrer Kehle. Vor ihren Augen verschwimmt die Gestalt von Merkosh und verwandelt sich in Sophie. Laura ringt um Atem und will den Namen ihrer Schwester rufen. Doch noch immer bleibt sie stumm. Stattdessen wird die Fuge in ihr immer lauter und lauter, hallt in ihrem Kopf schmerzhaft wider und wird zu einem Schrei in Laura Bull-Legacys eigener Stimme ...
... im nächsten Moment sieht Jessica Tekener, wie der Schrei aus dem Mund ihres Bruders dringt: ein Schrei in Gestalt eines hässlichen, fetten, schwarzen Wurms. Sie will ihm zu Hilfe eilen, doch sie kann sich nicht bewegen.
Sie ist nicht mehr auf der FANTASY, sondern wieder auf dem Deneb-Planeten, inmitten der toten Kolonie. Sie steht auf einer verlassenen Straße, ein paar tote Chinesen liegen nicht weit entfernt auf dem Boden. Ronald windet sich wenige Schritte vor ihr auf dem staubigen Boden. Jede Faser ihres Körpers schreit danach, zu ihm zu rennen, doch sie ist nicht in der Lage, sich zu bewegen. Es ist fast wie damals, als Iratio Hondro ihren Geist übernommen hat und sie zwingen wollte, sich selbst zu töten. Nur dass sie dieses Mal daran gehindert wird, überhaupt irgendwas zu tun.
Stocksteif steht sie da und muss mit ansehen, wie immer mehr der wurmgewordenen Entsetzensschreie aus Ronalds Mund dringen, ihm über Gesicht und Körper kriechen und ihn wie ein seltsames Kleidungsstück bedecken. Die wabernde Masse wuchert, wird dicker.
Jessica kämpft gegen die merkwürdige Kraft, die sich wie eine Klammer um ihren Körper und ihren Geist gelegt hat. Es ist, wie durch dicken Sirup zu tauchen. Doch schließlich gelingt es ihr, sich aus der Erstarrung zu lösen. Als sie sich wieder bewegen kann, ist es ganz einfach, die Erstarrung abzuschütteln. Sie springt vor und taucht ihre Hände in die dichte Masse aus Würmern, versucht, ihren Bruder freizuschaufeln. Sie spürt etwas Feuchtes an den Händen – den Schleim der Würmer? Als sie die Hände zurückzieht, sind sie voller Blut. Sie begreift: Die Würmer fressen Ronald bei lebendigem Leib. Panik schlägt wie eine Flutwelle über ihr zusammen, sie schreit auf.
Die Würmer halten inne, wenden sich ihr zu. Die schwarzen Schleimfäden haben keine Augen, aber winzige Mäuler mit scharfen Zähnen, die sie aufreißen wie hungrige Küken. Sie lässt sich zurückfallen und kriecht rückwärts davon, wirbelt dabei den Staub der Straße auf. Die Würmer spannen ihre Körper an und schnellen auf Jessica Tekener zu, die Raubtiermäuler aufgerissen, aus tausend Kehlen schreiend ...
... und Perry Rhodan steht am Ufer eines Sees. Es ist kein irdischer See, das weiß er sofort. Die Farbe des Wassers erinnert ihn an frisches Blut. Der Geruch, der in der Luft hängt, ist aromatisch-würzig, die Luftfeuchtigkeit hoch. In Rhodans Kopf hallt ein Schrei nach. Er ist absolut sicher, dass er von der Insel kommt, die in der Mitte des Sees liegt. Es ist ein unheilvoller Schrei, voller Schmerzen, aber gleichzeitig eine wortlose Warnung. Er fordert ihn auf, zu fliehen.
Eine Warnung? Oder eine Drohung?
Das weckt seinen Trotz. Nun will er erst recht auf die Insel und herausfinden, was es damit auf sich hat. Vielleicht braucht dort jemand Hilfe. Und wenn es wirklich eine Drohung ist, will ich wissen, wer oder was mich bedroht.
Doch wie soll er dort hingelangen? Das Ufer ist naturbelassen, es gibt keine Brücke und keinen Steg, der hinüberführt. Auch ein Boot oder ein Fluggerät kann er nicht entdecken.
Während Rhodan noch darüber nachdenkt, bemerkt er eine Bewegung im Wasser.
Ein Fisch? Oder ein größeres Tier?
Das Wasser kräuselt sich, und etwas durchstößt die Oberfläche. Ein Kopf, Schultern, Arme. Eine menschliche Gestalt, die durch die blutroten Tropfen, die an ihr herunterfließen, zu einem Albtraumwesen mutiert. Langsam schreitet sie auf das Ufer zu. In dem rot verschmierten Gesicht öffnen sich weiße Augen ohne Pupillen. Rhodans Nackenhaare stellen sich auf. Er hat sie zuerst nicht erkannt, aber das ist Pari Sato, die Chefmedizinerin der FANTASY.
Das Wasser gerät auch an anderen Stellen in Bewegung. Noch mehr Gestalten tauchen auf. Rhodan identifiziert den muskulösen Kenianer Peace Kibaki, seinen alten Freund Conrad Deringhouse und dessen Frau Gabrielle Montoya, seine Patentöchter Sophie und Laura Bull-Legacy sowie viele Gesichter, die er nur flüchtig kennt. Es ist die gesamte Besatzung der FANTASY, die sich aus den Tiefes des blutroten Sees erhebt und mit gespenstischen, weißen Augen auf ihn zuwankt. Stolpernd macht Perry Rhodan einen Schritt zurück. Die Kreaturen bleiben wie auf Kommando stehen und heben gleichzeitig den rechten Arm. Sie deuten auf ihn und blecken die Zähne.
Dann zischen alle gleichzeitig: »Verschwinde!«
Mit einem entsetzten Luftschnappen erwachte Perry Rhodan in seiner Kabine. Sein Schlafanzug klebte ihm nass am Körper, und die Luft erschien ihm unangenehm dick wie geronnenes Blut. Ächzend griff er nach einem Glas Wasser, das er neben seinem Bett stehen hatte, und leerte es mit großen, gierigen Schlucken. Diese Albträume gingen ihm an die Substanz. Und sie wurden immer schlimmer.
Er brauchte ein paar Minuten, um sich zu sammeln. Dann stand er auf und ging ins Badezimmer, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Dabei fühlte er sich so erledigt, als ob er nie geschlafen hätte. Müde tappte er zurück zum Bett und legte sich wieder hin. Doch obwohl ihn die Erschöpfung körperlich schmerzte, konnte er nicht mehr einschlafen. Die Bilder des Albtraums verblassten bereits, nicht jedoch sein Eindruck. Das Grauen hatte sich mit so viel Verve im Gehirn festgesetzt, dass er in diesem Moment nicht sicher war, ob er je wieder mit einem guten Gefühl würde einschlummern können.
Rhodan stand auf und zog sich an. Zumindest für den Moment war an Schlaf nicht mehr zu denken. Er würde in die Zentrale gehen.
Seine Kabine lag nur ein paar Schritte davon entfernt.
Kurz darauf stand er vor dem Zugangsschott. Es glitt auf und gab den Blick frei auf den kreisförmigen, in Blau- und Grautönen gehaltenen Raum. Um die Großkonsole im Zentrum, von der Besatzung scherzhaft als »Fliegenpilz« bezeichnet, saßen ein paar Leute. Bis auf Alberto Pérez, den Funk- und Ortungsoffizier, waren es Schichtvertretungen. Den Kommandosessel nahm nicht Conrad Deringhouse, sondern Gabrielle Montoya ein. Die meisten Offiziere hatten derzeit ihre Ruhephase.
Pérez hob den Kopf. »Gut, dass Sie kommen, Sir. Ich habe eine beunruhigende Beobachtung gemacht, ich wollte es gerade melden.«
Rhodan trat zu ihm und sah auf den Wust aus Holos vor Pérez, konnte aber nichts darin erkennen. »Was gibt es, Mister Pérez?«
Die nächsten Worte von Alberto Pérez ließen Perry Rhodans Kehle eng werden. »Ich kann Merkosh seit Stunden nicht mehr finden. Wie es aussieht, ist er verschwunden.«