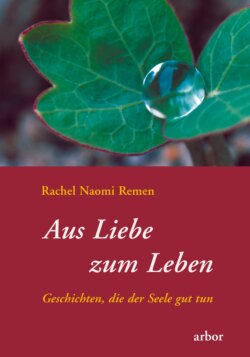Читать книгу Aus Liebe zum Leben - Rachel Naomi Remen - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuthentisch werden
Es war eine Pionierleistung, als die medizinische Fakultät der Stanford Universität ihren Studenten im Jahre 1972 einen Kurs über die menschliche Sexualität anbot. Die erste Sitzung dieses Kurses war mehrere Stunden lang und bestand aus einer Nonstop-Filmvorführung von Dutzenden von Filmen über alle erdenklichen Sexualpraktiken. Manche dieser Filme waren komisch, manche traurig, wenige waren ästhetisch, andere ziemlich abstoßend, aber alle waren ausgesprochen deutlich. Am Ende des Tages war die Sexualität zu etwas so Banalem wie Mittagessen geworden. Die Idee hinter dem Ganzen war, so nehme ich an, künftige Ärzte zu desensibilisieren und ihnen zu helfen, mit Patienten über das Thema Sexualität auf unbefangene, professionelle und persönlich neutrale Weise zu sprechen. Seither habe ich von Medizinstudenten an medizinischen Fakultäten im ganzen Land gehört, dass sie einen solchen „Tag im Kino“ verbracht haben. Viele medizinische Fakultäten wenden diese Methode auch heute noch an.
Wenn ich bedenke, wie es sein muss, mit jemandem über ein so schmerzlich intimes, sensibles und wichtiges Thema zu sprechen, für den diese Dinge jeglichen Sinns beraubt worden sind, dann fühle ich mich traurig und entwürdigt. Ich glaube, dass viele von uns vor dieser Sitzung Menschen mit sexuellen Problemen weitaus besser hätten dienen können als danach. Ich jedenfalls habe Jahre gebraucht, um danach ein Gefühl für die Macht und das Mysterium der Sexualität wiederzugewinnen. Lange Zeit erschien mir Sex nur noch absurd, wenn nicht gar lächerlich.
Hat mich die Universität gelehrt, dass Sex banal ist, dann hat mich die amerikanische Kultur gelehrt, dass Sex nur etwas für junge und perfekte Menschen ist – solche die keine Haare am Körper, keinen Flecken in der Haut, keine Falten und kein Pfund Fett zuviel haben. Vor vielen Jahren saß ich einmal am Strand des Diamond Head in Hawaii und traute mich nicht, meinen Bademantel auszuziehen, weil mir ein halbes Jahr zuvor ein Teil meines Darms operativ entfernt worden war und ich nun einen künstlichen Darmausgang hatte. Um mich herum saßen in kleinen Gruppen einflussreich erscheinende, gutaussehende Männer, die Zigarren rauchten und offenbar miteinander über die Marktsituation diskutierten, während schlanke junge Frauen, die viele Jahre jünger waren als diese Männer, sich in winzigen Bikinis sonnten oder Frisbee spielten. Ihre Körper hatten gleichförmig perfekte Barbiepuppen-Maße, und als ich sie so beobachtete, war ich den Tränen nahe. In ihre Gespräche vertieft, schenkten die Männer den Frauen kaum Aufmerksamkeit.
Am späteren Nachmittag wurde plötzlich der Vorhang einer der Umkleidekabinen beiseite geschoben, und eine Frau mittleren Alters mit einem wilden Schopf lockiger schwarzer Haare trat auf die Bildfläche. Sie trug einen weißen Badeanzug, der wohl für jemanden gedacht war, der fünf bis zehn Kilo schmaler war als sie. Sehr langsam und aufreizend und ausgesprochen selbstbewusst schlenderte sie über den Strand und ins Wasser. Als sie am Wasser angelangt war, waren sämtliche Gespräche am Strand verstummt und die Augen aller Männer hingen an ihr – und auch die vieler Frauen. Das war meine erste Lektion über den Unterschied zwischen Perfektion und Sexappeal.
Echte Sexualität heilt. In ihrer Gegenwart vermochte ich damit zu beginnen, mein eigenes Gefühl für meine Möglichkeiten und meine Ganzheit wiederzuentdecken, und ich bin dieser Frau dankbar, dass sie derart in ihrem Körper zu Hause war. Ohne dass diese Frau mich auch nur kannte, gab sie mir den Anstoß dazu, mich wieder in meinem eigenen Leben einzurichten. Bis heute, etwa dreißig Jahre danach, habe ich Hunderte anderer Menschen, alles Krebspatienten, gesehen, die sich ihre Ganzheit wieder angeeignet haben, indem sie sich ihre Sexualität wieder angeeignet haben.
Klara war eine davon. In ihrem beigefarbenen Leinenanzug und ihrer weißen Seidenbluse machte sie den Eindruck, makellos und kompetent zu sein und alles völlig unter Kontrolle zu haben. Im Vergleich zu ihrer Eleganz erschien mein Wartezimmer geradezu schäbig. Als ich ihren Namen aufrief, erhob sie sich und schüttelte mir die Hand. Ohne ein weiteres Wort folgte sie mir in mein Sprechzimmer und nahm in einem Sessel Platz, wobei sie ihre langen, wohlgeformten Beine an den Fußgelenken überkreuzte.
Ich setzte mich ihr gegenüber und lächelte sie an. Ohne jede Vorwarnung brach sie urplötzlich in Tränen aus. Der Kontrast zwischen ihren Tränen und ihrer selbstbeherrschten Erscheinung war so extrem, dass ich total überrascht war und für einen Augenblick nicht wusste, was ich tun sollte. Dann beugte ich mich vor und nahm ihre Hand zwischen meine Hände, während sie weiter schluchzte. So saßen wir eine ganze Weile da, bis sie sich ausgeweint hatte. Sie wendete mir ihr tränenüberströmtes Gesicht zu und sagte: „Wie peinlich. Ich habe seit Jahren nicht mehr geweint.“
„Nun ja, dies ist eine besondere Zeit“, sagte ich. Sie nickte. „Könnten Sie mir mehr darüber erzählen?“ fragte ich sie.
Sie war zu mir gekommen, weil ihr vor acht Wochen bei einer Operation die rechte Brust entfernt worden war. Nach langer Diskussion hatten sie und ihr Arzt die Entscheidung gemeinsam getroffen. Sie war sich sicher, dass dies die richtige Entscheidung gewesen war, und die Wunde war sehr gut verheilt. „Und, wie war das Ganze für Sie?“ fragte ich sie. „Ich weiß nicht“, sagte sie.
Sie war in den späten Zwanzigern, unverheiratet, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Bis zu ihrer Operation hatte sie täglich Fitnesstraining gemacht und war sehr stolz auf ihren Körper gewesen. Männer hatten sie stets attraktiv gefunden, und es war wichtig für sie gewesen, dass es einen Mann in ihrem Leben gab. Sie hatte viele Liebhaber gehabt, meist Kollegen, die sie in ihren Geschäftskreisen getroffen hatte. „Aber das ist jetzt vorbei“, sagte sie mir. „Ich könnte niemals jemandem erlauben, mich derart entstellt zu sehen.“ Nach ihrer Operation hatte sie die Beziehung zu den beiden Männern, mit denen sie damals ging, beendet. Beide hatten das problemlos akzeptiert und sich anderen Frauen zugewendet.
Niemand an ihrem Arbeitsplatz und keiner ihrer Freunde hatte mitbekommen, dass sie Krebs hatte, erzählte sie mir. Sie war ganz allein damit fertig geworden. Sie war so besessen davon, ihre Krankheit geheim zu halten, dass sie vor ihrer Operation allen Leuten erzählt hatte, sie führe zu einem Urlaub nach Europa; sie hatte sogar arrangiert, dass ihre Freunde Postkarten von ihr aus Übersee erhielten. Selbst ihre Eltern wussten von nichts. Doch nun war sie hier, weil der Druck, das Geheimnis zu bewahren, zu groß geworden war. Sie musste einfach irgendwo reden und sie selbst sein können. „Ich kann nicht zu oft kommen“, sagte sie mir. „Das würde Verdacht erregen.“
„Kommen Sie, wann immer Sie mich brauchen“, sagte ich ihr.
Im Verlauf der folgenden Jahre sah ich sie alle drei oder vier Monate. An der Oberfläche hatte sich ihr Leben nicht wesentlich verändert, außer dass sie nun zölibatär lebte und all ihre Energie in ihre Arbeit steckte. Während eines ihrer seltenen Besuche brachte ich das Gespräch darauf und fragte sie, ob sie vor hätte, für den Rest ihres Lebens allein zu bleiben. „Nur für fünf Jahre, Rachel“, antwortete sie. Als sie meinen überraschten Gesichtsausdruck sah, erklärte sie, dass ihr Onkologe sehr konservativ sei. Sie hatte ihn sich ausgesucht, weil auch sie selbst konservativ war. Sie hatten schon früh über eine Wiederherstellung der Brust gesprochen. Er hatte ihr geraten, mit dieser Operation zu warten, bis fünf Jahre seit der Diagnose vergangen waren. „Und in diesem Zeitraum kann man sehen, ob es einen Rückfall geben wird?“ fragte ich. „Ja“, sagte sie. „Nach fünf Jahren stehen die Chancen gut, dass ich es überstanden habe.“
Wenig mehr als ein Jahr vor diesem wichtigen Jahrestag hatten wir wieder eines unserer Gespräche. Dabei erzählte sie mir, dass sie zur Eröffnung einer Ausstellung in eine Galerie gegangen und dort mit einem Maler ins Gespräch gekommen war, der sie danach auf eine Tasse Kaffee eingeladen hatte. „Er ist ein attraktiver Mann, aber offensichtlich als Liebhaber total ungeeignet“, erzählte sie mir. „Also habe ich ja gesagt.“
„Weil er ungeeignet ist?“ fragte ich überrascht.
„Ich dachte, wir könnten Freunde werden“, antwortete sie. Zu ihrer Überraschung hatte sie sich bei ihm sehr wohl gefühlt. „Werden Sie ihn wiedersehen“, fragte ich sie.
„Ja, ich glaube schon“, meinte sie. „Es macht Spaß, mit ihm zusammen zu sein.“
Drei Monate später, als sie mich wieder aufsuchte, tauchte Peters Name in unserem Gespräch immer wieder auf. Sie waren in den Zoo gegangen. Sie hatte ihn in seinem Atelier besucht und war sehr beeindruckt von seiner Arbeit gewesen. Inzwischen hatte sie auch viele seiner Freunde getroffen, lauter Maler und Bildhauer, und hatte sie alle sehr sympathisch gefunden. Zu ihrer eigen Überraschung hatte sich gezeigt, dass sie sehr gut in diesen Kreis passte und sich mit diesen Menschen wohler fühlte als mit den Menschen, die sie in ihrem Berufsleben traf. „Vielleicht liegt das daran, dass Sie selbst etwas Kreatives haben, Klara“, sagte ich ihr. „Management kann ebenso eine Kunst sein wie Malerei oder Bildhauerei.“ Sie dachte eine Weile darüber nach. Bisher hatte sie sich selbst nicht in diesem Licht gesehen.
Etwa zwei Monate später rief sie mich an, um einen dringenden Termin zu vereinbaren. Als sie in meine Praxis kam, sah sie sehr niedergeschlagen aus. „Das war’s dann wohl“, sagte sie. Ich dachte, dass sie vielleicht einen Rückfall hatte, und spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Aber es war nicht das, was sie gemeint hatte. „Peter hat mir eine Nachricht in meiner Voicebox hinterlassen. Er hat mich zu einem gemeinsamen Wochenende eingeladen. Jetzt werde ich es ihm erzählen müssen“, sagte sie. „Das war’s dann wohl.“
Erleichtert sagte ich: „Nun, vielleicht denkt er gar nicht so, wenn er es erfährt.“
„Das glaube ich kaum“, meinte sie. „Er ist genau die falsche Sorte von Mann. Schönheit ist für ihn alles. Er wird sich sicher abgestoßen fühlen.““ „Wann wollen Sie es ihm erzählen?“, fragte ich.
„Heute, beim Abendessen“, sagte sie.
„Rufen Sie mich an, wenn Sie es brauchen“, sagte ich ihr.
Ich musste den ganzen Abend an sie denken, aber sie rief nicht an. Wochen vergingen, und ich fragte mich immer wieder, was wohl geschehen war, aber ich unterdrückte den Impuls, sie anzurufen und nachzufragen, wie es ihr ginge. Wie es ihre Art war, suchte sie mich drei Monate später wieder auf. Als sie meinen fragenden Blick sah, lachte sie: „Ich habe mich geirrt“, sagte sie. „Er will immer noch, dass wir Freunde sind.““
Wie sich herausstellte, wollte Peter mehr als nur ihr Freund sein, aber Klara hatte das abgelehnt. Ihr Körper erschien ihr zu hässlich, zu entstellt. „Es sind nur noch sechs Monate bis zu meinem fünften Jahrestag“, meinte sie. „Dann werde ich die Brustoperation machen lassen. Vielleicht danach.“ Sie sprach weiter über ihre Pläne. Sie hatte das Datum für die Operation schon vor über einem Jahr festgelegt und hatte mehrere Chirurgen aufgesucht und auch mit einigen von deren Klienten gesprochen, bevor sie sich für einen der Chirurgen entschieden hatte. In ihrem Geschäft hatte sie sich für die Zeit der Operation Urlaub genommen. Da ihre Versicherung diese Art von Schönheitsoperation nicht bezahlte, hatte sie gleich nach der Mastektomie begonnen, Geld für die Wiederherstellung der Brust zu sparen, und hatte im Lauf der Jahre genug zur Seite gelegt. Die Operation würde teuer und schwierig werden, aber sie hoffte, dass sie sich danach wieder ganz fühlen würde. Einige Minuten blickte sie auf ihre im Schoß verkrampften Hände hinab. Dann sah sie mich an. „Ich hoffe, es funktioniert, Rachel“, sagte sie. Ich war nicht ganz sicher, aber ich glaubte Tränen in ihren Augen zu sehen.
Ich sah sie erst wenige Tage vor ihrem Jahrestag wieder. Als sie in mein Sprechzimmer kam, sah sie aufgeregt und glücklich aus. Ich freute mich, dieses Ereignis mit ihr feiern zu können, und fragte sie nach der bevorstehenden Operation. Sie lächelte und eröffnete mir, dass sie die Operation abgesagt habe. „Nanu“, sagte ich überrascht. „Wie kommt das?“ Sie sah mich einen Moment still an, und dann knöpfte sie ihre Bluse auf und streifte sie von den Schultern. Sie trug keinen Büstenhalter und ihre linke Brust war traumhaft schön. Aber ihre Schönheit wurde von einer radikalen Veränderung an ihrem Körper noch überschattet. Ihre Operationsnarbe war von einem Strauß kleiner, raffiniert tätowierter Blüten überdeckt. Sie sahen ganz echt aus. In wunderbaren Pastellfarben kletterten die Blumen zu ihrer rechten Schulter hinauf. Als sie sich umdrehte, sah ich, dass sie über ihre Schultern hinabfielen und wie vom Winde verweht über ihren Rücken verstreut waren. Sie stand da und zog ihre Hose über ihre Hüften hinab. Ihr Körper war wunderschön. Eine kleine tätowierte Blüte hatte sich in einem Grübchen über ihrer Hüfte niedergelassen, eine weitere schmiegte sich an ihre rechte Pobacke. Darunter befand sich, wie die Signatur eines Gemäldes, ein kleines „P.“ Mein Mund stand vor Überraschung offen, und gleichzeitig fühlte ich einen Stich von Neid. Sie war unbeschreiblich erotisch. Frauen wie sie sehen Männer in ihren Träumen.
Sie streifte sich ihre Bluse wieder über, knöpfte ihre Hose zu, nahm wieder Platz und lachte laut über meinen entgeisterten Gesichtsausdruck. „Ist das nicht herrlich?“, sagte sie. „Peter hat es gemalt, und wir sind nach Amsterdam geflogen, um es eintätowieren zu lassen. Dann haben wir das Geld, das ich für die Operation gespart hatte, für eine Hochzeitsreise verwendet. Ich bin so glücklich, Rachel“, sagte sie und errötete leicht. „Mein Ehemann hat mich total davon überzeugt, dass alles wirklich Schöne vollkommen gleichwertig ist.“