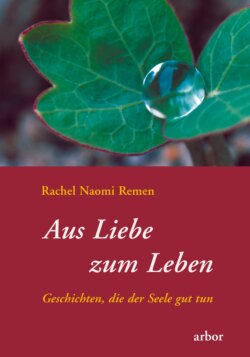Читать книгу Aus Liebe zum Leben - Rachel Naomi Remen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEINFÜHRUNG
Wenn mein Großvater uns besuchen kam, brachte er mir oft ein Geschenk mit. Diese Geschenke gehörten aber nicht zu der Sorte von Dingen, die ich von anderen Menschen erhielt: Puppen, Bücher und Stofftiere. Meine Puppen und Stofftiere sind schon seit über einem halben Jahrhundert verschwunden, aber viele der Geschenke meines Großvaters begleiten mich noch heute.
Einmal brachte er mir einen kleinen Pappbecher mit. Ich schaute hinein, erwartete irgendeine Überraschung. Er war voller Erde. Ich durfte nicht mit „Schmutz“ spielen und sagte ihm das – enttäuscht. Er lächelte mich liebevoll an. Dann nahm er den kleinen Teekessel aus meiner Puppenstube und ging mit mir in die Küche, um ihn mit Wasser zu füllen. Zurück im Kinderzimmer stellte er den Pappbecher auf das Fensterbrett und händigte mir den Teekessel aus. „Wenn Du versprichst, jeden Tag etwas Wasser in den Becher zu gießen, dann wird vielleicht etwas geschehen“, sagte er mir.
Damals war ich vier Jahre alt und mein Kinderzimmer befand sich im sechsten Stock eines Mietshauses in Manhattan. Ich wusste nicht, wozu das mit dem Wasser gut sein sollte, und schaute ihn zweifelnd an. Er nickte mir aufmunternd zu. „Jeden Tag, Neshume-le“, betonte er.
Also versprach ich es ihm. Zuerst machte es mir nichts aus, seiner Aufforderung nachzukommen, denn ich war neugierig zu sehen, was geschehen würde. Aber als Tage vergingen, ohne dass sich irgend etwas tat, fiel es mir immer schwerer, daran zu denken, Wasser in den Becher zu gießen. Nach einer Woche fragte ich meinen Großvater, ob es jetzt nicht langsam genug sei. Doch er schüttelte den Kopf und sagte: „Jeden Tag, Neshume-le.“ Eine zweite Woche weiterzumachen, erwies sich als noch schwerer, und ich bedauerte langsam, versprochen zu haben, Wasser in den Becher zu gießen. Als mein Großvater wieder zu Besuch kam, versuchte ich, ihm den Becher zurückzugeben, doch er nahm ihn nicht an und sagte nur: „Jeden Tag, Neshume-le.“ Als die dritte Woche gekommen war, begann ich zu vergessen, Wasser in den Becher zu gießen. Oft fiel es mir erst wieder ein, nachdem man mich zu Bett gebracht hatte, und ich musste wieder aufstehen und es im Dunkeln nachholen. Aber ich ließ keinen Tag aus. Und eines Morgens waren da zwei kleine grüne Blätter, die am Abend zuvor noch nicht dagewesen waren.
Ich staunte nicht schlecht. Tag für Tag wurden sie größer. Ich konnte es kaum erwarten, meinem Großvater davon zu berichten, war sicher, dass er genauso überrascht sein würde wie ich selbst. Aber natürlich war er es nicht. Er erklärte mir, dass das Leben überall sei, versteckt an den unwahrscheinlichsten Orten. Ich strahlte. „Und es braucht nur ein bisschen Wasser, Großvater?“ fragte ich ihn. Er legte mir sanft die Hand auf den Kopf. „Nein, Neshume-le“, antwortete er. „Alles, was es braucht, ist deine Zuverlässigkeit.“
Diese Erfahrung war vielleicht meine erste Lektion in der Macht des Dienens, aber ich verstand sie damals noch nicht so. Mein Großvater hätte diese Worte wohl auch nicht verwendet. Er hätte gesagt, dass wir nicht vergessen dürfen, das Leben um uns herum und in uns selbst zu segnen. Er hätte gesagt, wenn wir nur daran dächten, dass wir das Leben zu segnen vermögen, dann könnten wir die Welt in Ordnung bringen.
Mein Großvater hatte die Kabbala studiert, die mystischen Lehren des Judentums. Meine Eltern genauso wie meine Tanten und Onkel standen diesen Studien misstrauisch gegenüber. Einigen waren sie eher peinlich, sie sahen eine verschrobene Eigenart ihres Altvorderen darin; anderen war diese Vorliebe gar nicht geheuer, sie argwöhnten magische Umtriebe dahinter. Als mein Großvater gestorben war, verschwanden die alten in Leder gebundenen Handschriften, die er täglich studiert hatte, einfach von der Bildfläche. Ich habe nie herausgefunden, was mit ihnen geschehen ist.
Nach den Lehren der Kabbala wurde das Heilige an einem bestimmten Punkt des Ursprungs aller Dinge in zahllose Funken zertrümmert, die über das gesamte Universum verstreut wurden. Wir alle und alle Dinge tragen einen jener göttlichen Funken in uns, die eine Art Diaspora Gottes darstellen. Der immanenten Gegenwart Gottes begegnen wir täglich in den einfachsten, bescheidensten, gewöhnlichsten Dingen. Die Kabbala lehrt uns, dass das Heilige jederzeit aus den alltäglichen Dingen zu uns sprechen kann. Die Welt mag uns ins Ohr flüstern oder der göttliche Funke wispert in unserem Herzen. Mein Großvater hat mir gezeigt, wie man darauf hören kann.
In der jüdischen Tradition werden wir dazu angehalten, solche unerwarteten Begegnungen mit dem Heiligen durch einen Segensspruch zu würdigen. Es gibt Hunderte solcher Segenssprüche – ein jeder davon ist Zeugnis eines Augenblicks des Erwachens, in dem wir uns des heiligen Wesenskerns der Welt erinnern. In solchen Momenten kommen Himmel und Erde zusammen und grüßen und bestätigen einander.
Es gibt einen Segensspruch für jede Gelegenheit, bei der wir auf etwas Neues und für unsere Erfahrung Wesentliches treffen. Meine Mutter war zugegen, als ich meinem Großvater das erste Mal begegnete. Da er mich sehen wollte, ging sie bald nach meiner Geburt mit ihm in das Krankenhaus, wo ich in einem Brutkasten lag. Wie sie mir später erzählte, stand er lange schweigend da und betrachtete mich durch das Fenster des Besuchszimmers. Ich war viel zu früh gekommen. Sie fürchtete, er könnte besorgt sein oder sich gar abgestoßen fühlen, weil ich so klein und zerbrechlich war, und wollte gerade einige ermunternde Worte an ihn richten, als sie hörte, wie er etwas vor sich hin flüsterte. Es war kaum zu hören, und so bat sie ihn, seine Worte für sie zu wiederholen. Er drehte sich mit einem Lächeln zu ihr um und sagte auf Hebräisch: „Gesegnet seist Du, O Herr, unser Gott, König des Universums, der Du uns am Leben erhalten und behütet und uns heil zu diesem Augenblick geleitet hast.“ Dies ist eine Segnung, welche die Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens zum Ausdruck bringt, und sie war zugleich der Beginn unserer Beziehung.
Mein Großvater kannte und benutzte vielerlei Segenssprüche. Diese Segnungen hatten große rabbinische Lehrer der Vergangenheit für die Nachwelt formuliert, und jede von ihnen gilt als ein Augenblick des Innewerdens – eine Bestätigung der Tatsache, dass wir mitten im Alltäglichen dem Heiligen begegnet sind. Man segnet nicht nur das Essen mit solchen Sprüchen. Es gibt Segenssprüche für das Händewaschen, für den Moment, da man die Sonne aufgehen oder untergehen sieht. Wenn man etwas verloren hat oder etwas wiederfindet, wenn etwas anfängt oder endet, spricht man eine Segnung. Und selbst die geringste der körperlichen Funktionen hat ihre eigene Segnung. Mein Großvater war ein orthodoxer Rabbi und er sprach sie alle und neigte seinen schwarzen Filzhut viele Male am Tag vor dem Heiligen, während er mit den kleinsten Details des täglichen Lebens umging.
Ich wurde als Kind zweier überzeugter Sozialisten geboren, für die alles Religiöse „Opium für das Volk“ war. Doch obwohl niemand in meinem engeren Familienkreis diese Segenssprüche benutzte, kam es mir in der Gegenwart meines Großvaters ganz natürlich vor, sie zu sprechen. Früher einmal kannte ich viele von ihnen auswendig, aber seither habe ich die meisten vergessen. Was ich allerdings nicht vergessen habe, ist, wie wichtig es ist, das Leben zu segnen.
Als Kind sah ich mich hin und her gerissen zwischen zwei sehr unterschiedlichen Anschauungen des Lebens: der meines Großvaters, mit seinem Sinn für den heiligen Wesenskern der Welt, und der meiner akademisch hochgebildeten Onkel, Tanten und Cousins, die ganz und gar wissenschaftlich ausgerichtet war. Alle Kinder meines Großvaters waren Ärzte und Krankenschwestern, und viele ihrer Kinder ebenfalls. Als ich älter wurde und die Zeit eine größere Distanz zwischen uns schuf, schien mein Großvater so etwas wie eine Insel des Mystischen in einem riesigen Ozean der Naturwissenschaft zu werden. Ich wollte unbedingt erfolgreich sein und einen Beitrag zum öffentlichen Leben leisten und drängte ihn zusammen mit anderen Dingen meiner Kindheit in den Hintergrund meiner Erinnerungen. Er war gestorben, als ich erst sieben Jahre alt war, und es sollte viele Jahre dauern, bis ich eine Verbindung zwischen seinen Ansichten und der Arbeit im medizinischen Bereich herstellen würde. Wenn man nur lange genug seinen Kurs beibehält, dann zeigt sich manchmal, dass ganz verschiedene Wege zum selben Ziel führen können. Mein Großvater segnete das Leben und seine Kinder dienten dem Leben. Aber am Ende kann das, wie sich herausgestellt hat, ein und dasselbe sein.
Als junge Ärztin glaubte ich, dem Leben zu dienen sei eine Angelegenheit voller Dramatik – des raschen Handelns und der in Sekundenbruchteilen zu treffenden Entscheidungen über Leben und Tod. Für mich bedeutete es, in schlaflosen Nächten mit der Belegschaft einer Notaufnahme dem Engel des Todes ein Schnippchen zu schlagen. Eine Rolle, die nur Menschen zustand, die sich viele Jahre darauf vorbereitet hatten. Dieses Dienen war etwas Großartigeres als das gewöhnliche Leben und die Menschen, die derart dienten, waren ebenfalls großartiger als das Leben. Doch heute weiß ich, dass dies nur der letzte Teil dessen ist, was das Dienen ausmacht. Dass das Dienen klein und still und überall ist. Dass wir sehr viel öfter durch das dienen, was wir sind, als durch das, was wir wissen. Und dass jedermann dient, gleich ob sie oder er es weiß oder nicht.
Wir segnen das Leben um uns herum weit öfter, als uns bewusst wird. Viele ganz einfache, gewöhnliche Dinge, die wir tun, können das Leben anderer in unserer Umgebung tiefgreifend beeinflussen: der unverhoffte Telefonanruf, die flüchtige Berührung, die Bereitschaft, mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören, ein warmes Lächeln oder ein anerkennendes Augenzwinkern. Wir können sogar völlig Fremde segnen und von ihnen gesegnet werden. Große Botschaften kommen in kleinen Rationen. Jemandem einen verlorenen Ohrring oder einen fallengelassenen Handschuh wiederzugeben kann manchmal schon genügen, um das Vertrauen dieses Menschen in die Welt wiederherzustellen.
Segnungen werden uns in so einfacher Form zuteil wie in dem üblichen Gruß der Inder. Auch wenn man einen völlig fremden Menschen trifft, verbeugt man sich dort und sagt Namaste: „Ich sehe den göttlichen Funken in dir.“ Wir allerdings lassen uns nur zu oft von der äußeren Erscheinung eines Menschen täuschen, von seinem Alter, seiner Krankheit, seinem Zorn oder seiner Gewöhnlichkeit oder wir sind einfach zu beschäftigt, um zu erkennen, dass es in jedem einen Ort des Gutseins und der Integrität gibt, wie tief er auch vergraben sein mag. Wir haben es zu eilig oder sind zu zerstreut, um innezuhalten und dieses Ortes gewahr werden zu können. Wenn wir den Funken des Göttlichen in anderen erkennen, dann fachen wir ihn mit unserer Aufmerksamkeit an und stärken ihn, ganz gleich, wie tief oder für wie lange er schon vergraben ist. Wenn wir jemanden segnen, dann berühren wir das ungeborene Gutsein in ihm und bekräftigen es.
All das Ungeborene in uns und in der Welt bedarf der Segnung. Mein Großvater glaubte daran, dass das Heilige alle Dinge geschaffen hat. „Es ist an uns, Neshume-le“, sagte er mir, „die Menschen zu stärken und zu nähren und sie, wann immer es geht, dazu frei zu machen, Seine Zwecke zu erkennen und zu verwirklichen.“ Und Segnungen stärken und nähren das Leben ebenso, wie Wasser es tut.
Mir hat einmal eine Frau erzählt, sie fühle nicht das Bedürfnis, auf die Menschen um sie herum zuzugehen, weil sie jeden Tag bete. Das sei doch sicherlich genug. Aber im Gebet geht es um unsere Beziehung zu Gott. Eine Segnung betrifft unsere Beziehung zu dem göttlichen Funken in einem anderen Menschen. Gott braucht unsere Aufmerksamkeit vielleicht nicht so dringend wie der Mensch neben uns im Bus oder hinter uns in der Schlange vor der Kasse im Supermarkt. Jeder Mensch auf dieser Welt ist wichtig, und die Segnungen dieser Menschen sind es auch. Wenn wir jemanden segnen, dann gewähren wir ihm Zuflucht vor einer gleichgültigen Welt.
Jedermann besitzt die Fähigkeit, das Leben zu segnen. Und die Kraft unseres Segens wird durch Krankheit oder Alter nicht verringert. Ganz im Gegenteil, je älter wir werden, desto machtvoller werden unsere Segnungen. Sie haben all unsere Schicksalsschläge überlebt. Wir mögen einen langen und schweren Weg hinter uns gebracht haben, ehe wir an den Punkt gelangt sind, wo wir uns wieder dessen erinnern können, was wir sind. Dass wir diese Reise bestanden haben und uns erinnern, mag jenen, die wir segnen, Mut machen. Vielleicht können sie sich irgendwann einmal ebenfalls dieses Ortes jenseits des Wettstreites und Konkurrenzkampfes erinnern, dieses Punktes, an dem wir zueinander gehören.
Eine Segnung ist nicht etwas, das ein Mensch einem anderen gibt. Eine Segnung ist ein Augenblick der Begegnung, eine bestimmte Art von Beziehung, in der die beiden betroffenen Menschen sich ihrer wahren Natur und ihres wahren Wertes erinnern, diese bestätigen und in der sie das, was im Einzelnen ganz und gesund ist, bestärken. Indem wir in unseren Beziehungen Raum für diese Ganzheit schaffen, bieten wir anderen die Gelegenheit, ohne Befangenheit ganz zu sein, und wir werden für sie zu einem Ort der Zuflucht vor dem, was in ihnen und um sie herum nicht echt ist. So machen wir es den Menschen möglich, sich dessen zu erinnern, was sie sind.
Ich habe dies zuerst von Menschen gelernt, die im Sterben lagen, Menschen, die zu einer authentischeren Beziehung zu anderen Menschen übergegangen waren, weil für sie nur noch das Echte zählte. Diese Menschen hatten jene Verhaltensweisen hinter sich gelassen, mit denen sie sich verbogen hatten, um die Zustimmung anderer zu gewinnen, und dadurch fühlten andere sich in ihrer Gegenwart sicher genug, ebenfalls ihre Masken fallen lassen zu können. Ihre unerschütterliche Akzeptanz erlaubte es mir, mich an etwas längst Vergessenes zu erinnern. In ihrer Gegenwart wurde mir klar, dass ich mich in vieler Hinsicht auf eine Weise verändert hatte, die mich kleiner und schwächer gemacht hatte. Die Sterbenden akzeptierten, ja brauchten sogar Teile meiner selbst, die ich selber viele Jahre lang verurteilt und versteckt hatte. Ich spürte, dass das Leben in mir durch solche Menschen gesegnet wurde. Ich fühlte, dass es sich wieder ausdehnen und zu seiner wahren Größe, Gestalt und Macht zurückfinden konnte, ohne jede Scham. Das war lange bevor mir schließlich aufging, dass man nicht im Sterben liegen muss, um andere Menschen auf diese Weise segnen zu können.
Die Menschen, die das Leben segnen und ihm dienen, finden einen Ort der Geborgenheit und Kraft, eine Zuflucht vor einer Weise zu leben, die sinnlos, leer und einsam ist. Indem wir das Leben segnen, kommen wir einander, aber auch unserem eigenen, authentischen Selbst näher. Werden Menschen gesegnet, dann entdecken sie, dass ihr individuelles Leben wichtig ist, dass sie etwas in sich tragen, das der Segnung wert ist. Und wenn Sie andere segnen, finden Sie vielleicht heraus, dass dasselbe auch auf Sie selbst zutrifft.
Wir dienen nicht etwa den Schwachen und Zerbrochenen. Wir dienen vielmehr der Ganzheit ineinander und der Ganzheit im Leben. Der Teil in dir, dem ich diene, ist eben der Teil in mir, der gestärkt wird, wenn ich diene. Anders als beim Helfen und Reparieren und Retten, ist das Dienen etwas Gegenseitiges. Es gibt viele Weisen, dem Leben um uns herum zu dienen und es zu stärken: durch Freundschaft, Elternschaft oder Beruf, durch Freundlichkeit, Mitgefühl, Großzügigkeit oder Toleranz. Durch unsere Menschenliebe, unser Beispiel, unsere Ermutigung, unsere aktive Teilnahme, unseren Glauben. Ganz gleich, auf welche Weise wir es tun – unser Dienen wird uns segnen.
Wenn wir freigebig mit unseren Segnungen umgehen, nimmt das Licht in der Welt zu, um uns herum und in uns. Nach der Kabbala ist Tikkun Olam unsere kollektive Aufgabe als Menschen: die Erhaltung und Wiederherstellung der Welt.
Als Kind gefiel mir von allen Geschichten meines Großvaters die von Noah und der Arche am besten. Er hatte mir ein Malbuch geschenkt mit Bildern von allen Tieren, immer zwei und zwei, sowie von Noah und seiner Frau. Die beiden sahen ein wenig aus wie Herr und Frau Nikolaus, waren aber anders angezogen. Wir beide verbrachten Stunden gemeinsam damit, diese Bilder auszumalen, und bei dieser Gelegenheit lernte ich im Alter von etwa vier Jahren die Namen vieler Tiere. Wir sprachen natürlich auch lang und breit über die Geschichte, verwundert über die Möglichkeit, dass selbst Gott manchmal Fehler machen kann und dann eine Sintflut schicken muss, um neu anzufangen.
Das letzte Bild in diesem Malbuch war ein wunderschöner Regenbogen. „Der steht für ein Versprechen zwischen Gott und dem Menschen, Neshume-le“, sagte mein Großvater. „Nach der Sintflut versprach Gott Noah und allen von uns, dass dies nie wieder geschehen werde.“
Aber so leicht ließ ich mich nicht abspeisen. Zu der ganzen Sache war es schließlich gekommen, weil die Menschen böse gewesen waren. „Auch wenn wir sehr unartig sind, Opa?“ fragte ich. Mein Großvater lachte: „Nun ja, so heißt es in dieser Geschichte.“ Dann sah er nachdenklich drein. „Aber es gibt auch andere Geschichten.“ Ich war begeistert und bat ihn, mir eine andere Geschichte zu erzählen.
Die Geschichte, die er mir daraufhin erzählte, ist sehr alt und stammt aus der Zeit des Propheten Jesaja. Es war die Legende der Lamed-Waw. In dieser Geschichte sagt uns Gott, dass er die Welt so lange bestehen lassen wird, wie zu irgendeiner Zeit noch wenigstens sechsunddreißig gute Menschen in der gesamten Menschheit leben. Also Menschen, die in der Lage sind, eine Antwort auf das Leiden zu geben, das Teil der menschlichen Existenz ist. Diese Sechsunddreißig werden die Lamed-Waw genannt. Wenn es irgendwann einmal weniger als sechsunddreißig von diesen Menschen geben sollte, wird die Welt untergehen.
„Weißt du, wer diese Leute sind, Opa?“ fragte ich ihn und war sicher, er würde ja sagen. Aber er schüttelte den Kopf. „Nein, Neshume-le“, antwortete er mir. „Nur Gott weiß, wer die Lamed-Wawniks sind. Und die Lamed-Wawniks selbst wissen nicht wirklich, welche Rolle sie für das Fortbestehen der Welt spielen – und sonst weiß es auch niemand. Sie antworten auf das Leiden, aber nicht, um die Welt zu retten, sondern einfach, weil das Leid anderer sie berührt und ihnen etwas bedeutet.“
Wie sich zeigen sollte, konnten die Lamed-Wawniks Schneider oder Universitätsprofessoren sein, Millionäre oder Habenichtse, machtvolle Führungspersönlichkeiten oder machtlose Opfer. Diese Dinge waren nicht wichtig. Was zählte, war nur ihr Vermögen, das kollektive Leid der menschlichen Rasse zu empfinden und auf das Leiden um sie herum zu reagieren. „Und da niemand weiß, wer sie sind, Neshume-le, könnte jeder Mensch, den du triffst, einer von den Sechsunddreißig sein, um derentwillen Gott die Welt weiterbestehen lässt“, sagte mein Großvater. „Es ist also ganz wichtig, jedermann so zu behandeln, als wäre er einer von ihnen.“
Ich saß da und dachte lange über diese Geschichte nach. Das war eine andere Geschichte als die von Noahs Arche. Der Regenbogen bedeutete, dass es auf jeden Fall ein Happy-End geben würde, so wie in den Geschichten, die mein Vater mir als Gutenachtgeschichten vorlas. Aber diese Geschichte meines Großvaters machte keine solche Versprechungen. Gott hatte von den Menschen eine Gegenleistung für das Geschenk des Lebens verlangt, und er verlangte sie immer noch.
Plötzlich wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, was es eigentlich war, das er verlangte. Wenn so viel davon abhing, musste es etwas sehr Schweres sein, etwas, das ein großes Opfer verlangte. Was, wenn die Lamed-Wawniks das nicht leisten konnten? Was dann? „Wie antworten die Lamed-Wawniks auf das Leiden, Opa?“ fragte ich, plötzlich ziemlich beunruhigt. „Was müssen sie tun?“ Mein Großvater lächelte mich zärtlich an. „Ach weißt du, Neshume-le“, sagte er, „eigentlich müssen sie gar nichts tun. Sie reagieren mit Mitgefühl auf das Leiden. Ohne Mitgefühl kann die Welt nicht weitergehen. Unser Mitgefühl segnet und erhält die Welt.“
Wollen wir zu größerem Mitgefühl zurückfinden, so kann uns das in Konflikt mit den innersten Werten unserer Kultur bringen. Unsere Kultur ist eine, die Beherrschung und Kontrolle wertschätzt, in der Selbstständigkeit, Kompetenz und Unabhängigkeit kultiviert werden. Aber im Schatten dieser Werte findet sich eine tiefverwurzelte Ablehnung unserer menschlichen Ganzheit. Als Individuen und als Kultur haben wir eine Art Verachtung für alles in uns und in anderen entwickelt, was Bedürfnisse hat und fähig ist, zu leiden. Dies ist keine freundliche Welt.
Und während das Leben auf diese Weise kälter und irgendwie härter wird, strampeln wir uns ab, um für uns und unsere Lieben durch unser Wissen, unsere Fähigkeiten, unser Einkommen irgendeinen sicheren Ort zu schaffen. Wir schaffen Sicherheitszonen in unseren Wohnungen und Büros und selbst in unseren Autos. Diese Plätze trennen uns voneinander. Doch Plätze, die Menschen voneinander trennen, sind nie sicher genug. Vielleicht ist das Gutsein, die Güte, die wir jeweils ineinander finden, unsere einzige Zuflucht.
In einer hochtechnisierten Welt kann es leicht geschehen, dass wir unsere eigene Güte vergessen und mehr Wert legen auf unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenz. Aber es ist nicht unsere Kompetenz, durch die die Welt wiederhergestellt wird. Mehr als von unserer Kompetenz, könnte die Zukunft davon abhängen, ob wir dem Leben treu zu sein vermögen.
Wieder zu lernen, einander zu segnen, ist heute wichtiger denn je. Die Lösung des Problems der Destruktivität in unserer Welt verlangt nicht nur technisches Wissen. Um die Welt wieder in Ordnung bringen zu können, müssen wir vielleicht eine tiefere Verbindung zum Leben um uns herum finden; wahrscheinlich müssen wir an die Stelle unserer unablässigen Jagd nach mehr und mehr Kompetenz die Fähigkeit treten lassen, uns mit dem Leben anzufreunden. Es heißt, dass die Menschheit Tausende von Jahren gebraucht hat, um den Wert eines individuellen menschlichen Lebens zu erkennen und zu verteidigen. Was wir darüber hinaus noch begreifen müssen, ist, dass der Wert eines jeden menschlichen Lebens begrenzt bleibt, wenn es darin nichts gibt, was für das Wohl anderer und für das Wohl des Lebens selbst eintritt. Eine Frau aus Pinson in Texas hat mir ein Zitat aus dem Zweiten Buch Mose geschickt, das meinem Großvater sicherlich sehr gefallen hätte: „Baut Altäre an den Plätzen, an denen Ich euch daran erinnert habe, wer Ich bin, und Ich werde kommen und euch dort segnen.“ Die Segnung, die wir erhalten, wenn wir uns wieder daran erinnern, wie man das Leben segnet, könnte nichts Geringeres sein als das Leben selbst.
Darüber, wie man das Leben segnet und ihm dient, habe ich viel von den Patienten in meiner Praxis gelernt. Das kommt vielleicht daher, dass der Krebs die Menschen dazu zwingt, sich ihre eigene Verwundbarkeit sehr genau anzusehen. So gelangen sie zu der Einsicht, dass wir alle diese Verwundbarkeit miteinander teilen. Ist das einmal deutlich geworden, dann kann man gar nicht mehr anders, als zu antworten. Ich habe so oft erlebt, wie Menschen durch ihre Begegnung mit großem Leid ohne jede weitere Anstrengung viel mitfühlender und altruistischer als zuvor geworden sind, dass ich mich frage, ob das Segnen des Lebens nicht der letzte Schritt irgendeines natürlichen Prozesses der Heilung von Leiden ist. Eine Segnung ist eine Zuflucht, eine Rückbindung an das in uns, was kohärent und ganz ist. Sie ist eine Erinnerung an das, was wir sind.
Einer meiner Patienten, ein Anwalt, der auf dem Gebiet des Zivilrechts arbeitet, starb fast an Krebs. Einige Jahre später erzählte er mir, diese Erfahrung habe ihm erlaubt, zu einer ganz unverhofften Kraft zu finden. „Ich entdecke heute etwas in anderen, das ich in mir selbst gefunden habe. Etwas, das darum ringt, Hindernisse zu überwinden und authentisch zu leben“, berichtete er mir. „Ich kann seinen Kampf erkennen, und ich spreche seine Sprache. Also kann ich es stärken …“, er hielt nachdenklich inne, „… wie andere es in mir gestärkt haben. Meine Frau sagt mir, ich hätte endlich mein Herz geöffnet. Das mag sein, aber das trifft es nicht genau.“ Und dann, nach einem Moment des Schweigens: „Wenn es sich nicht so seltsam anhörte, würde ich vielleicht sagen, dass ich das Leben in anderen Menschen segnen und mich von ihnen segnen lassen kann. Ich mache das in meiner Arbeit, aber es geht über meine Arbeit hinaus. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass es das Wichtigste ist, was ich zu tun vermag.“
Eine Freundin und Kollegin erzählte mir über ihr Erleben der ersten Stunden, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Sohn ertrunken war. Sie war in die Küche gegangen, um eine Tasse Tee zu trinken, und eine andere Frau, die selbst von Kummer überwältigt war, hatte sie gescholten, wie sie denn in einer Stunde wie dieser Tee trinken könne. „Bis zu jenem Zeitpunkt, Rachel, war ich ein Mensch, der stets fürchtete, irgend etwas falsch zu machen; bei den kleinsten Verrichtungen war ich immer voller Zögern und Selbstzweifel. Aber als diese Frau mich derart anfuhr, wusste ich plötzlich, dass ich in diesem Zustand nichts falsch machen konnte. Ich war in einer solchen Tiefe getroffen, dass alles, was ich daraufhin tat oder sagte oder dachte oder fühlte, vollkommen wahrhaftig war. Dies ging über alle Regeln, über jede Beurteilung hinaus. Dies war ganz meines.“
Ihr Heilungsprozess brauchte lange, mehr als acht Jahre. Heute arbeitet sie mit Gruppen von Menschen, die an Krebs leiden. Sie hilft ihnen, durch ihren Schmerz und ihr Leiden hindurchzugehen, um wieder zu dem Platz in ihnen selbst zurückzufinden, der ganz und heil ist. Wenn sie heute davon spricht, dann sagt sie: „Der Verlust meines Sohnes wurde für mich von einem einmaligen Ereignis zu etwas, das in die Struktur meines Lebens eingewoben ist. Er ist mir immer gegenwärtig, ist Teil meiner Arbeit, Teil meiner Erfahrung. Nachdem ich einmal einen derart tiefen Kummer, einen solch heftigen Schmerz erfahren habe, habe ich keine Angst mehr, dorthin zurückzugehen. Ich habe ihn direkt kennengelernt, bin durch ihn hindurchgegangen und kenne ihn sehr gut. Und ich habe ihn irgendwie überlebt. Mir scheint, die Menschen in meiner Gruppe spüren das. Sie wissen, dass ich keine Angst mehr habe. Das gibt uns die Erlaubnis, an jene Orte des Kummers und des Schmerzes zu gehen, unser Leiden und seine tiefe Bedeutung anzuerkennen – wenn es das ist, was gerade notwendig ist. Das bringt ein Gefühl der Sicherheit in die Gruppe.“
Sie hielt gedankenverloren inne. „Es bringt auch eine tiefe Bestätigung mit sich, an diesen Ort zurückzugehen, denn er hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Manchmal ist es, als wäre ich dort wieder mit meinem Sohn zusammen – in jenen Momenten, wo ein tiefer Kummer im Raum steht.“
Die siebenunddreißig Jahre meiner Tätigkeit als Ärztin haben mir gezeigt, dass alles von diesem Stoff, aus dem unser Leben gemacht ist – unsere Freuden, unsere Misserfolge, unsere Lieben, unsere Verluste, ja selbst unsere Krankheiten – zum Stoff des Dienens werden kann. Ich habe Menschen das Leben mit allen möglichen Dingen segnen sehen. In uns allen gibt es eine derart schlichte Größe, dass nichts verschwendet werden muss.
Die Kraft, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, tragen Sie bereits in sich. Wenn jemand Sie segnet, dann ist das eine kleine Erinnerung – etwas, das die Knoten von Meinungen und Furcht und Selbstzweifel, die Sie von Ihrer eigenen Güte getrennt haben, ein wenig auflöst. Es gibt Ihnen die Freiheit, selbst zu segnen und Segnungen von allem um Sie herum zu empfangen.
Als er bereits sehr krank war, sprach mein Großvater eines Nachmittags mit mir über den Tod und sagte mir, dass er im Sterben läge. „Was soll das heißen, Opa?“ fragte ich besorgt und ängstlich. „Ich gehe anderswo hin, Neshume-le. Näher zu Gott.“ Mir verschlug es die Sprache. „Kann ich dich dort besuchen“, brachte ich schließlich voller Verzweiflung heraus. „Nein“, sagte er. „Aber ich werde auf Dich aufpassen und ich werde jene Menschen segnen, die dich segnen.“ Fast fünfundfünfzig Jahre sind seitdem vergangen und mein Leben ist seither durch viele Menschen gesegnet worden. Jeder von euch hat den Segen meines Großvaters.