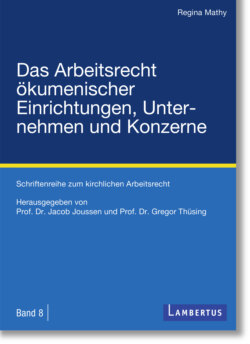Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 79
(ii) Rechtsprechung
ОглавлениеIn einer Entscheidung zur Kirchensteuerpflicht im Zusammenhang mit der Frage, ob sich durch einen Wohnsitzwechsel eine Änderung in konfessioneller Beziehung ergeben hat, knüpfte das BVerfG an das Merkmal der Bekenntnisidentität an.447 Dieses Verständnis ist jedoch zu eng. Ein vollkommener Konsens der Mitglieder wird in keiner Religionsgemeinschaft zu finden sein.448 Selbst zwischen den in der EKD zusammengeschlossenen Gliedkirchen gibt es unterschiedliche Bekenntnisgrundlagen (vgl. Art. 1 Abs. 1 S. 3 GO.EKD).449 Ein verbindliches Lehramt besteht innerhalb der EKD nicht.450 An Bekenntnisschriften sind lediglich Pfarrer im Rahmen der Ordination gebunden, für einzelne Gläubige sind diese nicht verbindlich.451 Zudem besteht zwischen den Gliedkirchen Kirchengemeinschaft (Leuenburger Konkordie), Art. 1 Abs. 2 GO.EKD. Lutheraner und Reformierte divergieren hinsichtlich des Verständnisses des Abendmahls. Nichts desto trotz sind einige Landeskirchen der EKD uniert.452 Dennoch ändert auch das nichts an ihrem Status als Religionsgemeinschaft – sowohl der einzelnen Landeskirchen als auch der EKD.
In seiner Entscheidung zur Bahá´í-Gemeinschaft453 stellte das BVerfG – ohne nähere Begründung – darauf ab, dass sich der Charakter eines Verbundes von Gläubigen als Religionsgemeinschaft auch aus der aktuellen Lebenswirklichkeit, Kulturtradition und allgemeinem, wie religionswissenschaftlichem Verständnis, ergeben kann.454 Diese Anknüpfungspunkte machen deutlich, dass die Einschätzung, ob eine Vereinigung als Religionsgemeinschaft anzusehen ist, einer stetigen Entwicklung unterliegt. Das BVerfG deutet somit ein weites Verständnis des erforderlichen religiösen Konsenses an. Das ist nur konsequent, schließlich unterfällt diese Einschätzung in erster Linie der Vereinigung selbst. Der Staat ist in seiner Kontrolle aufgrund des Neutralitätsgebots beschränkt.
Dennoch kann man selbst bei einem weiten Verständnis des religiösen Konsenses im Falle der katholischen Kirche und den evangelischen Kirchen nicht von einer Religionsgemeinschaft sprechen: Die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen eint das Apostolische Glaubensbekenntnis. Sie erkennen gegenseitig die Taufe an, divergieren jedoch hinsichtlich anderer wesentlicher und bekenntnisrelevanter Themen – allen voran das Verständnis von Eucharistie bzw. Abendmahl. Uneinigkeit besteht darüber hinaus hinsichtlich struktureller und organisatorischer Fragen, so insbesondere zur Rolle des Papstes. Auch die Tatsache, dass sie gemeinsam in der ACK organisiert sind, ändert hieran nichts. Religiöse Aufgaben der Mitgliedskirchen werden nicht in ausreichendem Maße übernommen. Die Aufgaben der ACK beschränken sich auf eine gemeinsame Interessenvertretung, dies reicht nach Ansicht des BVerwG nicht zur Einordnung als Religionsgemeinschaft aus.455 So können die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen aufgrund ihrer unterschiedlichen Organisation und Struktur nicht als „eine Religionsgemeinschaft“ im religionsverfassungsrechtlichen Sinne angesehen werden. Die christlichen Kirchen bilden eine Religion, sind aber unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zuzuordnen.