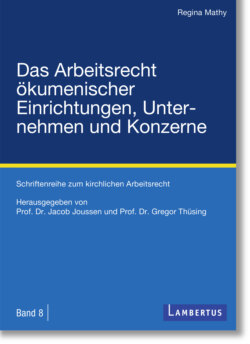Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 86
3. Innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes
ОглавлениеDie selbstständige Ordnung und Verwaltung eigener Angelegenheiten durch die Religionsgemeinschaften erfolgt innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Eine Beschränkung kann nur durch formelle Bundes- oder Landesgesetze erfolgen.488 Was indes konkret unter dem Schrankenvorbehalt zu verstehen ist, ist seit jeher umstritten.489 In der Weimarer Zeit legte man zunächst ein sehr wörtliches, rein formales Verständnis bei der Einordnung zu Grunde.490 Dieses Verständnis wurde jedoch dem Schutzgehalt des Art. 137 Abs. 3 WRV als Ausprägung der Religionsfreiheit nicht gerecht.491 Rechtsprechung und Literatur vertraten in der Folge lange Zeit die sog. Heckel´sche Formel.492 Hiernach ist ein für alle geltendes Gesetz „(…) ein Gesetz, das trotz grundsätzlicher Bejahung der kirchlichen Autonomie vom Standpunkt der Gesamtnation als notwendige Schranke der kirchlichen Freiheit anerkannt werden muss (…)“.493 Unklar war allerdings, was unter einem für die Gesamtnation „notwendigen“ Gesetz zu verstehen ist.494 Zwischenzeitlich nahm das BVerfG die Einordnung anhand einer Differenzierung zwischen innerkirchlichem und weltlichem Bereich vor (Bereichslehre).495 Sobald die innerkirchliche Sphäre betroffen ist, greift der Schrankenvorbehalt nicht; dieser Bereich ist staatlicher Einflussnahme vollständig entzogen. Für den Außenbereich greift der Schrankenvorbehalt nur soweit die Kirchen wie jeder andere auch betroffen sind.496 Dabei ist die eigens vom BVerfG entwickelte „Jedermann-Formel“ zugrunde zu legen.497 Somit ist jedes gegen die Religionsgemeinschaften gerichtete Sonderrecht unzulässig.498 Die Differenzierung zwischen religionsgemeinschaftlichem Innen- und Außenbereich ist im Gesetz jedoch nicht angelegt. Zudem ist eine trennscharfe Abgrenzung beider Bereiche nicht möglich.499 Insofern bringt auch diese Formel nicht die notwendige Klarheit.
Sowohl das BVerfG500 als auch die Literatur501 wenden daher in jüngerer Zeit die sog. Wechselwirkungs- bzw. Abwägungslehre an. Hiernach gilt der Schrankenvorbehalt dem Grunde nach für alle religionsgemeinschaftlichen Angelegenheiten.502 Die Schrankenbestimmung kann nicht anhand einer Formel erfolgen, vielmehr gilt es mittels einer Abwägung der sich gegenüberstehenden Grundrechtspositionen einen angemessenen Ausgleich anhand des Einzelfalls zu finden.503 Dabei steht das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften den kollidierenden Rechten Dritter bzw. anderen Verfassungsgütern gegenüber.504 Besonders zu berücksichtigen ist das Selbstverständnis der Religionsgemeinschaften.505
Gezielte Beeinträchtigungen des Selbstbestimmungsrechts durch staatliches Sonderrecht dürften nicht zu rechtfertigen sein.506 Wählen die Religionsgemeinschaften jedoch eine staatliche Ausgestaltungsform, wie beispielsweise den Status der K.ö.R. mit der ihnen damit zustehenden Dienstherrenfähigkeit oder das Privatrecht als Grundlage ihrer Arbeitsverhältnisse, müssen sie sich auch an die Grenzen staatlichen Rechts halten.507