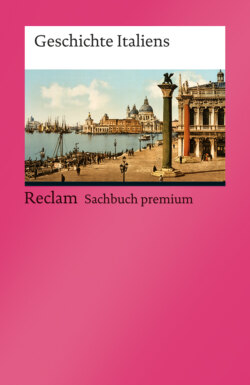Читать книгу Geschichte Italiens - Wolfgang Altgeld - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[88]Der fünfte Kreuzzug
ОглавлениеUnmittelbar nach der (2.) Krönung in Aachen im Juli 1215 hatte Friedrich II. das Kreuz genommen; wohl weniger in der Hochstimmung des Krönungsfestes, wie vermutet wurde, als um nach dem Vorbild seines Vaters und Großvaters den kaiserlichen Anspruch auf die führende Rolle in der Christenheit zu behaupten. Das päpstliche Unternehmen von 1204 war zwar blamabel gescheitert, aber das bevorstehende Laterankonzil sollte sich erneut mit dieser Frage befassen und die weltlichen Mächte wiederum in den Hintergrund drängen.
Freilich führte die Selbstbindung Friedrichs zum ersten großen Konflikt mit dem Papsttum. Honorius III. drängte auf die Einlösung des Versprechens, musste aber auch zugestehen, dass die Ordnung der Verhältnisse in Sizilien zunächst vordringlich war. 1225 verpflichtete sich der Kaiser vertraglich, bis spätestens August 1227 tatsächlich aufzubrechen, andernfalls der Papst das Recht haben sollte, ihn zu exkommunizieren. Hinter dieser energischeren Haltung stand wohl schon der Kardinalbischof Hugolin von Ostia, der Honorius am 19. März 1227 als Gregor IX. auf dem Papstthron folgte. Gregor hatte keine Skrupel, den Vertrag im strengsten Sinne auszulegen: Friedrich stach zwar fristgemäß von Brindisi aus in See, musste aber nach wenigen Tagen umkehren, weil im Kreuzfahrerheer Seuchen ausbrachen, an denen ein Fürst starb und der Kaiser selbst erkrankte. Formal war damit der Vertrag gebrochen. Der Papst verhängte sofort die Exkommunikation, ohne die (in der Sache berechtigte) Entschuldigung des Kaisers anzunehmen. Auch wenn die zeitgenössischen Auffassungen [89]von Schuld und Vorsatz andere waren als heute, ist doch der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass Gregor die Gelegenheit nur allzu gern ergriff, um Friedrich politisch zu erpressen: In den anschließenden Verhandlungen stellte er Forderungen, die mit dem Kreuzzug nichts zu tun hatten und die Lossprechung absichtlich immer weiter hinausschoben.
Schließlich brach Friedrich Ende Juni 1228, ohne das Ende der Verhandlungen abzuwarten, als Gebannter erneut ins Heilige Land auf, wo er im September eintraf. Quasi zur Vorbereitung hatte er 1225 Isabella von Brienne, die Erbin des Königreichs Jerusalem, geheiratet, die allerdings 1228 bei der Geburt Konrads IV. starb; aus dieser Ehe leitete der Kaiser (im Grunde unrechtmäßig) für sich den Titel »König von Jerusalem« ab. Der Kreuzzug war ferner diplomatisch durch Verhandlungen mit Sultan al-Kamil vorbereitet. Deshalb gelang es Friedrich, für die Christen auf dem Verhandlungswege die Rückgabe Jerusalems zu erreichen, wo er am 18. März 1229 in der Grabeskirche die Krone trug. (Es handelte sich um ein bloßes Kronetragen; die frühere These einer Selbstkrönung ist von der Forschung widerlegt.)
Inzwischen versuchte der Papst, das Königreich Sizilien militärisch zu besetzen und die Bewohner zur Rebellion aufzustacheln. Der Versuch scheiterte aber kläglich, als Friedrich am 10. Juni 1229 wieder in Brindisi eintraf. Schließlich wurde unter Vermittlung der deutschen Fürsten im Juli 1230 eine formale Aussöhnung zwischen Kaiser und Papst erreicht, ohne dass die tieferen Ursachen des Konflikts beseitigt wurden.