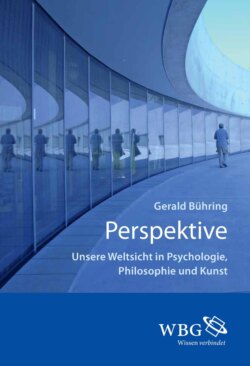Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 12
4.1 Zentralperspektive
ОглавлениеLeon Battista Alberti empfahl den Malern, die spitze Sehpyramide an einer bestimmten Stelle zu durchschneiden und die Schnittfläche als Malgrund für ihre Zeichnungen nach der Natur zu verwenden, weshalb er die Schnittfläche auch mit einem Gemälde verglich. »Daher wird ein Gemälde nichts anderes sein als die Schnittfläche durch die Sehpyramide, die gemäß einem vorgegebenen Abstand, einem festgelegten Zentralstrahl und mit bestimmter Beleuchtung auf einer gegebenen Fläche mit Linien und Farben kunstgerecht dargestellt ist« (Alberti 2010, S. 85). Man kann sich die Schnittfläche auch als »durchsichtige Glasscheibe« vorstellen, durch welche der Maler auf sein Motiv blickt. An der Spitze der Sehpyramide (Augenpunkt) stehend schaut er wie durch ein offenes Fenster entlang des Zentralstrahls und der konvergierenden Sehstrahlen auf den Fluchtpunkt am Horizont. Sein Standpunkt bestimmt somit die Perspektive (Ausschnitt, Größe, Lage, Farbgebung etc.), unter der er seinen Gegenstand proportional abbilden möchte.
Weil alles mit geometrisch rechten Dingen zugeht, spricht man auch von einer »linearperspektivischen Konstruktion« oder einfach von der »Linearperspektive«, wiewohl Alberti diese Begriffe an keiner Stelle seines Traktates erwähnt. Persönlich bevorzuge ich den Begriff »Zentralperspektive«, weil er das im Augenpunkt zentrierte Strahlenbündel akzentuiert (Abb. 11).
Abb. 11: Zentralperspektivische Konstruktion
Um den Künstlern ihre Konstruktionen zu erleichtern, empfahl er ihnen das – angeblich von ihm erfundene – »Velum«, obwohl es schon von Brunelleschi verwendet wurde. Dabei handelt es sich um Folgendes: »Es ist ein hauchdünnes Tuch aus losem Gewebe, nach Belieben gefärbt, und mit etwas dickeren Fäden in eine beliebige Anzahl von Parallelen unterteilt. Dieses Velum stelle ich zwischen das Auge und den gesehenen Gegenstand, und zwar so, dass die Sehpyramide das lose Gewebe des Tuches durchdringt« (ebd. S. 115). Tatsächlich scheint dieses Hilfsmittel große Bedeutung erlangt zu haben; denn Vasari vergleicht die Erfindung des Velums mit der des Buchdrucks. »Im Jahr 1457 als der deutsche Johannes Gutenberg die äußerst nützliche Buchdruckerkunst erfand, wurde von Leon Battista etwas Ähnliches entdeckt, wie nämlich mittels eines Instruments natürliche Perspektiven darzustellen und die Figuren zu verkleinern seien, wie gleicherweise kleine Dinge in eine größere Form zu bringen und zu vergrößern seien: alles ausgeklügelte Dinge, der Kunst nützlich und wirklich schön« (Alberti 2010, S. 17).
Der lateinische Begriff Velum oder Velo bedeutet soviel wie Segel, Hülle, Vorhang, Tuch, Umhang etc. In diesem Sinne wurde er auch von Alberti verwendet. Nachdem man jedoch das durchsichtige Tuch durch ein gröberes Fadengitter ersetzt hatte, kommt ihm wohl eher diese Bedeutung bzw. der eines Quadratnetzes zu. Über die Verbreitung des Velums in Europa bis ins 17. Jahrhundert berichtet vor allem Kim H. Veltman in seinem Buch »Linear Perspective and the Visual Dimensions of Science and Art«(1986).
Leider überliefert uns Alberti keine Illustration seines nützlichen Velums, sodass wir auf andere Autoren zurückgreifen müssen. Einschlägige Abbildungen finden sich bei Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Während da Vinci jedoch nur einfache Skizzen präsentiert, enthält Dürers »Dresdener Skizzenblock« (1514) und »Underweysung der messung mit dem zirckel un richtscheyt, in linien, ebenen un gantzen corporen« (1538) sehr genaue Zeichnungen.
Abb. 12: Visiervorrichtung Albrecht Dürers, 1538
Eine besonders anschauliche Vorstellung vermittelt die abgebildete mittelalterliche Visiervorrichtung (Abb. 12). Der Ring an der Wand entspricht dem Augenpunkt. Zwischen Ring und Gegenstand (Laute) steht ein Quadratnetz, durch welche eine von einem Senkblei straff gehaltene Schnur (Sehlinie) gezogen ist. Die ganze Arbeit des Künstlers besteht nun darin, die abgetasteten Mess- bzw. Blickpunkte so genau wie möglich auf ein (hier zurückgeklapptes) Blatt Papier zu übertragen (vgl. Pelzer 1908, S. 182).
Wenngleich Leonardo da Vinci vom Velum überzeugt war, warnte er doch vor dessen mechanischem Gebrauch. »Aber dies sei für diejenigen angemerkt, welche die Fantasie für die Wirkung der Natur einsetzen und nur deshalb solche Methoden verwenden, um sich irgendeine Mühe zu ersparen und irgendein Detail wegzulassen, bei der genauen Nachahmung der Dinge, welche sie beim Kopieren mit dem Verfahren benötigen. Aber solch eine Erfindung ist bei jenen abzulehnen, die weder zeichnen können noch ihre Genialität (ingegno) auszudrücken wissen, weil sie mit solcherart Bequemlichkeit ihre eigene Genialität zerstören, niemals wissend wie sie etwas wirklich Gutes ohne solch eine Krücke produzieren können. Und diese sind immer schwach in ihren Leistungen und wünschen bei all ihren Erfindungen oder Kompositionen von Gewandtheit (istoria), welche doch der Zweck solch einer Wissenschaft ist, wie an angemessenem Ort dargelegt wurde« (l. c. Veltman 1986, S. 109).
Mit einfachen Mitteln kann man eine Art Velum selbst herstellen. Es genügt eine Glasscheibe von beliebiger Größe. Man bringt die Scheibe in eine senkrechte Position und schaut einäugig hindurch. Gegebenenfalls eignet sich auch die Fensterscheibe. Auf die eine oder andere Scheibe zeichnet man mit einem Filzstift die Konturen dessen nach, was man sieht. Fertig ist das Bild.
Einige Varianten der Zentralperspektive ergeben sich durch Schrägprojektion oder Hinzufügung weiterer Fluchtpunkte. Aus Ersterer folgt die »Kavalierperspektive« bzw. »Militärperspektive«, aus Letzterer die »Über-Eck-Perspektive« bzw. »Vogel- und Froschperspektive« (Abb. 13–15, Farbtafel).