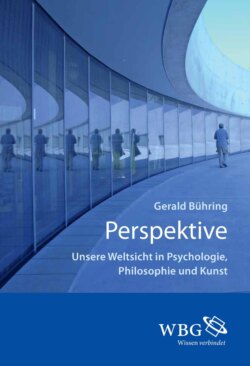Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 23
Angeboren oder erworben?
ОглавлениеUnter Psychologen und Physiologen häufig und heftig diskutiert wird auch die Frage, ob Raumtiefe und Perspektive angeboren oder erworben sind. In seinem »Handbuch der physiologischen Optik« von 1867 schildert Hermann von Helmholtz (1821–1894) zum Beispiel hierzu folgendes Kindheitserlebnis: Er entsinne sich, mit seiner Mutter an der Potsdamer Garnisonkirche vorübergegangen zu sein. Menschen auf der Galerie habe er für Püppchen gehalten. Er habe seine Mutter gebeten, diese herunterzuholen. Aufgrund dieses kindlichen Irrtums behauptete von Helmholtz später, dass die Beziehung zwischen Größe und Entfernung durch Erfahrung gelernt wird und nennt es das »Gesetz der perspektivischen Verkleinerung«. Heute spricht man von »Größenkonstanz«. Leider enthält seine Kindheitserinnerung keine Altersangabe. Anhand von psychologischen Untersuchungen ist von Helmholzens Erinnerung, jedoch vor dem sechsten Lebensjahr zu datieren. Franz Beyrl verglich nämlich die Größenauffassung von Kindern vom dritten bis zum zehnten Lebensjahr und von Erwachsenen anhand von Kreisscheiben und stellte fest, dass sich erst nach dem siebenten Lebensjahr einigermaßen zuverlässige und bei Erwachsenen ziemlich genaue Konstanzen bei ihren Beurteilungen der objektiven Größe ergaben (vgl. Beyrl 1926, S. 367).
Nach William Stern ist die Eroberung des Raumes bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres abgeschlossen. Das heißt: »Das Kind kann die räumlichen Merkmale der Dinge: ihre Lage, Form und Größe auffassen und sich richtig auf sie einstellen« (Stern 1909, S. 417). Dieser Lernprozess erfolgt nach dem »Zwei-Wege-Prinzip«, indem optische Eindrücke mit taktilen Empfindungen assoziiert werden. »Durch fortwährende Wiederholung dieser Doppeleindrücke stiftet das Kind optisch-taktile Assoziationen, es lernt, dass die Dinge, die rund oder eckig, schmal oder breit aussehen, sich zugleich kugelig oder kantig, dick oder dünn anfassen – so sind denn diese Zuordnungen zwischen optischer und taktiler Raumform zweifellos erworbene« (ebd. S. 414). Vom Schauen zum Darstellen der Perspektive vergehen jedoch viele weitere Jahre. Denn neben dem optischen Raumgefühl müssen noch operative bzw. logische Denkstrukturen zur Reife gelangen. Dazu sind erst sechs- bis siebenjährige Kinder in der Lage. Falls es jedoch an intellektuellen Kapazitäten und pädagogischen Anregungen mangelt, kann diese mentale Fähigkeit auch noch später erworben werden. Schließlich haben kulturelle Gründe einen erheblichen Einfluss. Zum Beispiel sahen und sehen Chinesen und mittelalterliche Christen keine Verbindung zwischen dem zentralen Sehstrahl und der bildlichen Darstellung, desgleichen die alten Araber, obschon sich diese jahrhundertelang mit Fragen der klassischen Optik beschäftigt hatten (vgl. Edgerton 2002, S. 11/147). Auch Stern weist darauf hin, dass sich Kinder bereits im Frühstadium ihrer logischen, symbolischen und abstrahierenden Entwicklung an perspektivische Darstellungen gewöhnen; »enthalten doch schon die primitivsten Kleinkinder-Bilderbücher diese Merkmale. Da hier dem Kind alle abgebildeten Gegenstände mit den bekannten Ausdrücken benannt werden, wird das Kind darin geübt, sie trotz jener Verschiedenheit zu identifizieren. Es liegt hier also eine durch bestimmte Umweltbedingungen hervorgerufene Verfrühung der Entwicklung vor; Kinder eines anderen Kulturkreises, der – wie etwa der mohammedanische – hauptsächlich nur Flächenkunst kennt, werden wohl erst sehr viel später zum Erkennen perspektivischer Darstellungen gelangen« (Stern 1987, S. 165). Perspektivische Anregungen erhalten die Kinder zudem von Wandgemälden. So ist es kein Wunder, dass die Mehrzahl der Kinder nicht durch direkte Beobachtung der Natur zu perspektivischen Darstellungen gelangt, sondern durch ubiquitär vorhandene Bildvorlagen. Wenn allerdings keine darüber hinausgehende Unterweisung erfolgt, bleiben die meisten von ihnen auf der Stufe der unvollendeten perspektivischen Darstellung.
Fachmännische Anleitung könnten die Kinder in der Schule bekommen. Doch damit stand es zu meinen Zeiten schlecht. Zeichnen bzw. bildende Kunst galt als absolutes Nebenfach. Obschon für die Schulung des optischen Sinnes und der feinmotorischen Handfertigkeiten von großer Bedeutung wurde der ein- bis zweistündiger Zeichenunterricht erst ab der 6. Klasse erteilt (Abb. 20). Auch kann ich mich keiner perspektivischen Anleitung erinnern.
Welche zeichnerischen Fortschritte schon ein paar sachdienliche Hinweise erbringen können, demonstrierte ein Münchner Lehrer einer dritten Jungenklasse. Dieser gescheite Pädagoge ließ seine Schüler aus dem Gedächtnis vier Tiere zeichnen, führte anhand von Abbildungen eine eingehende Formbesprechung durch und forderte dann eine zweite Zeichenprobe ein. »Waren vorher 33 Zeichnungen in der Stufe« der schematischen Darstellung, »9 in der Stufe des eigentlichen Pferdeschemas und nur 1 in die zweite Stufe einzureihen «‚Stufe des beginnenden Linien- und Formgefühls, so ergaben sich nach der Besprechung 23 Zeichnungen für die erste, 17 für die zweite, 3 für die dritte Gruppe. Nur die Zahl der erscheinungsgemäßen Darstellungen hatte sich nicht vermehrt, was vollständig begreiflich ist, da die Darstellungen dieser Stufe nicht bloß ganz klare Formvorstellung, sondern auch entsprechende Zeichenfertigkeit verlangen, zwei Forderungen, die bei dem Alter der Schüler der dritten Klasse im allgemeinen überhaupt noch nicht erfüllt sind« (Kerschensteiner 1905, S. 110).
Abb. 20: Zeichnung eines 12-jährigen Hauptschülers