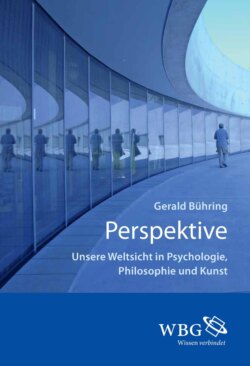Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 17
5.1 Phylogenetische Betrachtungen Der Funke des Bewusstseins
ОглавлениеDer Funke des Bewusstseins erhellte sehr spät das Cerebrum des Homo sapiens. Friedrich Nietzsche (1844–1900) zufolge sei das nicht unbedingt ein Vorteil gewesen, weil er dadurch seine Instinktsicherheit eingebüßt und es als Mittel zur Machterweiterung missbraucht habe. Andererseits befand er sich in der glücklichen Lage, nicht nur seine Bedürfnisse befriedigende Umwelt wahrzunehmen, sondern er sah sich sie auch sehen. Das war der erste Perspektivwechsel in der Geschichte der Menschheit. Wie kam es zu diesem plötzlichen »Selbstbewusstsein?« Keiner weiß es genau! Und so ranken sich noch heute viele Theorien um dieses Wunder der Natur.
Die Pragmatisten William James (1842–1910), James Mark Baldwin (1861–1934), Henri Bergson (1859–1941) und John Dewey (1859–1952) zum Beispiel behaupten: Bewusstsein ist eine Reaktion auf störungsanfällige Lebensabläufe. Wer etwa blindlings gegen einen Baum rennt, wird sich dieser Störung unmittelbar bewusst. Um zukünftig solche gefährlichen Begegnungen zu vermeiden, hemmt er das nächste Mal seinen Lauf und schaltet seine Fernsinne ein. Was besagt, dass er die berührungsintensive Reaktion vorwegnimmt, weil er gelernt hat, dass bewusste Handlungen ungefährlicher sind als automatisierte Reaktionen. Auch sonstige Erfolge können verstärkend ins Bewusstsein treten. Wenn unsere prähistorischen Vorfahren zum Beispiel ergiebige Jagdgründe entdeckten, so werden sie sich diese absichtlich eingeprägt haben. Absicht unterstellt auch Seneca (3–65 n. d. Zr.) dem menschlichen Geist. Für den römischen Stoiker begann alles mit der intentio, welche den Geist des Menschen aktiviert habe. Später postulieren dann Franz Brentano (1838–1917) und Edmund Husserl (1859–1938) eine Intentionalität des Bewusstseins. Sie sind der Ansicht, dass wir kein Bewusstsein an sich haben, sondern ein Bewusstsein von Etwas, auf das unser Augenmerk gerichtet ist. Bewusstsein ist somit weltoffen und dinglich orientiert. Trotzdem ist es begrenzt. Weswegen man auch von der Enge des Bewusstseins spricht. Nur einen einzigen Inhalt können wir erfassen und manchmal übersehen wir schon das Nächstliegende.
Arnold Gehlen (1904–1976) geht anthropologisch noch einen Schritt weiter. Er kombiniert die pragmatische Theorie vom gehemmten Lebensprozess mit der Theorie der »Sinneswahrnehmung als Entlastung«. »Das eigentliche Mittel, das die Intelligenz brauchte, um aus der direkten Reizung die Wahrnehmung zu entwickeln, war die Sensibilisierung des Lebewesens gegenüber Reizungen von immer geringerem Affektwert, eine Sensibilisierung, die nicht mehr einer aggressiven Einwirkung, sondern ihrer zunehmend entfernten Drohung entspricht … Die Fernwahrnehmung … entlastet also den Organismus von der unmittelbaren, approximativ schmerzhaften Berührung« (Gehlen 1986, S. 69).