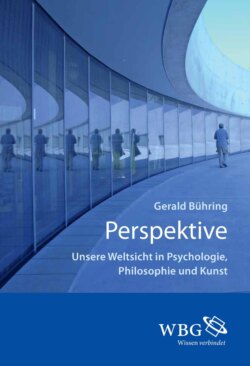Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 25
Entwicklungsstadien der perspektivischen Anschauung
ОглавлениеVertieft wurde Kerschensteiners pädagogische Studie über die Entwicklung der zeichnerischen Begabung durch psychologische Beobachtungen von William Stern (1871–1938), David Katz (1884–1953), Jean Piaget und andere. Hinsichtlich seiner drei Kinder (Hilde, Günther und Eva) stellte Stern fest, dass diese im Alter vom 1;1 bzw. 2;0 perspektivisch gezeichnete Figuren erkannt hätten, aber nicht in der Lage gewesen seien, diese nachzuzeichnen (vgl. Stern 1987, S. 164). Katz zufolge wird diese Fertigkeit erst von Siebenjährigen erworben, denn seine drei weiblichen Versuchspersonen, im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren, zeichneten verschiedene Gegenstände unter völliger Vernachlässigung der Perspektive (vgl. Katz 1906, S. 242). Noch später gelingt die Perspektive in der Vorstellung. Piaget unterzog alle drei Modalitäten einer systematischen Untersuchung, also: erkennen perspektivisch gezeichneter Figuren, nachzeichnen einer perspektivischen Vorlage, spontane Perspektivzeichnungen. Am Ende ließen sich drei Entwicklungsstadien unterscheiden:
1. Stadium: Bis zum 4. Lj. sind keine adäquaten Abzeichnungen von geometrischen Figuren zu erhalten. Dem Kind fehlt jedes Verständnis einer vorgestellten Perspektive.
2. Stadium: Vom 4. bis zum 5. Lj. (Teilstadium A) fehlt noch jegliche Differenzierung der möglichen Blickwinkel. Bei dem untersuchten fünfjährigen »An« zum Beispiel hat die Konstanz der Form den Vorrang vor der Perspektive. Im Teilstadium B (5.–7. Lj.) erste Unterscheidung der Blickwinkel. »Interessanterweise kommt diese beginnende Differenzierung mehr bei der Wahl zwischen den fertigen Zeichnungen zum Ausdruck als bei den vom Kind selbst angefertigten Zeichnungen« (Piaget 1975, S. 220).
3. Stadium: Während der Zeit vom 7. bis zum 9. Lj. lässt sich eine deutliche Differenzierung der Blickwinkel feststellen, zunächst nur die Form, nicht die Ausdehnung des Gegenstandes betreffend. Doch mit dem 9. Lj. tritt die Perspektive in den Zeichnungen der Kinder spontan auf. Formveränderungen und quantitative Transformationen werden beim Zeichnen korrekt dargestellt.
Um Körper im Raum und ihre Lage zueinander korrekt zeichnen zu können, benötigt das Kind sehr genaue perspektivische Vorstellungen. Empirisch untersuchen lässt sich diese kognitive Fähigkeit mittels einer von Piagets konzipierten Versuchsanordnung: Der kindlichen Versuchsperson (Vp) werden drei Berge aus Pappmaché – unterschieden nach Form, Farbe und Markierung – präsentiert (Abb. 21). Anschließend wird sie dahingehend instruiert, von einem Standpunkt A aus, den Positionswechsel einer kleinen Holzpuppe von A→B→C→D zu verfolgen und deren jeweilige Perspektive auf die Berge herauszufinden. Ihre Beobachtung fixiert die Vp entweder als Auswahl aus zehn verschiedenen Bergansichten oder als Nachbildung aus drei Pappstücken.
Nach der Auswertung der Versuchsprotokolle kam Jean Piaget zu folgenden Ergebnissen: »Während des gesamten Stadiums II wird der Blickwinkel der Vp überhaupt nicht oder nur mangelhaft von dem der übrigen Beobachter (die von der Puppe an ihren verschiedenen Standorten dargestellt werden) differenziert … In Wirklichkeit bringt das Kind (im Teilstadium A, G.B.) seine eigene Perspektive zum Ausdruck, so als könnten die Berge überhaupt nur unter seinem Blickwinkel gesehen werden.
Abb. 21: Die drei Berge
Während eines Teilstadiums II B versucht das Kind zu differenzieren, fällt aber in die egozentrische Konstruktion (die der Stufe II A) zurück« (ebd. S. 253). Das Kind nimmt an, dass die verwendeten Puppen, die drei Berge von überallher, also unabhängig von jeglicher Perspektive, sehen können. Die Vp »scheint zu glauben, ihr Blickwinkel sei der einzig mögliche« (S. 254). Es handelt sich sozusagen um eine »egozentrische Täuschung«, demzufolge das Kind noch nicht in der Lage ist, die Beziehungen rechts-links und vornhinten umzudrehen (vgl. S. 259). »Wenn man das Kind mittels fertiger Bilder befragt, ist die egozentrische Täuschung oder Zentrierung der Vorstellung der Perspektive auf den eigenen Blickwinkel … ebenso deutlich, wie wenn man das Kind mittels dreier Pappstücke eine beliebige Perspektive nachbilden läßt« (S. 261). Das Kind »kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, ein Standort könne limitativ sein, das heißt, einer einzigen Perspektive entsprechen; das Kind glaubt nämlich von seinem eigenen Standort aus das gesamte Massiv so zu sehen, wie es in Wirklichkeit ist, das heißt auf eine Art, die allen möglichen Perspektiven gemeinsam ist« (S. 264). Den Grund für diese Selbsttäuschung sah Maurice Merleau-Ponty darin, dass das Kind »in einer Welt lebt, die es in eins allen es Umgebenden zugänglich glaubt. Es hat weder von sich noch von den Anderen ein Bewußtsein als privaten Subjektivitäten. Es ahnt nichts davon, dass es selbst und wir alle begrenzt sind auf einen gewissen Gesichtspunkt der Welt gegenüber. Daher unterwirft es weder seine Gedanken … noch unsere Worte irgendeiner Kritik. Das Wissen von Gesichtspunkten geht ihm ab … Die Anderen sind für das Kind lediglich Blicke, die die Dinge inspizieren, und haben als solche fast materielle Existenz, sodass ein Kind sich zu fragen vermag, wie Blicke, die sich kreuzen, nicht einander brechen« (Merleau-Ponty 1974, S. 406).
Etwa zum Ende des dritten Stadiums im Alter von etwa 7 bis 12 Jahren, erfolgt eine wachsende Differenzierung und Koordinierung der Perspektiven. »Erst dann, wenn die Vp die Perspektiven anderer Personen von ihrem eigenen Blickwinkel differenziert, wird sie sich also dieses Blickwinkels als eines besonderen bewußt und charakterisiert ihn durch spezifisch projektive Relationen (explizit zum Ausdruck gebrachte Perspektive)« (Piaget 1975, S. 262). Das Kind hat sozusagen das rationale »Perspektivstadium« erreicht.