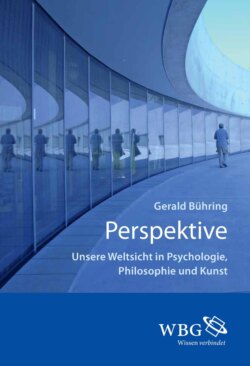Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 24
Die zeichnerische Begabung des Kindes
ОглавлениеKinder machen sich keine Gedanken über den »visuellen Realismus« der Erwachsenen. Sie haben noch keinen Sinn für Verkürzungen, Verzerrungen und einen zentralen Standort. Kinderzeichnungen können Vorder-, Drauf-, Seiten-, Innen- und Außenansicht gleichzeitig enthalten. Sachdienlichen Hinweisen begegnen sie mit Verständnislosigkeit. Denn sie zeichnen nicht, was sie sehen, sondern, was sie von den Dingen ihrer Umgebung wissen. Sie interessieren sich nur für das Ding an sich. Je nach zeichnerischer Begabung können Kinder bis zum achten Lebensjahr noch auf Henri Luquets (1876–1965) Stufe des »intellektuellen Realismus« respektive Georg Kerschensteiners (1854–1932) erster »Stufe der schematischen Darstellung« verbleiben. Deshalb stellte sich Kerschensteiner die Frage: »Wie entwickelt sich die graphische Ausdrucksfähigkeit des unbeeinflussten Kindes vom primitiven Schema zur vollendeten Raumdarstellung?« (Kerschensteiner 1905, S. 7). Zu diesem Zweck sammelte er von 58.000 Münchner Schülerinnen und Schülern der ersten bis achten Klassen, vom 6. bis zum 14. Lebensjahr, über 300.000 Schülerzeichnungen, welche Gegenstände, Ornamente, Menschen und Tiere, teils aus dem Gedächtnis, teils nach der Natur darzustellen hatten. Die Auswertung des Materials ergab vier Entwicklungsstufen grafischen Ausdrucks:
Stufe der schematischen Darstellung: Es handelt sich hierbei um »begriffliche Niederschriften«, die umso mehr Details enthalten, je älter das Kind ist. Menschliche und vor allem tierische Formen betreffend zeichnen die Kinder noch bis zum elften Lebensjahr schematisch. Von Perspektive noch keine Spur.
Stufe des beginnenden Linien- und Formgefühls: Obschon die Jungen bereits mit sieben und die Mädchen mit neun Jahren perspektivisch sehen können, entwickeln erstere erst ab dem zehnten und letztere ab dem dreizehnten Lebensjahr ein Gefühl für perspektivischen Ausdruck. Ihren schematisch dargestellten Figuren fehlen Individualität und Pose. Merkwürdigerweise besteht ein starker Trend zu nach links gewendeten Tierkörpern.
Stufe der erscheinungsmäßigen Darstellung: Mit etwa neun bis zehn Jahren verfügen Kinder an sich über klare Formvorstellungen, verbleiben jedoch bei ihren Umrisszeichnungen. Für realistische Darstellungen fehlt ihnen noch die nötige Zeichenfertigkeit. Bei Fortgeschrittenen finden sich aber schon Ansätze zu einer differenzierten Gestaltung (Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Faltenwurf etc.).
Stufe der formgemäßen Darstellung: Erst ab dem elften Lebensjahr gelingt einem nennenswerten Prozentsatz von Schülern die räumliche Darstellung. Eine vollendete Raumdarstellung hingegen wird nur von 2 bis 3 % der Jungen vor dem 15. Lebensjahr und von Mädchen nur ausnahmsweise erreicht. Sie sind dann in der Lage, Körperformen durch adäquate Licht- und Schattenverteilung oder Oberflächenlinien zu runden und räumliche Strukturen durch Überschneidungen, Linien-, und Flächenverkürzungen darzustellen.
Kerschensteiner scheint die geringen zeichnerischen Fähigkeiten der Mädchen auf eine generelle Unreife der Auffassung zurückzuführen und verweist auf die geringe Anzahl weiblicher Künstler in unserer Kultur. Überdies erinnert seine Ansicht an den »physiologischen Schwachsinn des Weibes«, welchen der Neurologe Paul Julius Moebius (1853–1907) seinerzeit den Frauen andichtete. Tatsächlich aber erhielten die Schülerinnen der achten Klasse nur zwei, die Jungen hingegen sechs bis acht Stunden Zeichenunterricht.
In »Women Painters of the World« (1976) vom 15. bis 20. Jahrhundert findet man 51 anerkannte Malerinnen verzeichnet. Und das sind längst noch nicht alle! So fehlen zum Beispiel Constance Marie Charpentier (1767–1849), Paula Modersohn-Becker (1865–1943), Frida Kahlo (1907–1954) und viele andere. Nur wurden die meisten Künstlerinnen nicht so recht zur Kenntnis genommen, wie es scheint.
Beachtenswert ist auch dieses Ergebnis der Münchner Untersuchung: Die besten Leistungen stammen nicht von Kindern aus Künstlerfamilien (Malern, Bildhauern und Architekten) oder dem gebildeten Bürgertum, sondern meist von Kindern aus einfachen Verhältnissen (Arbeitern und Handwerkern). Wirklich talentierte Zeichner habe Kerschensteiner nur bei sechs Jungen gefunden. Ein Achtjähriger zum Beispiel zeichnete sehr realistische Pferde, zwei andere Jungen (13 und 14 Jahre) sogar Pferde in den unterschiedlichsten Posen. Ein weiteres Ergebnis bezieht sich auf Zeichnungen aus dem Gedächtnis und nach der Natur. »Es überragt also bei Kindern unter 15 Jahren die Zahl derjenigen, welche bildliche Raumdarstellung des Stuhles aus der Vorstellung heraus liefern um ein Bedeutendes die Zahl jener Kinder, denen bildliche Raumdarstellung der Geige nach der Natur gelingen, obwohl die rein zeichnerische Aufgabe im Falle der Stuhldarstellung schwieriger war als im Falle der Geigendarstellung« (ebd. S. 235). Bei einer anderen Aufgaben, dem Zeichnen von Straßenbahnen aus dem Gedächtnis, fiel zudem auf, dass die Mehrzahl der Schüler die Vogelperspektive gewählt hatte. Das habe nichts damit zu tun, dass sich Kinder dieses Verkehrsmittel vom Fenster her vorstellten, sondern damit, dass kistenartige Gegenstände generell von einem höheren Augenpunkt dargestellt würden, meint Kerschensteiner.
Erschien den sechs- bis vierzehnjährigen Schülern die »Körperperspektive« schon schwer genug, so noch mehr die »bildliche Raumdarstellung«. Nur wenigen gelang eine perspektivisch korrekte Zeichnung. Zudem stellte Georg Kerschensteiner fest, dass sich »die Begabung für ornamentale Verzierung von Flächen und Gegenständen sich im allgemeinen schon frühzeitig getrennt von der Begabung für Körper- und Raumdarstellung« zeigt (ebd. S. 487). Ähnlich verhalte es sich mit der »linearen Anordnung« von Gegenständen und Lebewesen im Raum. Diese Anordnung sieht er dadurch gekennzeichnet, dass sie längs einer geraden oder krummen Linie dargestellt werden. »Es scheint mir zweifellos, dass diese eigentlich linearen Darstellungen überhaupt keine bildliche Raumdarstellung beabsichtigen, weder beim Kinde noch in der Kunst des Kulturvolkes. Und so bildet diese Darstellungsart eine Kunst für sich, die ihre eigene Entwicklung geht von der primitiven Leistung des Steinzeitmenschen bis zur bewunderungswürdigen Höhe der griechischen Vasenkunst« (ebd. S. 308). Bei der nicht linearen Anordnung findet sich hingegen eine deutliche Abgrenzung zwischen Vorder- und Hintergrund. Es lassen sich auch hier vier Entwicklungsstufen unterscheiden. Der besseren Vergleichbarkeit wegen hatten die Schüler und Schülerinnen eine Schneeballschlacht darzustellen.
Stufe der Raumlosigkeit: Personen und Gegenstände werden völlig planlos neben- und übereinander angeordnet.
Stufe der misslungenen Raumdarstellung: Die Figuren werden von verschieden Standorten aus gemalt. Zudem fehlt den Figuren häufig die perspektivische Verkleinerung.
Stufe der richtigen, aber unvollendeten Raumdarstellung: »Charakterisiert ist diese Gruppe dadurch, dass sie bei ihren Darstellungen eine schmälere oder breitere Bodenfläche benützt, diese aber gegen den Hintergrund zu, also gegen den Horizont, meist durch eine feste Linie willkürlich abgrenzt« (ebd. S. 306).
Stufe der vollendeten Raumdarstellung: Das Bild ist von einem einzigen Standpunkt aus gezeichnet. Man findet Überschneidungen, Verkürzungen und Texturen sowie Farb-, Licht- und Schattenperspektive. Die Figuren sind perspektivisch korrekt gezeichnet.
Am Ende seiner Studie staunte Kerschensteiner über einige Ergebnisse, unter anderem darüber, dass talentierte Perspektivzeichner die große Ausnahme sind. »Höchste Kunst steht hier dicht neben ausgedehnter Unfähigkeit bei ein und derselben Gruppe von Altersgenossen« (ebd. S. 302). »Beim Vergleichen dieser höchsten Leistungen schulpflichtiger Kinder mit den primitiven raumlosen Arbeiten von Altersgenossen in der gleichen Klasse werden wir uns … bewusst, welche ungeheuren Begabungsdifferenzen in den Kindern gleicher Klassen verborgen sein können, über welche die heutige Schule mehr aus Ahnungslosigkeit als aus Rücksichtslosigkeit mit unheimlicher Gleichgültigkeit hinweggeht« (ebd. S. 316).
Bleibt abschließend noch anzumerken, dass man bei einer so geringen Anzahl von zeichnerisch begabten Schülern – sechs von 58.000 Schülern – davon ausgehen kann, dass wir die Entdeckung der Perspektive nur wenigen Künstlern zu verdanken haben.