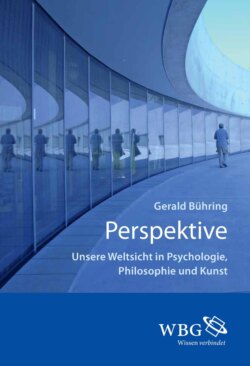Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 8
2.2 Die griechischen Kulissenmaler
ОглавлениеVon der steinzeitlichen Höhlenmalerei über die Tempelbilder der alten Ägypter bis zu den Anfängen der griechischen Vasenmalerei blieben die Künstler der zweidimensionalen Darstellung verhaftet. Selbst in späteren Zeiten, wie zum Beispiel in der islamischen und der fernöstlichen Kunst, änderte sich daran wenig. Insofern ist die Entdeckung der künstlerischen »Perspektive« ein selten zu nennendes Ereignis in der Geschichte der Menschheit.
In seinen Jugenderinnerungen schreibt der japanische Maler Yoshio Markino (1869–1956): »Was die Perspektive anlangt, habe ich eine Geschichte von meinem Vater zu erzählen. In meinem Lehrbuch des Zeichnens, das ich in der Mittelschule erhielt, war auch eine Zeichnung einer rechteckigen Schatulle in der korrekten Perspektive. Mein Vater sah sie und sagte: ‚Was soll das bedeuten? Diese Schatulle ist bestimmt nicht rechteckig. Sie scheint mir sehr windschief zu sein.‹ Ungefähr neun Jahre später blätterte er wieder in demselben Buch. Er rief mich zu sich und sagte: ›Ist es nicht merkwürdig? Du erinnerst dich sicher, dass ich der Ansicht war, diese rechteckige Schatulle sei schief, aber jetzt sehe ich, dass sie ganz richtig ist.‹ Dieses Beispiel zeigt, dass, wenn man die Gesetze der Natur nicht kennt, einem ganz richtige Dinge ganz falsch vorkommen« (Gombrich 1986, S. 295).
Verdient um diese großartige Entdeckung haben sich sowohl die archaischen Griechen als auch die Italiener der Renaissance gemacht. So findet man erstmals um 500 vor der Zeitrechnung (v. d. Zr.) auf griechischen Amphoren eine Darstellungsform, welche man als »Körperperspektive« bezeichnet, und zwar deshalb, weil die Dreidimensionalität der Figuren an den Körpergrenzen endet. Etwa 40 Jahre später erfolgte dann eine Erweiterung der Perspektive auf den gesamten Bildraum, allerdings von mehreren Standorten aus gesehen, weshalb Bernhard Schweitzer (1892–1966) richtig bemerkt: »Griechische Raumperspektive hält als Sukzessionsperspektive gewissermaßen die Mitte zwischen reiner Körperperspektive und rein optischer Perspektive« (Schweitzer 1953, S. 15).
Natürlich kannten die alten Hellenen noch nicht den neuzeitlichen Begriff der »Raumperspektive«, sondern lediglich seine künstlerische Umschreibung. Und zwar sprachen sie von »scenographia«, in der Bedeutung von perspektivisch-illusionärer Bühnenmalerei. Geknüpft wird dieser Begriff an eine verloren gegangene Abhandlung über die Grundzüge der Szenografie des griechischen Malers Agatharchos (ca. 480–420 v. d. Zr.). Dem römischen Architekten Vitruv (um 100 v. d. Zr.) zufolge soll diese Schrift Anweisungen enthalten haben, wie man räumliche Gebilde auf eine senkrechte Wand malen müsse, um den Eindruck einer zurück- und einer hervortretenden Fläche im Auge des Betrachters zu erzeugen.
Schon vorher hatten die griechischen Baumeister ihre Tempel nach dem Gesichtspunkt des wohlgefälligen Gesamteindrucks konstruiert, die man als »psychologische Perspektive« bezeichnen könnte. Es kam ihnen nicht so sehr auf horizontale und vertikale Fassaden, zylindrische Säulen und exakte Interkolumnien an, sondern auf augenfällige Proportionen ihrer Bauwerke. So fertigten sie die Ecksäulen ihrer Bauten dicker als die inneren Säulen, wodurch letztere schlanker wirkten, verstärkten die Säulenmitten, um sie verjüngt und nicht gebrochen erscheinen zu lassen (Entasis) und krümmten und verlängerten die horizontalen Elemente in den unteren und oberen Teilen der Gebäude. All dies vermittelt dem Betrachter den Eindruck einer wuchtigen, aber doch maßgerechten und ästhetisch ansprechenden Konstruktion. Beschrieben wurden sie von dem römischen Astronomen und Geometer Geminos von Rhodos (ca. 1. Jh. v. d. Zr.) (vgl. Mayer-Hillebrand 1942, Boehm 1969).
Wenn man eine dunkle Fläche vor einem hellen Grund oder eine helle Fläche vor einem dunklem Grund betrachtet, so erscheint erstere kleiner und letztere größer. Es handelt sich hierbei um eine optische Täuschung, welche als »Irradiation« oder Überstrahlungbezeichnet wird.
Gegen diese neuartige »Effekthascherei« der Bühnenmaler wendete sich Platon (427–347 v. d. Zr.) und entwertete deren Kunstwerke in seiner sogenannten Mimesis-Theorie kurzerhand als »malerische Scheinbilder«. Dichter und Maler, welche sich dieser illusionären Kunst bedienten, seien unwahrhaftig, im Zwiespalt mit sich selbst und ließen es an Vernunft fehlen. In seinem dialogisierten Hauptwerk »Der Staat« (602) heißt es deshalb:
»Höre! Ein Gegenstand erscheint uns nicht gleich groß, wenn wir ihn in der Nähe und wenn wir ihn in der Ferne sehen.«
»Nein.«
»Und er scheint uns gerade, wenn wir ihn außer dem Wasser, und gekrümmt, wenn wir ihn im Wasser sehen. Ebenso erscheint er uns bald hohl, bald erhaben, weil unsere Augen sich durch die Färbung irreführen lassen. Wir sind vielen solcher Sinnestäuschungen ausgesetzt, und die Kunst der Schattenrisse, ebenso die Taschenspielerkunst und viele ähnliche Künste machen sich diese Schwäche unserer Natur zunutze und lassen es an Betrug nicht fehlen.« «Das ist wahr.«
Ähnlich kritisch äußert sich Platon im »Sophistes« (235e–236a) über die Nachahmungskunst, zwischen Abbild (eikastiké) und Scheinbild (phantastiké) unterscheidend:
»Die eine, die ich in ihr sehe, ist die abbildende Kunst. Sie besteht vor allem darin, dass man die Nachbildung nach den Maßen des Vorbildes, seiner Länge, Breite und Tiefe entsprechend, herstellt und zu diesen noch die jeweils passenden Farben hinzugibt.«
»Wie? Bemühen sich nicht alle, die etwas nachahmen, dies zu tun?«
»Nein, wenigstens die nicht, die ein Werk von großen Ausmaßen schaffen, sei es in der Plastik oder in der Malerei. Denn wenn sie das wahre Ebenmaß der schönen Vorbilder wiedergeben wollten, so würden, wie du weißt, die oberen Partien zu klein, die unteren zu groß erscheinen, weil wir die einen aus größerer Entfernung, die anderen aus der Nähe sehen.«
Gottfried Boehm (∗1942) schließt aus Platons Ausführungen über Sein und Schein auf eine eher marginale Bedeutung der szenografischen Kunst im antiken Griechenland. Zutreffen mag dies für die Philosophen, nicht jedoch für die kunstsinnigen Kreise. Denn zumindest die Körperperspektive fand bei ihnen große Beachtung und wurde ständig weiterentwickelt.
Letztere Ansicht ermöglicht uns einen fließenden Übergang zu den Bedingungen und Motiven, welche die Entdeckung der Körper- und Raumperspektive ermöglichten. Entsprechend unserer perspektivischen Sichtweise können wir gleich mehrere Antworten erwarten. Zu allen Zeiten scheint ja die Skulptur einen hohen künstlerischen Wert in der Geschichte der Menschheit gehabt zu haben, vor allem bei den Griechen. Fast alle ihre großen Kunstwerke stellen menschliche oder tierische Figuren dar, denen sowohl ein Streben nach idealen als auch nach individuellen Formen innewohnt. Eines der ersten charakterisierenden Porträts scheint die Büste des Feldherren und Gesetzgebers Perikles (ca. 500–429 v. d. Zr.) von dem kydonischen Bildhauer Kresilas (ca. 500 v. d. Zr.) gewesen zu sein. So wäre es denn nur eine künstlerische Weiterentwicklung, die allerdings ziemlich lange auf sich warten ließ, wenn die Künstler von der zwei- zur dreidimensionalen Darstellung ihrer Malereien fortschritten.
Plinius dem Älteren (23–79 n. d. Zr.) zufolge soll bereits Zeuxis von Herakleia (um 400 v. d. Zr.) illusionistisch gemalt haben. Er berichtet unter anderem von einem großen Wandgemälde, auf dem Weintrauben so täuschend echt abgebildet waren, dass Vögel danach pickten. Um seinen Konkurrenten in dieser Kunst zu übertreffen, habe Parrhasios von Ephesus (um 400 v. d. Zr.) daraufhin verschiedene Gegenstände mit einem Schleier übermalt, die Zeuxis beiseite schieben wollte.
Zudem glaubt Schweitzer, einen Zusammenhang zwischen der von ca. 600–300 vor der Zeitrechnung herrschenden Tyrannis und dem Auftauchen der Körperperspektive herstellen zu können. »Die Körperperspektive spiegelt so in der Kunst dieser Zeit ein neues Sich-selbst-Bewusstwerden des Menschen, seiner Freiheit und Stellung in der Welt« (Schweitzer 1953, S. 13).
Wahrscheinlich spielten hinsichtlich der Entdeckung der Raumperspektive noch weitere Aspekte eine bedeutsame Rolle. 1. Der Einfluss philosophischen Denkens auf die Bildgestaltung. So wird Platons absolute Seinslehre (Ideenlehre) durch den Relativismus der Sophisten infrage gestellt. Nicht die Götter oder die Ideen sind das »Maß aller Dinge«, sondern der Mensch. Mensch und Welt stehen von nun an in einem relativen Verhältnis zueinander. Somit dürfte der Relativitätsgedanke auch Eingang in das künstlerische Schaffen gefunden haben. Während die voneinander isolierten Figuren noch absoluten Vorstellungen verhaftet waren, mussten dem mehrfigürlichen Genre relative Größen zuerkannt werden, sollten sie lebensecht wirken. Zudem suchten die antiken Künstler nach Möglichkeiten, wie sie ihre Protagonisten in einer möglichst natürlichen Umgebung auf die Theaterbühne bringen könnten. Deshalb ist es Ernst Gombrich (1909–2001) zufolge »sicher kein Zufall, dass die Kunstgriffe der illusionistischen Malerei, der Perspektive und das Modellieren in Licht und Schatten, von der Antike ihren Ausgang nahm. In den Dramen, in denen die poetische Phantasie und die tiefe Einsicht der Dichter den Stoff der alten Mythen neu gestaltete, erreichte ja die Vergegenwärtigung jener mythischen Ereignisse ihren Höhepunkt, wobei die illusionistische Kunst des Bühnenmalers jenen Eindruck des unmittelbaren Miterlebens noch unterstützte« (Gombrich 1986, S. 156). Ein Wandgemälde aus dem im Jahre 79 nach der Zeitrechnung zerstörten Pompeji könnte in diesem Sinne gedeutet werden (Abb. 1).
Abb. 1: Paris am Berge Ida. Pompejanische Wandmalerei, erstes Jahrh. n. d. Zr.
Die Handhabung der illusionistischen Bühnenmalerei legt eine profunde Kenntnis der geometrisch-optischen Wahrnehmungstäuschungen nahe. Auch wenn sie explizit nicht beschrieben werden, sprechen geometrische Mosaiken doch eine beredte Sprache. So entdeckte man nämlich in prunkvollen griechischen Villen Wand- und Bodenmosaiken mit eingearbeiteten Kippfiguren und Müller-Lyerschen Täuschungen. Welchem Zweck sie dienten, ist freilich nicht bekannt. Doch kann man davon ausgehen, dass sie den Schönheits- und Kunstsinn der reichen Griechen befriedigten.