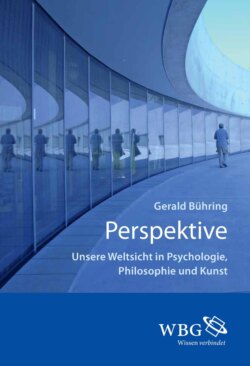Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 14
4.3 Luft- und Farbperspektive
ОглавлениеNicht nur die Texturperspektive verstärkt den Tiefeneindruck, auch Luft- und Farbperspektive haben ihren Anteil am Zustandekommen räumlicher Wahrnehmungen. Charakteristisch für die Luftperspektive ist eine zunehmende Helligkeit und Dunstigkeit, abnehmende Kontraste und Feinstrukturen und für die Farbperspektive ein Wechsel von warmen (gelben, orangen, roten, ocker, braunen etc.) zu kalten (grünen, grauen, blauen, violetten etc.) Farbtönen und deren allmähliches Verblassen. Bestimmte Lufteintrübungen verzaubern fernliegende Berge sogar in gläserne Gebilde, indes sie einen gering bewölkten Himmel blau erscheinen lassen.
Gedanken über diese atmosphärischen Luft- und Farbphänomene hatten sich schon Pyrrhon aus Elis (um 360–270 v. d. Zr.) und Claudius Ptolemäus (ca. 100–160 n.d. Zr.) gemacht und später noch viele andere Gelehrte und Künstler. Im siebenten Tropus Pyrrhons über die räumlichen Verhältnisse heißt es zum Beispiel: So erscheinen »die Berge aus der Ferne luftartig und gleichmäßig sich hinziehend, aus der Nähe dagegen zerklüftet« (Laertius 2005, S. 205).
Leon Battista Alberti beobachtete ein »SchwächeIn« der mittleren Sehpyramiden-Strahlen: »Ich glaube, der Grund dafür liegt darin, dass sie, beladen mit Licht und Farben, die Luft durchqueren, die durch ihre Belastung mit Feuchtigkeit die beschwerten Strahlen ermüdet. Hieraus entnehmen wir die Regel: je größer die Entfernung ist, desto trüber wird die gesehene Fläche erscheinen« (Alberti 2010, S. 77). Und Leonardo da Vinci stellte Folgendes fest: 1. Mit zunehmender Entfernung verblassen die Farben. 2. Weit entfernte Gegenstände, wie z.B. Gebirge, sieht man blau. 3. Gegenstände, die dunkler als die Luft sind, erscheinen heller und Gegenstände, die heller als die Luft sind, dunkler. 4. Von einem hoch gelegenen Ort scheint der Gipfel eines Berges näher zu sein als seine Basis. 5. Hingegen kehren sich die Sichtverhältnisse bei einem tief gelegenen Standort um. Als Ursache für diese Unterschiede nennt da Vinci die mehr oder weniger starke Dunstigkeit der Luftschichten.
Bekanntlich besteht die Erdatmosphäre aus Stickstoff, Sauerstoff, Edelgasen und Wasserdampf sowie aus immer mehr Kohlendioxid, Ozon, Staub- und Russpartikeln. Während Verunreinigungen und Feuchtigkeit den Dunstgrad der Luft verursachen, bestimmen Absorption und Streuung des Lichtes den Helligkeitsgrad der Gegenstände sowie die Blaustichigkeit des Hinter grundes.
Für den Betrachter bedeuten die letzten beiden Erkenntnisse, dass die Luftperspektive nur dann die Zentralperspektive unterstützt, wenn sich der anvisierte Gegenstand auf seiner Augenhöhe befindet. Andernfalls täuscht er sich hinsichtlich seiner wahren Größe und Entfernung.
Welch verwirrenden Eindrücke große Höhen und heiße Wüsten erzeugen können, schildern Mark Twain (1835–1910) und Richard Gregory (1923–2010): »Wiederum war es ein fröhliches Erwachen, angesichts einer frischen Brise, strahlenden Sonnenscheins, unermesslicher, grasiger Flächen, einer überwältigenden Einsamkeit, in der nirgends ein menschliches Wesen oder eine Behausung zu sehen waren, und eine Luft, in der sich alles wundersam vergrößerte, so daß Bäume, die drei Meilen entfernt waren, ganz in der Nähe zu sein schienen« … Der Laramie Peak »war in Wirklichkeit dreißig oder vierzig Meilen entfernt, aber er schien gleich hinter dem niedrigen Bergrücken zur rechten zu liegen« (Twain 1985 c, S. 39/64). Von einem Berg auf die gegenüberliegenden Berge in der Wüste von New Mexiko blickend erschienen sie ungefähr 20 bis 30 km entfernt. Tatsächlich beträgt die Distanz über 100 km. Es wäre also für einen Menschen unmöglich, genügend Proviant und Wasser mitzunehmen, um das Gebirge zu Fuß zu erreichen. Nach dem nebligen englischen Klima vermittelte die trockene Wüstenluft eine völlig irreführende Schätzung hinsichtlich der Entfernung des Gebirges« (Gregory 1972, S. 237).
Worauf der englische Wahrnehmungspsychologe Richard Gregory im letzten Satz hinweist, ist für unsere perspektivischen Betrachtungen nicht unerheblich. Denn die richtige Einschätzung von Größe und Entfernung hängt nämlich nicht allein von der Linear-, Luft- und Farbperspektive ab, sondern auch vom jeweiligen »Migrationshintergrund«, wenn man so sagen darf. Wer aus dem nebligen England stammt, wird nämlich, des trockenen Wüstenklimas ungewohnt, die riesigen Entfernungen völlig falsch beurteilen. Genau wie der Flachländer im Hochgebirge oder der Europäer in den Schneewüsten der Antarktis sich immens zu irren vermag.
Während für Touristen und Forscher solche Situationen unter Umständen existenzielle Fragen aufwerfen, hat der Maler lediglich damit zu kämpfen, wie er seine »atmosphärische« Perspektivschau auf die Leinwand bekommt. Folgt er Leonardo da Vincis Empfehlung, wie er sie in seiner Abhandlung »Von der Luftperspektive« darlegt, so scheint dies gar nicht so schwer: »Es giebt noch eine andere Perspective, die nenne ich die Luftperspective, weil man vermöge der Verschiedenheit des Lufttons die Abstände verschiedener Gebäude erkennen kann, die unten, wo sie hervorkommen, von einer einzigen geraden Linie abgeschnitten sind, wie z.B. wenn man viele Gebäude jenseits einer Mauer sähe, und alle über deren oberen Rand gleich hoch hervorragten, du aber in deinem Bilde eines weiter entfernt als das andere wolltest aussehen lassen. Man stellt dann eine etwas dunstige Luft dar … Du machst also das vorderste von den Gebäuden über jener Mauer in seiner wahren Farbe. Das etwas weiter wegstehende machst du weniger profilirt und blauer. Das folgende, von dem du willst, dass es noch einmal so weit weg sei, machst du noch einmal so blau, und das, welches fünfmal so weit entfernt willst aussehen lassen, machst du fünfmal blauer. Diese Regel wird bewirken, dass man bei Gebäuden, die gleich hoch über die nämliche gerade Linie hervorragen, deutlich erkennen wird, welches von ihnen entfernter und welches höher ist« (da Vinci 1882, S. 283).
Das liest sich einfacher, als es ist; denn der Blick des Malers muss gegen die Farbkonstanz ankämpfen. Wenn er nur sieht, sieht er, was er weiß. Wenn er aber genau hinsieht, sieht er auch die Farbnuancen, wie der mit Hermann Hesse (1877–1962) befreundete Komponist und Maler Othmar Schoeck (1886–1957): »Sieh«, sagte er etwa, »dort ganz in der Ferne siehst du die Vorberge, mit den beleuchteten Matten. Sie scheinen grün zu sein, nicht wahr? Sie sind ja schon grün, aber in unendlicher Verdünnung, und eigentlich sehen wir sie gar nicht so sehr grün, aber wir wissen: Matten sind grün, also sehen wir sie grün.« Jetzt bückte er sich, brach ein Blatt von einer Wiesenpflanze ab und hielt es vor die Aussicht. »Das ist grün!«, rief er, »schau, wie das knallt! Daneben ist die Ferne dort farblos« (Hesse 1992, S. 251).
Trotz dieser Belehrungen scheinen sich die Künstler noch lange Zeit, mit der Luft- und Farbperspektive schwergetan zu haben. Tiefenwirksame Abstufungen der Lokalfarbe gelangen eigentlich erst den genialen »Lichtmalern«, den sogenannten Impressionisten des 19. Jahrhunderts. Eine höhere Entwicklungsstufe der Malerei erklimmend, vermitteln ihre lichtdurchfluteten Landschaften den erhellenden Eindruck einer wunderbaren räumlichen Harmonie.