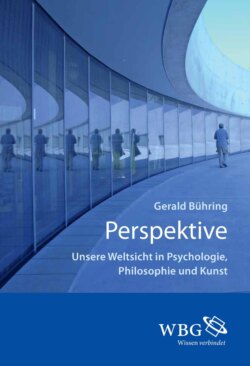Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 27
Gemeinsame Wurzeln
ОглавлениеWorin bestehen nun die phylogenetisch-ontologischen Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten? Beginnend mit den Anfangsgründen der Kunst behauptet der Physiologe Max Verworn (1863–1921): »Die mannigfaltigen Äußerungen des primitiven Kunstsinns haben sämtlich eine gemeinsame Wurzel, das ist das Spiel« (Verworn 1909, S. 57). Dem könnte man durchaus zustimmen. Schließlich lässt sich allerorten beobachten, wie kleine und große Künstler spielerisch bei der Sache sind, schöpferisch und schwelgend in bunten Farben. Doch nicht nur! Auch große Ernsthaftigkeit ist mit im Spiel, weswegen Stern lieber vom »Ernst-Spiel« spricht. Also werden gewissermaßen zwei Welten fusioniert: die raue Wirklichkeit und das malerische Spiel. Aus dem spielerischen Umgang mit den ernsthaften Dingen konnten sich drei Kunstrichtungen entwickeln: eine ornamentale, eine lineare und eine darstellende. Ornamentale Strukturen auf Holz und Elfenbein lassen sich schon sehr früh in der Geschichte der Menschheit nachweisen und sind bis heute ein beliebtes Stilmittel. Ähnliches gilt für die erzählenden oder linearen Zeichnungen. Steinzeitkünstler lieben dieses Stilmittel genauso wie die Inuits, Tchukchis (vgl. Große 1928, S. 186/187), die Indianer (vgl. Kerschensteiner 1905, Taf. 17) und auch die Kinder. Besonders von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geschätzt sind die sogenannten »Comicstrips« mit abenteuerlichen, grotesken oder witzigen Inhalten. Man denke nur an Max und Moritz, Micky Maus, Tom und Jerry, Fix und Foxi, Tim und Struppi, Asterix und Obelix.
Die darstellende Malkunst nahm einen ziemlich merkwürdigen Verlauf. Denn nachdem die steinzeitlichen Höhlenmaler bereits naturgetreue Zeichnungen auf hohem Niveau anfertigten, regredierten die bronzezeitlichen Graveure wieder auf einfache Felsritzungen. Und viele Tausend Jahre später zeichneten und malten Naturvölker und Kinder noch immer ziemlich primitiv (Abb. 22, Farbtafel). Das heißt: Tiere und Menschen wurden im Profil, verzerrt oder schematisch dargestellt. Dazu bemerkt Verworn: »Man hält die Kinderzeichnungen und die phantastisch bizarren Bilder der Naturvölker für tiefer stehende Kunstäußerungen als die realistischen Bilder der diluvialen Jäger, und das ist, so paradox das auf den ersten Anschein klingen mag, falsch. Diese fratzenhaften Darstellungen der Naturvölker und Kinder stehen höher als die diluvialen Tierbilder, weil sie bereits das Produkt weitgehender Reflexion sind als die letzteren, die lediglich die unmittelbaren Erinnerungsbilder des gesehenen Objekts repräsentieren.
Die Zeichnung des Kindes bringt, wie mir systemisch ausgeführte experimentelle Studien an zahllosen Schulkindern gezeigt haben, fast immer eine ganze Summe von erlernten Kenntnissen und Überlegungen zum Ausdruck … Ähnlich bei den Naturvölkern, mit Ausnahme der Buschleute, »werden hier immer Ideen über die Dinge, nicht die Dinge selbst dargestellt. Die Kunst der meisten heutigen Naturvölker ist wie die Kunst der Kinder eine durch und durch ideoplastische Kunst‹. Demgegenüber ist die figurale Kunst der paläolithischen Jäger eine echt ›physioplastische Kunst‹, d.h. eine naturwahre Kunst, die nur das wirkliche Objekt selbst oder sein unmittelbares Erinnerungsbild, aber keine Spekulation darüber, keinerlei Reflexion und Überlegung zum Ausdruck bringt« (Verworn 1909, S. 49f.).
Natürlich blieb Verworns Behauptung nicht unwidersprochen. So vertrat Karl Doehlemann (1864–1926) die Ansicht, dass physioplastische Kunst höher einzuschätzen sei als ideoplastische, weil sie eine genauere Beobachtungsgabe, längere Erfahrung und eine gewisse Abstraktion voraussetzt (vgl. Verworn 1909, S. 69). Ernst Große wiederum meinte: »Das Verlangen nach peinlich naturalistischen Darstellungen ist in vielen Fällen ein Symptom für das Erschlaffen der Phantasie; es tritt in der That am stärksten bei alternden Culturvölkern auf. Kindliche Menschen und Völker kennen es nicht; denn ihre Phantasie ist noch jeder Anforderung gewachsen« (Große 1900, S. 173) und so überwiegt bei ihnen die Kunst der Symbolik. Entbehrten also die alten Höhlenmaler jeglicher Fantasie? Man mag es bezweifeln! Augenscheinlich erkennen lässt sich hingegen, dass primitive Maler weniger als kindliche von der Perspektive verstehen (vgl. Große 1928, S. 193f.).
Schließt man sich Doehlemanns Ansicht an, so wäre zu fragen, warum die bronzezeitlichen Künstler und ihre neuzeitlichen Kollegen, die Erfahrungen der Höhlenmaler nicht genutzt haben. Vielleicht aus folgenden Gründen: Da wäre zum einen die Tatsache, dass Erfindungen auch wieder vergessen werden können und zum anderen unsere eigenen Erfahrungen. Der eine oder andere weiß vielleicht noch um das plötzliche Versiegen seines zeichnerischen Interesses nach Beendigung der Schullaufbahn. Es fehlte an entsprechenden Anregungen und Übungen und der Notwendigkeit, fürs tägliche Leben zeichnen zu müssen. Und wer nicht ständig übt, rostet und verkümmert. Irgendwann stellt man fest, dass die Zeichenkünste überaus dürftig geworden sind. So mögen auch die meisten Kulturvölker kein Interesse mehr daran gehabt haben, realistisch zu zeichnen. Lange Zeit genügten schematische und symbolische Darstellungen, bis einige begnadete Künstler doch wieder und auf höherem Niveau zur naturalistischen Kunst zurückfanden.