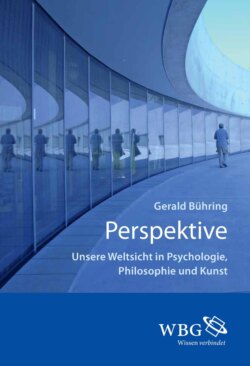Читать книгу Perspektive - Gerald Bühring - Страница 15
4.4 Bedeutungsperspektive
ОглавлениеDie sogenannte »Bedeutungsperspektive« hat eine längere Tradition als die anderen Perspektivarten und diente schon den Ägyptern als beliebtes Stilmittel. Man findet sie bei ihren »Familienstatuen« genauso wie auf ihren Wandreliefs und Wandgemälden. Herrschaftliche Ehepaare werden gleich groß und in gleicher Sitzhöhe – also gleichberechtigt – dargestellt, während ihre Sklaven »kleinwüchsig« und unterwürfig zu ihren Füßen hocken. Der Pharao nebst Gemahlin, der königliche Baumeister, die Handwerker, Jäger, Fischer und Diener werden nicht in ihrer wahren Körpergestalt abgebildet, sondern entsprechend der sozialen Stellung. In byzantinischen Zeiten erfuhr diese »Prestigekunst« eine Neuauflage mit dem Unterschied, dass sich die Künstler nunmehr auf Heiligenfiguren spezialisierten. So wurden Gottvater, Christus und Maria, die Jünger und Evangelisten sowie die Märtyrer auf den Ikonen größer, die dienstbaren Engel kleiner abgebildet. Indem man den unterschiedlichen Heiligen noch einen goldenen Nimbus verlieh, sollte symbolisch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Repräsentanten des Christentums nicht oder nicht mehr von dieser Welt sind.
Abb. 17: Wandreliefplatte im Mariendom zu Fürstenwalde (15. Jh.)
Im Mittelalter setzte sich der bedeutungsperspektivische Trend fort. Während dieser Epoche wurden vor allem Heilige und Adlige in dieser Art und Weise dargestellt. So sind die beiden Schach spielenden Adligen im Hintergrund in der »Manessischen Liederhandschrift« (14. Jh.) wesentlich größer gezeichnet als die aufspielenden Musikanten, obwohl Letztere im Vordergrund stehen (Abb. 16, Farbtafel). Ein Kuriosum der besonderen Art sind die mittelalterlichen »Stiftsbilder«. Statt billiger Gelübde stifteten wohlhabende Privatpersonen ihrer Mutterkirche teure Christus- oder Heiligenbilder oder Epitaphe.
Aus purer Dankbarkeit für eine Heilung oder Errettung sollte man meinen. Schaut man jedoch genauer hin, so dienten diese Stiftungen auch der Selbstverehrung. Das heißt, die dankbaren Stifter ließen sich zusammen mit ihren angebeteten Heiligen abbilden. Meistens in bescheidenen Maßen. Manchmal jedoch überschritten sie die Maße des Schicklichen. So erscheint der Bischof im Mariendom (15. Jh.) zu Fürstenwalde in seiner vordergründigen Selbstdarstellung proportional wesentlich größer als der gekreuzigte Jesus von Nazareth (Abb. 17). Sollte der Kleriker dessen Warnung vergessen haben: »Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden?«
Selbst die Naturvölker griffen hin und wieder auf die Bedeutungsperspektive zurück, wie ein hier nicht gezeigtes Höhlenwandgemälde der San (Buschmänner) zeigt: »Es stellt den Kampf einer kleinen Schar mit Bogen bewaffneter Buschmänner, die eine Rinderherde geraubt haben, gegen Kafferkrieger dar, die mit Fellschild und Assagai ausgerüstet, den Räubern nachstürmen. Diese Kaffern sind den zwerghaften Buschmännern gegenüber als wahre Riesen abgebildet; … um das Heroische der That auszudrücken, dass so kleine Leute sich den riesigen muskelstarken Kaffern zu widersetzen wagten« (Große 1900, S. 187).