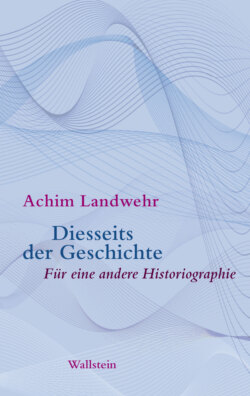Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zumutungen
ОглавлениеZugegeben, darin steckt eine doppelte Zumutung. Zum einen zeichnet sich eine solche Forderung nicht gerade durch übergroße Bescheidenheit aus. Und zum anderen kann ich noch nicht einmal den Anspruch erheben, mit diesem Buch bereits alle Schritte auf dem dazu nötigen Weg absolviert zu haben. Sollte mein Vorhaben halbwegs gelungen sein, dann finden sich auf den folgenden Seiten einige Irritationen und Verwirrungen über die Arten und Weisen wie Geschichte und Geschichten üblicherweise funktionieren. Es finden sich aber ebenso Vorschläge, wie man mit solchen Uneindeutigkeiten umgehen und wie man sie beschreiben kann.
Eines der vielen möglichen Argumente, weshalb eine Irritation des standardisierten Geschichtsverständnisses vonnöten ist, findet sich bei dem Semiotiker Jurij Lotman. Ihm offenbaren sich vor dem Hintergrund einer kulturtheoretischen Zeichentheorie die Schwierigkeiten historischer Erzählungen. Indem eine traditionelle Geschichtsschreibung das Geschehene als zwangsläufig und gewissermaßen natürlich präsentiert, treibt sie auch die Unbestimmtheit aus diesem Geschehen aus. Dabei ist es doch gerade die Unbestimmtheit, die als Wert und Maßeinheit von Information zu gelten hat. Präsentiert man ein vergangenes Geschehen als zwangsläufig und unabänderlich, wird nicht nur die Unbestimmtheit, sondern wird auch die Möglichkeit aus der historischen Arbeit vertrieben.[13] Ohne Unbestimmtheit wird eine kollektivsingularisierte Geschichte zu einem Schicksal, das man registrieren kann und hinzunehmen hat, büßt jedoch alle Eigenschaften eines Möglichkeitsraums ein.
Die hier versammelten Beiträge, die zu unterschiedlichen Anlässen entstanden und zu einem größeren Teil bereits an verschiedenen Orten publiziert worden sind, folgen drei zentralen, miteinander verbundenen Fragen: Wie sind etablierte Modelle von Zeit und Geschichte ausgestaltet – und warum sind sie ungenügend? Gibt es alternative Modellierungen der Zeit und des Historischen? Und welche praktischen Konsequenzen haben diese Alternativen für die Geschichtsschreibung?
Die Schwierigkeiten fangen schon damit an, dass ausgerechnet im Rahmen historischer Bemühungen die Zeit als Kategorie keinen besonders prominenten Platz einnimmt (Alte Zeiten, Neue Zeiten). Auch wenn seit etwa 2010 Bewegung in die Diskussion gekommen zu sein scheint,[14] nimmt es doch immer noch Wunder, dass Zeit in der internationalen Geschichtswissenschaft eher als neutraler Rahmen des historischen Geschehens denn als Problem und wichtiger Faktor eben dieses Geschehens wahrgenommen wird. Der Weg zu einer Zeiten-Geschichte stellt sich daher immer noch als eher schmaler Trampelpfad dar, obgleich er doch zahlreiche Aussichten verspricht, um der historischen Arbeit eine andere Bedeutung und Relevanz zu verleihen – insbesondere über die selbstgenügsamen Grenzen der Geschichtswissenschaft hinaus.
Das offenbart nicht zuletzt eine auch alltäglich zu erfahrende Vielzeitigkeit (Das Jetzt der Zeiten). Menschen leben nicht nur in einer physikalischen oder biologischen oder durch Uhren und Kalender dominierten Zeit, sondern bilden beständig zahlreiche kulturelle Zeitformen aus, die ihnen schier unendlich vielfältige temporale Bezugnahmen erlauben.
Als ein Beispiel für die Möglichkeit von Verzeitung zeigt die Zeitrechnung dabei eine herausfordernde Janusgesichtigkeit. Uhren und Kalender besitzen mitsamt ihren konkreten Entstehungszusammenhängen und Ausbreitungswegen eine deutliche kulturelle Spezifik. Die weltweite Diffusion europäischer Zeitrechnungsmodelle macht das Verhaftetsein mit ihrem provinziellen Ursprungsort nur noch deutlicher. Diese globale Dominanz erweist aber auch, wie sich bestimmte Zeitvorstellungen verabsolutieren und zumindest in einem gewissen Rahmen einen quasi natürlichen Charakter gewinnen können – von dem man sich dann nur unter großen Mühen wieder befreien kann.
Auch das Reden und Denken in den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deckt wahrlich nicht alle Zeiten ab, die uns vielzeitig zur Verfügung stehen. Aufgrund ihrer unübersehbaren Bedeutung lohnt eine zumindest probebohrende Beschäftigung damit aber allemal. Dabei muss auch der Kontingenz der Vergangenheit (wieder) ein angemessener Platz eingeräumt werden. Sind wir üblicherweise nur gewillt, der Zukunft zu attestieren, kontingent zu sein, also die verunsichernde Eigenschaft zu besitzen, sowohl möglich als auch nicht möglich sein zu können, sollte man das Un / Mögliche des Vergangenen doch nicht übersehen. Gerade vor der Erwartung, Hort der sicheren und nicht mehr veränderbaren Gewissheit zu sein, muss man das Historische beschützen. Denn sollte die These von der Vielzeitigkeit plausibel sein, dann müssen Gegenwarten nicht nur beständig damit rechnen, von Unwägbarkeiten der Zukunft überrascht zu werden, sondern dann werden sie auch von Gespenstern aus der Vergangenheit heimgesucht, deren Existenz sie nicht einmal zu erträumen wagen und die bis zu ihrem Auftauchen in einem wörtlichen Sinn als undenkbar gelten – und zwar sowohl im Positiven wie im Negativen. Spätestens hier zeigen sich die Restriktionen einer Geschichtsauffassung, die auf Homogenität, Linearität und Teleologie setzt, weil mit ihr tendenziell all die möglichen Geschichten beiseite gedrängt werden, welche die Vergangenheit immer noch bereithält. Wie sehr eine Gegenwart von solchen kontingenten Vergangenheiten überrascht werden kann, zeigt sich an der allfälligen Rede von den ›vergessenen‹ oder ›verschütteten‹ Geschichten, die erst und gerade jetzt wieder ins Bewusstsein gerückt werden.
Dieser Gegenwart kommt eine besondere Rolle im verwirrenden Spiel der Zeiten zu. Schließlich ist sie die einzige Zeit, die uns zur Verfügung steht – und sie ist auch als Zeitmodalität dadurch gekennzeichnet, das Verfügbare zu umfassen, also alles das, was noch beeinflusst und verändert werden kann. Die Gegenwart beinhaltet auch die jeweils verfügbaren Vergangenheiten und Zukünfte, weil diese abwesenden Zeiten keinen anderen Existenzort haben – schließlich sind sie als Vergangenheiten nicht mehr und als Zukünfte noch nicht. Aufgrund dieser Bedeutung muss es verwundern, dass ›Gegenwart‹ generell eher wenig behandelt wird. Vielleicht aufgrund der überbordend erscheinenden Aufgabe, damit eigentlich schon alles behandeln zu müssen?
Um der erdrückenden Komplexität zu entgehen, alles gleichzeitig behandeln zu müssen, können Phänomene und Probleme in abwesende Zeiten abgeschoben werden. Vergangenheit und Zukunft sind daher auch die Zeiten des Nicht-mehr beziehungsweise des Noch-nicht. Paradoxerweise können Vergangenheiten und Zukünfte diese Rolle aber nur übernehmen, wenn sie als abwesende Zeiten beständig anwesend gehalten werden. Damit ist aber auch klar, dass Vergangenheit und Zukunft keine Zeiträume sind, die der Gegenwart dichotomisch gegenübergestellt werden können, sondern temporale Projektionen einer Gegenwart, die sich niemals von dieser Gegenwart ablösen lassen (Zukunft – Sicherheit – Moderne). Nicht zuletzt die allfälligen politischen Verknüpfungen von Zukunftsfragen mit Sicherheitsproblemen zeigen jedoch die Schwierigkeiten, die sich ergeben, sobald eine künftige Zeit als vermeintlich unabhängige Wesenheit von der sie entwerfenden Gegenwart abgekoppelt werden soll. Dann handelt es sich um den kaum verschleierten und zwangsläufig zum Scheitern verurteilten Versuch einer Stillstellung von Zeit.
Dass die zeitlichen Verhältnisse so viel komplexer sind, als wir üblicherweise annehmen, verdeutlichen nicht zuletzt temporale Phänomene, die übersehen, nicht ernst genommen oder schlichtweg abgelehnt werden. Kulturelles Vergessen sieht sich beispielsweise gegenüber der Erinnerung und dem Gedächtnis noch immer in einer Rechtfertigungsposition. Dabei ist das Vergessen nicht nur ebenso lebensnotwendig wie das Erinnern, sondern zeichnet sich auch durch zahlreiche zeitliche Verwicklungen aus. Während man einerseits vergessen muss, um Leben überhaupt noch zu gewährleisten, ist andererseits Vergessen im strengen Sinn unmöglich, weil man sich zumindest noch daran erinnern muss, vergessen zu haben. Zudem führt uns das Vergessen zurück zur Kontingenz der Vergangenheit, denn damit wird man nicht nur verwiesen auf Gewesenes, das verdrängt worden ist, sondern auch auf die Erinnerungen an Geschehnisse, die nie stattgefunden haben. Das Vergessen macht also aufmerksam auf die Potentialität des Historischen: Dort schlummern Vergangenheiten in der Inaktualität, die unerwartet gegenwärtig werden können.
Eine bekannte rhetorische Formel, um die Vielzahl historischer Verzeitungen auf einen Nenner zu bringen, ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Auch wenn die Intentionen, die sich mit dieser Formel verbinden, durchaus lauter sein mögen, ergeben sich damit doch unschwer zu erkennende Schwierigkeiten. Die Rede von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bleibt letztlich einem Euro- und Chronozentrismus verhaftet, den sie auf den ersten Blick zu überwinden versucht. Aber solange jede Feststellung einer Ungleichzeitigkeit – versehen mit diesem negativen Präfix ›Un-‹ – immer nur vorgenommen werden kann, weil sich das sprechende Subjekt selbst eine Position der Gleichzeitigkeit attestiert, lässt sich der Falle des Chronozentrismus nicht entkommen. Auch hier bedarf es einer tatsächlichen Behandlung der Gleichzeitigkeit der Zeiten.
Wird das Vergessen tendenziell übersehen und die Ungleichzeitigkeit missverstanden, so wird der Anachronismus nicht selten schlicht abgelehnt. Er wird zu den geschichtswissenschaftlichen Todsünden gerechnet – obgleich sowohl die Feststellung von Anachronismen wie auch das geschichtswissenschaftliche Arbeiten selbst immer schon anachronistisch sind. Denn erst in einer Kultur, die sich selbst einer strengen Chronologie verpflichtet hat, kann die Rede von einem chronologischen Einordnungsfehler sinnvoll sein – und das war in Europa vor dem späten 16. Jahrhundert offensichtlich nicht der Fall. Alle zuvor erfolgten Anachronismen können also noch gar keine gewesen sein. Und seither sind wir die Anachronismen auch nicht losgeworden – zum Glück. Denn historisches Arbeiten heißt ja gerade nicht, der eigenen Gegenwart eine von ihr abgetrennte Vergangenheit dichotomisch gegenüberzustellen, um eindeutig über sie zu urteilen, sondern heißt Relationierungen vorzunehmen, um abwesende Zeiten anwesend zu halten. Das kann gar nicht ohne anachronistische Vermischungen vor sich gehen. Das sollte aber auch nicht ohne solche Vermischungen vor sich gehen, denn der Anachronismus wirkt im höchsten Maß historisch produktiv.
Wenn ich aber nun so ausgiebig von den Unzulänglichkeiten etablierter Zeit- und Geschichtsmodelle gesprochen habe, um stattdessen die Vielzeitigkeit und die Relationierung der Zeiten zu betonen – wie kann und soll dann Geschichtsschreibung aussehen? Wie können wir gerade unter Umständen, die sich selbst als unübersichtlich, verunsichert und ungewiss beschreiben, eine Form der Historiographie betreiben, die sich nicht auf die Jenseitigkeit eines Kollektivsingulars Geschichte verlässt, sondern sich mit der Diesseitigkeit des Historischen begnügt? Mein Vorschlag hört auf den Namen Chronoferenzen. Damit soll es möglich werden, die homogene Linearität des Kollektivsingulars Geschichte zurückzulassen, um stattdessen die wesentlich vielfältigeren und allenthalben auffindbaren Möglichkeiten und Praktiken zu behandeln, anwesende mit abwesenden Zeiten zu koppeln. Dadurch ergibt sich zugegebenermaßen ein deutlich komplexeres Bild der zeitlichen Verhältnisse, in denen wir leben, das ich mit dem Begriff der ›Zeitschaft‹ zu fassen versuche. Dieser Komplexität ist nicht zu entkommen, denn selbst wenn wir es wünschen sollten, werden uns die Zeiten nicht den Gefallen tun, sich hübsch aufgeräumt in Reih und Glied aufzustellen. Und wenn wir zudem den Fragen und Problemen gerecht werden wollen, die uns in unserer Welt umtreiben, dann ist dafür ein angemessenes Verständnis der zeitlichen Relationierungen zwar nicht allein hinreichend, aber als Teil möglicher Antworten unabdingbar. Bei dieser Herausforderung helfen nicht neue Erzählungen im alten Gewand, sondern benötigen wir neue Erzählweisen, um diese Komplexität auf andere Art und Weise vorzuführen.
Drei Versuche sollen andeuten, wie eine Geschichtsschreibung auf der Basis von Chronoferenzen aussehen könnte.
Der amerikanischen Kleinstadt Carlsbad ist keine größere Rolle zugedacht worden in dem großen Welttheater, das wir üblicherweise als ›die Geschichte‹ zu bezeichnen pflegen. Aber vielleicht lohnt es sich gerade deswegen, den durchaus bemerkenswerten zeitlichen Relationierungen nachzugehen, die sich mit diesem Ort verbinden (Das Bad, die Höhle, der Müll ). Nicht nur hat sich Carlsbad nach dem böhmischen Kurort benannt, in der trügerischen Hoffnung, von dieser Chronoferenz touristisch zu profitieren, sondern die Stadt verfügt auch noch über (touristisch tatsächlich erfolgreiche) Tropfsteinhöhlen, welche die Besucher in die Tiefenzeit der Erdgeschichte zurückführen, war Jahrhunderte Siedlungsgebiet von first nations, die nochmals mit ganz anderen Zeitmodellen operierten, und ist seit Ende des 20. Jahrhunderts auch Heimat eines Atommülllagers, in dem heute bereits die Kommunikation mit einer projektierten Zukunft praktiziert wird. Sehr viele und sehr weit auseinander liegende Zeiten also, die sich in diesem Ort verknoten – und die doch keineswegs außergewöhnlich sind, weil sie sich in variierter Form für jeden Fleck der Erde nachzeichnen ließen.
Aber Chronoferenzen lassen sich selbstredend nicht nur mit Räumen in Verbindung bringen, sondern schmiegen sich unweigerlich allem an, dem wir in unserer Wirklichkeit begegnen. Die Zeit und die Zeiten verschonen nichts und niemanden. Das wird nicht zuletzt in sogenannten Krisenzeiten deutlich, bei denen sich die Frage stellt, wie man in ihnen nicht verloren geht (Heiner Hamlet Hans). Der Schriftsteller Heiner Müller hat 1989/90 gemeinsam mit dem Ensemble des Deutschen Theaters die Strategie gewählt, die Zeit aufzubrechen und mit der Hilfe von »Hamlet« zu zeigen, wie gegenwärtig ein Stück sein kann, das fast 400 Jahre alt ist. Der Schuhmacher und Bauer Hans Heberle wählte – als Zeitgenosse von Hamlet – während des Dreißigjährigen Krieges demgegenüber die Strategie der Registrierung von Zeit und der strengen Chronologie, um im Chaos seiner Wirklichkeit nicht verloren zu gehen. Und auch wenn die Protagonisten so gar nichts miteinander zu verbinden scheint, so müssen sie doch auf jeweils unterschiedliche Weise mit den Gespenstern der Vergangenheit umgehen, die sie nicht loslassen wollen.
Auch vom französischen Schriftsteller Claude Simon lässt sich mit Fug und Recht behaupten, er werde von Gespenstern verfolgt – nicht nur von denjenigen, die ihm als Soldat der französischen Kavallerie im Zweiten Weltkrieg begegnet sind (Geschichte schreiben mit Claude Simon). In seiner literarischen Auseinandersetzung mit den Geschehnissen nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern auch weiter zurückreichender Zeiträume, stellt Simon auch immer die Frage nach unserem Umgang mit diesen Zeiten – und nach den Geschichten, mit denen wir davon erzählen können. Bei ihm werden all diese Zeiten gegenwärtig, und zwar nicht im Sinn einer abstrahierten Theorie oder einer diffusen Esoterik, sondern aufgrund der schütteren Fäden, die übrig gebliebenes Material durch die Zeiten spinnt, aufgrund von Postkarten, Erinnerungen, Kalenderblättern, Gemälden, Briefen, Fotos.
Zuweilen genügt es auch für Claude Simon, aus dem Fenster zu sehen oder besser vielleicht noch vor die Tür zu treten und einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Die Dinge, die er dort sieht, die Menschen, denen er begegnet, die Schicksale, von denen sie erzählen – das alles gibt noch keine Gewähr für ein jeweils gegenwärtiges Wissen über vergangenes Geschehen. Aber es sind Haltepunkte inmitten des chaotischen Unsinns temporaler Bezugnahmen, der sich nicht mehr hinreichend als ›Geschichte‹ begreifen und bezeichnen lässt.