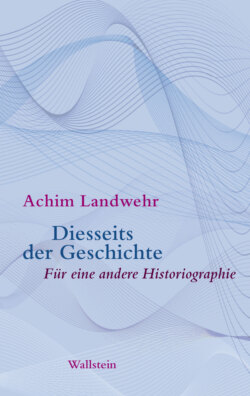Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zeiten-Geschichte
ОглавлениеÜberkommen einen üblicherweise Schwindelgefühle, wenn man die Forschungsliteratur zur Zeit zu erfassen versucht, so fallen die Gleichgewichtsstörungen erheblich geringer aus, sobald man sich in der Subkategorie der geschichtswissenschaftlichen Forschungen zu diesem Thema umtut. Denn die Behandlung von Zeit in den Geschichtswissenschaften ist einigermaßen paradox. Nüchtern betrachtet könnte man sagen, dass die Geschichtswissenschaft sich ohnehin und beständig mit der Zeit auseinandersetzt, weshalb es keiner gesonderten Auseinandersetzung mehr bedarf. Da Geschichte es nun einmal mit Veränderungen in der Zeit zu tun hat, besteht auf den ersten Blick kaum die Notwendigkeit, sich mit der Zeit nochmals gesondert zu beschäftigen – weil dies vermeintlich ohnehin schon immer geschieht. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass Zeit vielfach nur vorausgesetzt, aber selten problematisiert wird.[10] Zeit ist der Rahmen, in dem sich Geschichte abspielt, der aber in all seiner Konstruiertheit sowie sozialen und kulturellen Bedingtheit kaum einmal in den Fokus gerät. »Zeit scheint gemeinhin eine Bedingung zu sein, unter welcher Geschichte stattfindet, sie kann aber selbst durch die Geschichte nicht bedingt sein. Zeit lässt sich nicht erzählen: Sie ist die Bedingung dafür, dass man erzählen kann.«[11] Es ist daher angebracht, Zeit im Kontext der Geschichtswissenschaft in ähnlicher Weise einer kulturwissenschaftlichen Revision zu unterwerfen, wie dies in den vergangenen Jahren mit der ebenso fundamentalen Kategorie des Raumes geschehen ist[12] – denn eine Geschichte der Zeit kann die Zeit nicht in naiver Weise voraussetzen. Ähnlich wie es im Rahmen des sogenannten spatial turn um die Auflösung eines letztlich euklidischen Konzepts von Räumlichkeit ging, sollte sich die Geschichtswissenschaft – neben einigen anderen Disziplinen – darum bemühen, die Vorstellung von einer absoluten Zeit hinter sich zu lassen. (Und damit soll ausdrücklich nicht die Ausrufung eines weiteren, wie auch immer gearteten turns indiziert sein: Wir haben bereits genug davon.)
Nun lässt sich zu Recht einwenden, es gebe doch eine erkleckliche Anzahl historischer Untersuchungen, die sich der Zeit in ihren unterschiedlichen Facetten widmen, am intensivsten sicherlich im Rahmen der Historiographiegeschichte, der es um Vergangenheitsmodelle und Geschichtskonzepte zu tun ist.[13] Darüber hinaus finden sich – auch einige schon klassisch zu nennende – Studien vor allem zu Fragen der Zeitmessung und der Chronologie[14] oder aus den Jahren um 2000 auch zum allfälligen Phänomen der Jahrhundertwenden.[15] Doch wenn man von einigen Ausnahmen absieht, die beispielsweise die Geschichte der Zukunft[16] oder die Autorität der Zeit[17] im Blick haben, wird in der Mehrzahl dieser Studien Zeit immer schon als gegeben vorausgesetzt, aber weniger als kulturhistorisches Konstrukt problematisiert. Und genau hierum muss es gehen, um die Frage nämlich, welcher Zeitmodelle sich Gesellschaften in unterschiedlichen historischen Zusammenhängen bedienen, wie also Formen der Zeitorganisation und Zeitmessung eingesetzt werden, um Orientierung und Organisation innerhalb soziokultureller Zusammenhänge zu bewerkstelligen.[18]
In der Einleitung zu Stephen Hawkings bekanntem Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit« schrieb Carl Sagan den schönen Satz: »Wir bewältigen unseren Alltag fast ohne das geringste Verständnis der Welt.«[19] Man muss diesen Satz überhaupt nicht denunziatorisch verstehen, es handelt sich schließlich um die Feststellung der ganz normalen Komplexitätsreduktion, die wir alle nicht nur tagtäglich und ganz selbstverständlich praktizieren, sondern auch praktizieren müssen, wenn wir nicht wahnsinnig werden wollen. Wir können uns den Luxus schlicht nicht leisten, uns jeden Tag aufs Neue zu fragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind – ansonsten kämen wir morgens nicht einmal aus dem Bett. Sagan bezog seinen Satz auf den Bereich der Naturwissenschaften, insbesondere auf die Physik, und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der allergrößte Teil der Menschheit keinen Gedanken auf die Gestalt des Kosmos oder die Form von Elementarteilchen verschwendet – womit er zweifellos recht hat. Aber seine Aussage trifft ebenso auf gesellschaftliche und kulturelle Phänomene zu. Die Zeit ist für das Gesagte insofern prototypisch, als sie nicht nur unterschiedliche Aspekte aufweist (physikalische, biologische, soziale, kulturelle etc.), sondern wir mit ihr auch gänzlich selbstverständlich umgehen (müssen), ohne uns beständig die Frage zu stellen, was diese Zeit denn nun sei.[20]
Damit ist ein grundlegendes Problem auch für den geschichtswissenschaftlichen Umgang mit der Zeit benannt: Zeit ist immer und überall. »Zu den wenigen fundamentalen Kategorien, mit Hilfe derer wir unsere Wahrnehmungen der Welt strukturieren, gehört die Zeit. Im Raum stellt sich uns das Nebeneinander der Welt dar, durch Zeit erfassen wir das Nacheinander. Auch speziellere Prinzipien der Welterfassung wie Kausalität und Finalität, mit denen wir konkrete Qualitäten von Abläufen bezeichnen, enthalten eine zeitliche Dimension. So ist Zeit zwar nicht als Wort, aber doch als Ordnungsprinzip des Bewußtseins universal.«[21] Gerade weil sie so grundlegend ist, ist Zeit so schwierig in den Griff zu bekommen. Ähnlich wie im Fall des Raumes oder des Wissens oder der Erinnerung oder der Religion oder anderer Themen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf dem wissenschaftlichen Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten hoch gehandelt wurden, lässt sich die Zeit nicht auf einen eindeutigen definitorischen Kern zurückführen. Spätestens an dieser Stelle ist es angebracht, eine Referenz zu zitieren, die – zumindest gefühlt – in jeder zweiten Publikation zum Thema Zeit herangezogen wird. Augustinus sagte bekanntermaßen: »Was ist also ›Zeit‹? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht.«[22]
Bei Augustinus lässt sich mithin die Unmöglichkeit begreifen, Zeit definitorisch zu fassen. Sie lässt sich zumindest nicht in einem Sinne begrifflich auf den Punkt bringen, der entweder überzeitlich gültig oder historisch nützlich wäre. Zeit entzieht sich beständig allen Versuchen, sie sprachlich so einzuklammern, dass sie einem nicht mehr zwischen den Händen entgleitet. Es ist tatsächlich unmöglich, zu sagen, was Zeit ist. Ebenso ist es unmöglich, zu sagen, was Zeit nicht ist. Aber auch wenn diese Einsicht als bedauernswertes Eingeständnis einer Niederlage verstanden werden könnte, so halte ich sie offen gestanden nicht für sonderlich problematisch. Der Zeit geht es da nicht besser als zahlreichen anderen Abstrakta, mit denen wir ganz alltäglich und völlig unproblematisch umgehen, ohne uns ernsthaft die Frage zu stellen, was das eigentlich ist, das unser Leben so unübersehbar bestimmt.
Das Problem einer jeden Beschäftigung mit der Zeit besteht in der argumentativen Zirkularität, in die man sich unweigerlich hineinbegibt und der nicht zu entkommen ist. Ähnlich wie die Erkenntnistheorie immer im Modus des Erkennens operiert, die Hirnforschung immer von Gehirnen vorgenommen wird, die Auseinandersetzung mit der Geschichte immer schon historisch verortet ist, so ist auch »das Denken der Zeit schon immer ein Denken in der Zeit.«[23] Im Fall der Zeit können wir keinen Beobachterstandpunkt einnehmen, der sich gewissermaßen gottgleich außerhalb der Verhältnisse setzte, um sie nüchtern zu betrachten. Aber indem wir über die Zeit nachdenken und uns mit ihr beschäftigen, setzen wir Zeit nicht nur als Gegebenes voraus (was nicht funktionieren kann), sondern vollziehen und konstituieren Zeit im Zuge dieser Beschäftigung. Würde es uns gelingen, Zeit distanziert, gar externalisiert wahrzunehmen und zu erkennen, bräuchte es ein anderes Wahrnehmungssubjekt, das uns wiederum bei unserem Vollzug von Zeit beobachten würde, das seinerseits wiederum ein drittes Wahrnehmungssubjekt benötigte, das dessen Vollzug von Zeit beobachtete – ad infinitum. Wer von Zeit redet, darf sich offensichtlich vor Argumentationszirkeln und Paradoxien nicht fürchten.[24]
Der Weg, um des Problems der Zeit irgendwie habhaft zu werden, kann also kein definitorischer sein, sollte daher auch nicht durch das Zentrum verlaufen und die Frage stellen, was Zeit ist. Vielmehr ist ein Weg über die Ränder einzuschlagen. Dann müsste die Frage nicht lauten, was Zeit ist, sondern wie Zeit verwirklicht wird, wie sie verwendet wird, in welchen Zusammenhängen sie dingfest gemacht werden kann. An die Stelle der definitorischen und abstrakten Frage nach der Zeit tritt die historische Frage nach den Zeiten.[25] Denn: »Mit ›Zeit‹ füllen wir die Leere, vor der uns graut. Wir konstruieren Gewißheiten und Ordnungen im Hinblick auf das Vergängliche. Es ist nicht die ›Zeit‹, die wir messen, nein, wir messen Veränderungen, Dynamiken, Prozesse und nennen dies ›Zeit‹. Die Uhr mißt demnach nicht die ›Zeit‹, vielmehr ist es der Lauf der Zeiger, den wir als ›Zeit‹ bezeichnen und mit besonderen Maßstäben etikettieren (Stunde, Minute, Sekunde). Dieser Sachverhalt verleitete Einstein dazu, die ›Zeit‹ als eine ›hartnäckige Illusion‹ zu kennzeichnen. […] Daher ist die Zeit ein menschengemachtes Netz, in dem man Spinne und Fliege zugleich ist. Indem wir die ›Zeit‹ kontrollieren, kontrollieren wir uns selbst. Wir produzieren, so gesehen, jene ›Zeit‹, die auf uns wirkt.«[26]
Zeit kann also nicht als objektive Gegebenheit der natürlichen Ordnung verstanden werden, so dass sie sich im besten Fall nicht von anderen Naturobjekten unterscheiden würde, abgesehen von ihrer sinnlichen Unzugänglichkeit. Sie kann auch nicht als eine Zusammenschau von Ereignissen konzipiert werden, die auf der Eigentümlichkeit des menschlichen Bewusstseins basiert; Zeit würde dann jeglicher menschlichen Erfahrung vorausgehen und hätte apriorischen Charakter.[27] Vielmehr scheint es (zumal für geschichtswissenschaftliche Belange) angemessener, die Zeit in einem funktionalen Licht zu besehen. Die historische Perspektive dürfte für eine solche Position ausreichend Belegmaterial liefern. Das, was wir nicht selten in einem naturalistischen und gewissermaßen übermenschlichen Sinn als Zeit verstehen, war und ist immer um soziale Gruppen zentriert. Die Zeit ist ein Mittel zur Orientierung in der sozialen Welt und dient vor allem der Regulierung des Zusammenlebens unter den Menschen. Um gesellschaftliche Tätigkeiten im Fluss des Geschehens fixieren zu können, werden Naturabläufe genutzt, durch welche die Position und Dauer von Ereignissen bestimmbar wird.[28] Zeit kann zwar als Universalie bestimmt werden, das »heißt aber nicht, daß Zeit ein überall in gleicher Form vorhandener Bewußtseinskomplex ist. Zeit als strukturierendes Vorstellungssystem ist vorwiegend ein soziales Phänomen. Das bedeutet, daß die Zeit, die unser Denken und Handeln zutiefst prägt, nicht Zeit schlechthin ist; sie ist nur rudimentär ein dem Menschengeschlecht eingeborener, als einheitliche Ausstattung mitgegebener Vorstellungskomplex und lediglich in wenigen Fällen (wie z. B. beim Wechsel der Jahreszeiten) ein reines Ablesen von meteorologischen und astronomischen Phänomenen. Sie ist vielmehr in hohem Maße eine gesellschaftlich bedingte und gesellschaftlich wirksame Konzeption und mit den Eigenheiten einer Gesellschaft verwoben.«[29]
Um den Eindruck zu vermeiden, es handele sich bei der Zeit um ein Objekt jenseits menschlicher Zugriffmöglichkeiten, das als überwölbendes und übermächtiges Dach über uns schweben würde, hat Norbert Elias vorgeschlagen, das Verb ›zeiten‹ zu verwenden. Damit kann deutlich gemacht werden, dass es sich bei der Bestimmung von Zeit um einen sozialen und kulturellen Vorgang handelt. Es werden dadurch nicht nur Beziehungen aufgezeigt, durch das ›Zeiten‹ werden Beziehungen hergestellt.[30] Folgt man Armin Nassehi, lässt sich Zeit erstens nicht mehr als ontologische Einheit konstruieren, sondern es muss auf den operativen Aspekt der Konstitution von Zeit Wert gelegt werden. Zweitens kann es nicht genügen, den Ort der Zeit (als sozialer Zeit) entweder in das Subjekt in Form des individuellen Zeitempfindens zu verlegen oder im Sozialen zu verorten, so dass es ›die Gesellschaft‹ wäre, die Zeit hervorbringt. Vielmehr muss umgestellt werden von der Suche nach einer Identität von Zeit zu einer differenztheoretisch fundierten Herangehensweise, sprich: Zeit hat keinen eindeutig identifizierbaren Ort (wo immer dieser auch situiert werden mag: bei Gott, im Universum, im Individuum oder in der Gesellschaft), sondern Zeit entsteht im Zwischen.[31]
Zeit entsteht aber nicht nur in der Produktivität der Differenz, sie bringt ihrerseits Differenzen hervor. Eine ihrer wichtigsten Leistungen besteht laut Elena Esposito in der spezifischen Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft, die eine Gegenwart jeweils für sich trifft. Diese Unterscheidung ist keineswegs gegeben, wie man aufgrund des eigenen Umgangs mit diesen Zeitdimensionen meinen könnte. Vielmehr ist der spezifischen Differenzierung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowohl eine historische wie eine soziale Dimension eigen, das heißt sie wird im Verlauf der Zeit selbst generiert, regeneriert und transformiert, und dies geschieht durch jeweils unterschiedliche Gruppen auf jeweils unterschiedliche Art und Weise.[32] In den Worten von Niklas Luhmann: »Was sich in der Zeit bewegt, sind Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft zusammen, ist, mit anderen Worten, die Gegenwart mit ihren Zeithorizonten Vergangenheit und Zukunft.«[33]
Die Frage ist also, wie in bestimmten soziokulturellen Kontexten die Zeit diskursiv produziert wird, wie Vergangenheit und Zukunft als Projektionen erzeugt werden.[34] Denn die zeitlichen Orientierungen nach hinten und vorne sind notwendigerweise immer Konstruktionen einer Gegenwart, die sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzt. Vor einem solchen Hintergrund wird deutlich: »Ausgangspunkt kann nur die Gegenwart sein, weil Vergangenheit und Zukunft und auch die vergangenen Gegenwarten und die künftigen Gegenwarten nur als Formen (Modi) der jeweils aktuellen Gegenwart existieren.« Doch gerade hier hapert es, denn es »fehlt ein angemessener Begriff der Gegenwart, in der Vergangenheit und Zukunft jeweils zusammen aktuell zusammentreffen […].«[35] Der Frage nach der Gegenwart auch und gerade in historischer Perspektive auf den Grund zu gehen, dürfte sich vor allem deshalb lohnen, weil in diesem Zusammenhang die Paradoxie der Zeit sowohl theoretisch als auch empirisch greifbar wird. Die Zeit offenbart sich vor diesem Hintergrund nämlich als Form der Einheit von Aktualität und Inaktualität. Zeit stellt sich dar »als Identität einer Gegenwart, die es nicht gibt, außer als Unterscheidung einer Vergangenheit, die es nicht mehr gibt, und einer Zukunft, die es noch nicht gibt.«[36]
Mit einem solchen Zeitmodell zu operieren, ist eine durchaus beeindruckende historische Leistung, denn es produziert eine Form der Unsicherheit und der Kontingenz, die sich nicht mehr auflösen lässt, die sich nicht mehr in Gestalt einer vorherbestimmten Zukunft irgendwann und irgendwie in Sicherheit verwandelt. Gesellschaften, die mit einem solchen Zeitwissen umgehen, müssen also Entscheidungen treffen, müssen Zeitbindungen eingehen – und dies ist eine Form des Umgangs mit der Zeit, die keineswegs selbstverständlich ist.[37]
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lässt sich verdeutlichen, warum und auf welche Weise eine Zeiten-Geschichte möglich und notwendig ist: Vergangenheiten und Zukünfte sind immer Unterscheidungen, die eine Gegenwart für sich trifft. Nur bleiben sich diese Unterscheidungen als Beobachtungen niemals gleich, sondern müssen immer wieder vollzogen werden. Dadurch ergeben sich beständig neue Zeitbindungen, immer neue Kombinationsmöglichkeiten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und damit auch immer neue Konstruktionsmöglichkeiten von Welt in temporaler Hinsicht. »Man könnte auch sagen: Die Zeiten ändern sich mit der Zeit. Bestimmte Begebenheiten in der Gegenwart können die Vergangenheiten und Zukünfte eines Systems total ändern.«[38] Die Frage, die insbesondere eine Zeiten-Geschichte umtreibt, muss dann lauten: Unter welchen Umständen ändert sich das Zeitwissen von Kollektiven? Mit welchen Konsequenzen geschieht dies? Wer ist daran beteiligt, wer kann dieses Zeitwissen beeinflussen? Und wie können die unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten und Zeithorizonte, die sich parallel zueinander ausbilden, koordiniert werden? Um sich dem komplexen Beziehungsgeflecht zu nähern, in das die Zeit eingebettet ist, muss die Zeit demnach selbst in eine zeitliche Perspektive gerückt werden – ist also eine Geschichte der Zeiten vonnöten.[39]
Das bedeutet aber auch, dass die differenz- und systemtheoretische Argumentation historisch und machttheoretisch angereichert werden muss. Öffnet der theoretische Blick die Augen für die Konstitution von Zeit als Form sozialer Sinngebung, lässt er nähere Erkenntnisse über die Instrumentalisierung von Zeit im gesellschaftlichen Mit- und Gegeneinander ebenso vermissen wie über den Einsatz von Zeit im Rahmen politischen Handelns, ganz zu schweigen von der historischen Spezifizierung konkreter Umgangsweisen mit Zeit. Damit stünde nicht nur die Frage im Mittelpunkt, welche Vorstellungen von und Umgangsweisen mit Zeit zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt vorherrschten und wie durchaus unterschiedliche Vorstellungen von Zeit parallel zueinander existierten, sondern es gilt auch dem Problem auf den Grund zu gehen, welche Auswirkungen diese Formen des Zeitwissens hatten. Denn wenn es einem Zeitwissen erst einmal gelungen ist, sich diskursiv zu verfestigen, also bestimmte Formen des Wahren und des Wirklichen auszubilden,[40] dann muss ihm historische Wirkmächtigkeit zugebilligt werden. Und an eben dieser Stelle wird es historisch interessant.