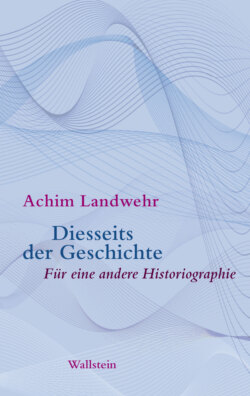Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pluritemporalität
ОглавлениеBevor aus zeittheoretischer Warte die Modalisierung von Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft mitsamt ihren Transformationen allzu dominant in den Vordergrund rückt und bevor mit Blick auf Zeiterfassungssysteme die Naturalisierung von Zeit allzu hoch veranschlagt wird – unbenommen der Tatsache, dass beide Bereiche von fundamentaler Bedeutung sind –, gilt es noch eine andere Perspektive starkzumachen: Ich möchte für eine (historische) Behandlung von Zeit argumentieren, die Pluritemporalität nicht nur ernst nimmt, sondern die deren konkrete Ausformungen und jeweiligen Auswirkungen auch angemessen zur Geltung bringt. Was soll das bedeuten: Pluritemporalität? Nun, es ist die sicherlich nicht allzu gewagte These, dass soziale Gruppen, Objekte, Ereignisse usw. zumindest potentiell dazu in der Lage sind, eigene Zeitformen auszubilden, die von anderen teils erheblich differieren können. Pluritemporalität bezeichnet den methodischen Zweifel an der irreführenden Idee, wir hätten es nur mit einer einzigen Form der Zeit zu tun, die mit der Zeit der Uhren und Kalender zur Deckung zu bringen wäre. Gesellschaften leben nicht im Kokon eines monolithischen Zeitregimes, kennen also nicht nur eine singuläre Form der Gleichzeitigkeit, sondern pflegen zahlreiche, parallel zueinander bestehende Zeitformen, existieren also in einer Welt der Vielzeitigkeit.[48]
Zu der Einsicht, dass wir es in einer jeweiligen Gegenwart mit einer sehr großen Anzahl unterschiedlicher Formen des Zeitwissens zu tun haben, kann man bereits gelangen, wenn man – gänzlich unbeleckt von zeittheoretischen Debatten – die Augen offen hält für das gesellschaftliche Mit- und Gegeneinander, das um einen herum vor sich geht. Dann wird man in der Tat feststellen, dass nicht alle in derselben Zeit leben. Man könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, die eigene Zeit als die einzig vernünftige und maßgebliche zu apostrophieren; man könnte sich von dieser Beobachtung aber auch auf heilsame Art und Weise verunsichern lassen und die Frage stellen, wo denn diese vielen unterschiedlichen Zeiten herkommen, wie es gesellschaftlichen Gruppen dennoch gelingt, sich temporal zu koordinieren, und ob es tatsächlich eine Zeit gibt, die von sich behaupten kann, die eine Zeit zu sein. Dieses Phänomen der Gleichzeitigkeiten, also der Vielzahl der Zeiten in einer Gegenwart, soll hier unter dem Stichwort der Pluritemporalität gefasst werden.
Allerdings ist es kein Schaden, diese Position geschichtstheoretisch noch weiter auszuloten. Denn wenn wir es in unterschiedlichen menschlichen und nicht-menschlichen Systemen mit der Pluralität und Parallelität von Zeiten zu tun haben,[49] dann hat dies auch Auswirkungen auf geschichtswissenschaftliche Erklärungsmodi. Nimmt man diese Voraussetzung ernst, dann wird es immer weniger möglich, historische Vorgänge auf unilineare Prozesse zurückführen oder in epochale Zwangsjacken stecken zu wollen. Unter der Perspektive pluraler Gleichzeitigkeiten findet man zu ein und derselben Zeit historische Bestandteile, die sich in reversiblen, systemerhaltenden Zeitschleifen befinden, neben solchen, die einen irreversiblen Zeitsprung vollziehen.[50] Der Ansatz der Pluritemporalität ist also in der Lage, das Spannungsverhältnis von Stabilität und Transformation in einer spezifischen historischen Situation in den Blick zu nehmen, ohne diese Parallelität vorschnell wegzuerklären oder doch wieder auf einen einfachen Nenner zu bringen. Die geschichtswissenschaftliche Aufmerksamkeit müsste vielmehr der Frage gelten, welches Zeitwissen sich in einer bestimmten Gegenwart eher durch Stabilität, welches sich eher durch Variabilität auszeichnet. Weiterhin wäre nicht nur zu fragen, welche Zeiten parallel zueinander Bestand haben, sondern vor allem, in welchen Wechselverhältnissen sie zueinander stehen, ob sie völlig unabhängig voneinander existieren können, sich gegenseitig affizieren oder in Konkurrenz zueinander treten, ob sich ein hierarchisches Verhältnis ausmachen lässt und wieweit es den historischen Akteuren möglich ist, zwischen verschiedenen Formen des Zeitwissens zu wechseln.
Nur nebenbei sei angemerkt, dass der Ansatz der Pluritemporalität kein neuer Aufguss eines geschichtswissenschaftlich kalten Kaffees ist. Denn im Gegensatz zu sozialwissenschaftlichen oder anthropologischen Untersuchungen[51] werden solche Überlegungen im Rahmen der Geschichtswissenschaften nicht nur kaum verfolgt, sondern sind auch durch Ansätze wie Braudels berühmte Differenzierung unterschiedlicher Formen historischer Dauer (unter anderem der bekannten longue durée) nicht abgedeckt. Braudels Konzept hat gerade nicht die Pluralität von Zeiten im Blick, wie seine Ausführungen ausreichend belegen. Es beginnt schon auf der Wortebene, denn Braudel spricht nicht von historischen Zeiten (temps), sondern von unterschiedlichen Formen der Dauer (durées) – man könnte auch treffender von Tempi reden. Es geht Braudel explizit nicht um unterschiedliche Formen soziokultureller Verzeitung, sondern um unterschiedliche Geschwindigkeiten im Rahmen des einen, prozesshaft organisierten Zeitstrahls. Er betreibt nahezu eine Ontologisierung der Zeit, wenn er schreibt: »Für den Historiker dagegen beginnt und endet alles mit der Zeit, einer mathematischen, demiurgischen Zeit, über die man leicht lächeln kann, einer den Menschen äußerlichen, ›exogenen‹ Zeit, wie die Ökonomen sagen würden, die uns antreibt, zwingt und unsere privaten, unterschiedlich gearteten Zeiten in ihrem Strom mit fortreißt – mit einem Wort: der die ganze Welt beherrschenden Zeit.«[52]
Demgegenüber Pluritemporalität in den Mittelpunkt zu rücken, hat einen gewissen Reiz, weil sie insbesondere in der historischen Darstellung neue Formen der Komplexität zum Vorschein bringt. Denn im Rahmen einer Zeiten-Geschichte muss man feststellen, dass neue Zeitvorstellungen alte nicht einfach ersetzen, sondern viel häufiger zu diesen hinzutreten, sie möglicherweise auch beiseite drängen, aber kaum einmal endgültig zum Verschwinden bringen. Die Geschichte der Zeiten hat also eher kumulativen Charakter. Wenn alte Zeitmodelle verschwinden, dann nicht, weil sie durch jüngere, bessere ersetzt worden wären, sondern weil sie ihre soziale Funktion verloren haben. Häufig werden sie aber neben anderen Formen des Umgangs mit Zeit weiterbestehen oder sich auch mit jüngeren Zeitmodellen vermischen.[53]
Das konkrete forschungs- und vor allem darstellungspraktische Problem bei der Behandlung von Pluritemporalität besteht darin, sie tatsächlich in den Griff zu bekommen. Wie kann man vermeiden, die üblichen unlinearen Geschichten der Zeit zu schreiben? Eine Möglichkeit, um Pluritemporalität in den Mittelpunkt zu rücken und damit überhaupt zum Gegenstand zu machen, kann durch die Konzentration auf Zeitpraktiken gelingen.