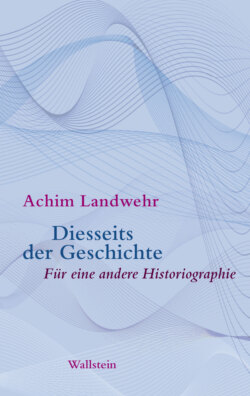Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Provinzialität von Geschichte
ОглавлениеEs ist aber gerade dieses In-Beziehung-Setzen mit der Vergangenheit beziehungsweise den vielen Vergangenheiten, das eine bereits angedeutete Ebene des Problems aufruft. Gerade weil es nicht mehr zu gelingen scheint, die Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit auf einen eindeutigen narrativen Nenner zu bringen, muss der Kollektivsingular Geschichte in Gänze in Zweifel gezogen werden. Es genügt eben nicht mehr, Reparaturen an diesem Modell vorzunehmen, es zu optimieren und an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Denn diese aktuellen Verhältnisse sind eben durch Verunsicherungen und Infragestellungen geprägt, die es verbieten, das Altbekannte in einer neuen Hülle als Lösung der Probleme anzubieten. In Zeiten religiöser oder ideologischer Weltbestimmungen gab es noch Angebote, um die langen historischen Linien zu ziehen. Aber diese großen Erzählungen haben schon seit geraumer Zeit ausgedient. Und selbst Jean-François Lyotard, der Schöpfer des Schlagworts vom Ende der großen Erzählungen, hat schon festgestellt, dass das Ende der großen Erzählungen auch schon wieder eine große Erzählung sei.[10]
Die größte aller großen Erzählungen ist aber ›die Geschichte‹ selbst. Der Kollektivsingular transportiert immer noch das Versprechen der Orientierung, der Identitätsbildung, der Absicherung, des tragenden Fundaments. Diese Zuschreibungen sollten ›der Geschichte‹ als einem angenommenen singularischen Superprozess nicht nur wegen der bereits genannten theoretischen Unzulänglichkeiten entzogen werden. Darüber hinaus ist die Vorstellung von einem Kollektivsingular Geschichte auch unzulänglich, weil sie Produkt eines europäischen Provinzialismus ist. Auch wenn diese Idee im Zusammenhang einer kolonialistischen und imperialistischen Dominanz Europas ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten hat und auch wenn diese Idee in bestimmten Kontexten durchaus produktiv wirken konnte, sind doch schon seit Längerem ihre Grenzen und Probleme offensichtlich. Denn die Verunsicherungen, Irritationen, Desorientierungen und Schwierigkeiten bei der Beschreibung unserer Welt rühren nicht zuletzt daher, dass es unter anderem der Kollektivsingular Geschichte ist, der uns bestimmte Denk- und Beschreibungsformen vorgibt, die so manches als undenkbar erscheinen lassen. Insbesondere bei der Berücksichtigung anderer, nicht europäischer Formen der Welterfassung und der Zeitorganisation wird die Begrenztheit dieses Modells von Geschichte deutlich. (Und bereits meine etwas hilflose Negativbezeichnung des ›Nicht-Europäischen‹ zeigt an, wie schwierig es ist, außerhalb der vorgebahnten Wege zu denken und zu schreiben, wenn sich dieses Außerhalb noch nicht einmal umstandslos positiv bezeichnen lässt.)
Man kann nicht nur feststellen, dass der Kollektivsingular Geschichte die ihm zugewiesene Aufgabe nicht mehr recht zu übernehmen vermag, sondern man muss vor allem feststellen, dass diese Idee von ›Geschichte‹ eine letztlich europäische Beschreibungs- und Erklärungsweise ist, die ihren Ursprungsort nicht zu verbergen vermag. Die Provinzialität von ›Geschichte‹ muss überwunden, der Kollektivsingular abgeschafft werden, um stattdessen die Vielfalt der Zeiten anzuerkennen. Was nicht mehr hinreichen kann, ist die endlose Wiederholung linearer und homogener Geschichtserzählungen, die ihre vermeintlich wissenschaftliche Unschuld (üblicherweise als Objektivität und Neutralität bezeichnet) schon längst verloren haben. Sie sind schon vor geraumer Zeit entlarvt worden als europäisch-westliche Erzählungen mit einem teleologischen Zuschnitt, der sich überhaupt nicht vermeiden lässt, solange diese Erzählungen auf Modellen von Zeit und Geschichte aufruhen, die nun einmal in dieser europäisch-christlichen Welt hervorgebracht wurden
Mein Ziel ist es nicht, eine neue Gewissheit zu versprechen. Ziel ist es eher, Bearbeitungs- und Beschreibungsformen für das Ungewisse zu finden. Wird Geschichtsschreibung üblicherweise die Aufgabe zugewiesen, über das Seiende und vor allem das Gewesene zu versichern, möchte ich mich dafür starkmachen, die Verunsicherung weiterzutreiben, um zu neuen Auffassungen über die Welt in ihrer zeitlichen Konstituierung zu gelangen.[11]
Auch wenn es gewöhnungsbedürftig erscheinen mag, aber das Leben mit der Ungewissheit, mit der Unsicherheit, mit dem Unwägbaren ist durchaus begrüßenswert. Es geht dabei nicht um eine nachholende, selbst auferzwungene Naivität. Es geht nicht darum, nun an die Stelle von ›der Geschichte‹ die vielen kleinen Geschichten zu setzen, die gänzlich zusammenhangslos durcheinanderpurzeln. Es genügt also nicht, zu sagen, was man nicht mehr haben möchte. Es ist vielmehr deutlich zu machen, was an die Stelle des Kollektivsingulars treten soll.
Es ist richtig, wir brauchen nicht nur eine weitere alternative Geschichte, sondern wir brauchen eine Alternative zur Geschichte.[12] Aber das Ergebnis wird immer noch eine zu erzählende Geschichte (story) sein, wenn auch keine, die auf einem vorausgesetzten Kollektivsingular namens ›Geschichte‹ (history) beruht. Daher brauchen wir eine andere Geschichtsschreibung, um uns von ›der Geschichte‹ befreien zu können.
Die kritische Sicht auf den Kollektivsingular geht mit einer produktiven Seite einher. So spreche ich einerseits von einer negativen Geschichtstheorie. Denn man müsste, wollte man ›die Geschichte‹ als irgendwie sinnstiftende Gesamteinheit tatsächlich erfassen, außerhalb dieser Geschichte stehen. Weil das bisher aber noch niemandem gelungen ist, darf man auch berechtigten Zweifel an der Existenz des Kollektivsingulars anbringen. Das bedeutet nun keineswegs, das Vergangene oder die geschehenen Geschehnisse zu bezweifeln – es bedeutet eher, aus dem Kollektivsingular einen Kollektivplural zu machen, ein äußerst komplexes Gebilde von Vorgängen in der Zeit und Beschreibungen von der Zeit, die nicht gewillt sind, in einer eurozentrisch und damit auch chronozentrisch gedachten Einheit aufzugehen. Eine solche Geschichtstheorie ist also nicht negativ, weil sie Historisches ablehnen würde, sondern weil sich das Historische höchstens über den Weg der ausschließenden Negation bestimmen lässt – das aber niemals abschließend. Eine negative Geschichtstheorie sagt zwar, dass es ›die Geschichte‹ (als Kollektivsingular) nicht gibt, fragt aber zugleich, wie das Historische gegeben ist.
Weil also die Rede von ›der Geschichte‹ in dieser singularischen Form zu dem Eindruck führen kann (und nicht selten genug führt), es gäbe dieses bezeichnete Ding tatsächlich, spreche ich andererseits vom Historischen. Dieses substantivierte Adjektiv weist nicht auf ein konkretes Etwas dort draußen hin, sondern auf ein Konglomerat aus Eigenschaften, die Kollektive bestimmten Phänomenen ihrer Wirklichkeit zuweisen – Eigenschaften, die etwas mit dem Vergangenen zu tun haben und die Vergangenes konstituieren. Daraus resultiert aber noch kein in sich geschlossener Gesamtzusammenhang, sondern zunächst einmal die Einsicht in das menschliche Dasein als ein zeitliches.
Um die Offenheit und Vielfältigkeit dieser zeitlichen Existenz zu bewahren und nicht unter einem Kollektivsingular zu begraben, müssen wir die Geschichte zermalmen, um das Historische zu gewinnen. Écrasez l’histoire! Gagnez l’historique! An die Stelle der Transzendenz eines Kollektivsingulars Geschichte muss die Immanenz des Historischen treten. Bleiben wir diesseits der ›Geschichte‹. Nehmen wir nicht eine gottersatzartige Totalität namens ›Geschichte‹ an, der als allumfassender Gesamtheit alles zum Fraß vorgeworfen wird, was es gibt und was geschieht, sondern betrachten wir die zeitlichen Relationierungen, die Verbindungen zu Vergangenheiten, Zukünften, Ewigkeiten, Jenseitigkeiten (als Jenzeitigkeiten) und vielen anderen Zeiten, um der Vielfalt unseres zeitlichen Daseins zumindest einigermaßen gerecht zu werden.