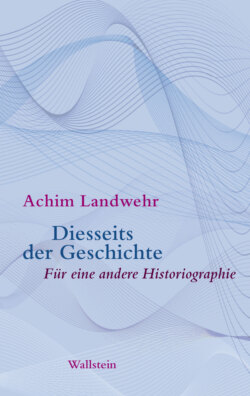Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie spät ist es, und wenn ja, wie oft?
ОглавлениеWenn man im Zuge einer Theoretisierung und Historisierung der Zeit zu dem Schluss kommen sollte, diese Zeit nicht als etwas Absolutes zu begreifen, sie nicht stetig und gänzlich unabhängig von äußeren Einflüssen verstreichen zu lassen, sondern sie viel eher als kulturelles Konstrukt zu verstehen – bedeutet das im Umkehrschluss dann nicht, dass es außerhalb kultureller Kontexte keine Veränderung, kein Entstehen und kein Vergehen der Dinge gibt? Wohl kaum. Zu offensichtlichem Unsinn lädt eine solche Position nicht zwangsläufig ein. Vielmehr soll mit dem Verständnis von Zeit als kulturellem Konstrukt zum Ausdruck gebracht werden, dass die Art und Weise, wie man die Tatsache von Veränderung und die Erfahrung von Dauer jeweils individuell und gesellschaftlich deutet, alles andere als naturnotwendig ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie gar nicht ist.
Das wird deutlich, wenn man sich die Entstehung von Zeitwissen in westlichen Gesellschaften etwas näher besieht. Dauer wird erlebbar, wenn man die gegenwärtige Situation zu vergangenen Erfahrungen und künftigen Erwartungen in Beziehung setzt.[21] Da es keinen Hinweis darauf gibt, dass dem Menschen ein spezifischer Sinn für die Zeit eigen ist, muss die Fähigkeit, Erwartungen zu haben, erst allmählich erlernt werden.[22] Wenn ein kleines Kind Hunger hat, das Hungergefühl durch Schreien zum Ausdruck bringt, macht es in der Zeitspanne bis zur Befriedigung dieses Bedürfnisses erste Erfahrungen der Dauer. Die relativ lange Phase, in der ein Kind das Laufen erlernt, scheint für die Entstehung des Zeitbewusstseins von großer Bedeutung zu sein. Wünsche des Kindes, die nicht erfüllt werden können, weil es die entsprechenden Objekte nicht erreichen kann, lassen eine erste Vorstellung von Zeit entstehen. Schon diese frühen Erfahrungen der Zeit sind mit der Wahrnehmung einer räumlichen Distanz gekoppelt. Dauer konkretisiert sich in dem Abstand zwischen dem Kind und der Erfüllung seiner Wünsche.
Konkret nachvollziehbar wird die kulturelle Konstruktivität von Zeitvorstellungen durch die enge Kopplung, die Zeit und Sprache miteinander eingehen. Zeit muss nämlich erlernt werden, und der Fortschritt in diesem Lernprozess wird auf sprachlicher Ebene deutlich. Bis zum Alter von 18 Monaten ist einem Kind die Bedeutung von ›jetzt‹ geläufig. Noch bis zum Alter von 30 Monaten scheinen Kinder vor allem in der Gegenwart zu leben, denn auch wenn weitere Wörter hinzukommen, die sich auf die Zeit beziehen, so haben die meisten doch mit dem Hier und Jetzt zu tun. Es lassen sich aber auch erste Wörter mit Bezug auf die Zukunft wie ›bald‹ feststellen, während die Vergangenheit noch so gut wie keine Rolle spielt.
Mit dem Erwerb der Sprache erhöht sich die Fähigkeit des Kindes, zeitliche Relationen zu begreifen und temporale Begriffe zu entwickeln. Denn auch wenn die persönliche Erfahrung von Dauer schon recht früh einsetzt, so beruht das in westlichen Gesellschaften vorherrschende Modell von Zeit auf einem recht abstrakten begrifflichen Bezugssystem, das erst mühsam erlernt werden muss. Erst im Alter von etwa acht Jahren gelingt es dem Kind, Beziehungen zwischen einem konkreten Davor und einem Danach mit einer allgemeinen Zeitdauer zu assoziieren, so dass die Vorstellung einer einzigen allgemeinen Zeit entstehen kann, in der alle Ereignisse stattfinden.
Als nun das Haus leer war und die Türen abgeschlossen waren und die Matratzen eingerollt, kamen jene schweifenden Lüfte, Vorhut gewaltiger Armeen, hereingefegt, streiften nackte Dielenbretter, nagten und fächelten, trafen in Schlafzimmer oder Salon auf nichts, das ihnen ungeteilten Widerstand bot, sondern nur auf Tapeten, die flatterten, Holz, das knarzte, die nackten Beine von Tischen, Kasserollen und Porzellan, die bereits von einem Belag überzogen, angelaufen, gesprungen waren. Was die Menschen abgelegt und zurückgelassen hatten – ein Paar Schuhe, eine Jagdmütze, ein paar ausgeblichene Röcke und Jacken in Schränken –, sie allein wahrten die menschliche Gestalt und ließen bei aller Leere erkennen, wie sie einst ausgefüllt und von Leben erfüllt gewesen waren; wie einst Hände sich mit Haken und Knöpfen zu schaffen machten; wie einst der Spiegel ein Gesicht enthalten hatte; einst eine ausgehöhlte Welt enthalten hatte, worin eine Gestalt sich drehte, eine Hand aufblitzte, die Tür sich auftat, Kinder hereingestürzt und -getollt kamen; und wieder hinausgingen. Jetzt warf tagaus tagein das Licht, wie eine im Wasser gespiegelte Blume, sein helles Bild an die gegenüberliegende Wand. Nur die Schatten der Bäume, die im Winde groß taten, neigten das Haupt an der Wand und verdüsterten für einen Augenblick den Teich, worin das Licht sich spiegelte; oder Vögel, wenn sie flogen, ließen einen weichen Fleck langsam über die Schlafzimmertür flattern.
(Virginia Woolf: Zum Leuchtturm)[23]
Eine solch grobe Beschreibung der Entwicklung des Zeitbewusstseins hat zunächst nur für Kinder westlicher Gesellschaften Gültigkeit. Bei der Untersuchung der Zeitvorstellungen von Kindern in Uganda wurde beispielsweise festgestellt, dass sie die Dauer eines Vorgangs wesentlich schlechter schätzen konnten als gleichaltrige Kinder westlicher Gesellschaften. Eine zweistündige Busfahrt wurde mal auf zehn Minuten, mal auf sechs Stunden veranschlagt. Die Kinder australischer Aborigines tun sich schwer im Umgang mit der Uhr. Es mangelt ihnen – ebenso wie den ugandischen Kindern – nicht an intellektuellen Fähigkeiten. Auch haben wir es nicht mit dem wenig überzeugenden Argument unterschiedlicher Grade der ›Entwicklung‹ zu tun, sondern vor allem mit differenten Zeitmodellen. Während Kinder westlicher Gesellschaften die Uhr mit sechs oder sieben Jahren zu benutzen vermögen, gelingt es Aborigines-Kindern nur, die Zeiger der Uhr als eine Art Gedächtnisübung zu lesen, sie können die Angaben aber nur schwer mit der tatsächlichen Tageszeit in Beziehung setzen. Für sie existieren andere Formen der Relationierung zwischen ihrer soziokulturellen Umgebung und Veränderungsprozessen mittels Zeitmodellen.[24]
Man muss also kaum größeren argumentativen Aufwand betreiben, um zu der Einsicht zu gelangen, dass die Zeit etwas Gemachtes, nicht etwas Gegebenes ist. Trotzdem gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass die Idee von der Zeit als einer vorgegebenen und dem Menschen äußerlichen Realität in und für die Moderne sehr wirkmächtig war und deren Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Die astronomische Zeit wurde mit dem naturwissenschaftlichen Paradigma in mathematischen und physikalischen Begriffen definiert. Dadurch wurde die Zeit ihres historischen und soziokulturellen Charakters entkleidet und zu einer Naturtatsache stilisiert. Dieses Denken ging (und geht) grundsätzlich davon aus, dass die Zeit der Praxis vorgängig ist, dass sich die Praxis in die Rahmung der Zeit einzufügen hat. Doch schon seit Längerem ist sichtbar, wie wichtig der Standpunkt handelnder Akteure auch und gerade im Umgang mit der Zeit ist. Zumindest mittelbar dürften dafür die Vorgänge der Jahre 1989/90 mit verantwortlich sein, weil dieser Erfahrungsbruch deutlich vor Augen geführt hat, wie gestaltbar und beeinflussbar ›Geschichte‹ ist – und wie sehr sich die Zeiten mit der Zeit verändern. Zeit erweist sich mithin als soziokulturelles Produkt, als Ergebnis einer Praxis, die man ›Verzeitlichung‹ nennen könnte. Die soziale und kulturelle Praxis ist also nicht in der Zeit, sondern macht die Zeit.[25]
Aber gerade anhand des weiterhin dominierenden Verständnisses von Zeit als einer äußerlichen, vorgegebenen Kategorie lässt sich aufzeigen, dass etablierte und schematisierte Trennungen zwischen Kultur und Natur zuweilen allzu vereinfachend daherkommen. Denn bei allen etablierten Formen, Zeit zu messen, zu berechnen und zu deuten, handelt es sich um ausschließlich kulturelle Leistungen – Leistungen allerdings, deren Daten durch die Natur (oder auch durch ›die Geschichte‹) vorgegeben werden. Zeitbestimmungen sind deswegen objektivierbar, weil sie aufgrund ihrer astronomischen Vorfindlichkeit in Form von Sonnen- und Mondumlauf, Tag- und Nachtwechsel, Jahreszeiten oder planetarischen Konstellationen allen Menschen in gleicher Form zugänglich sind. Jedoch weisen die jeweiligen Ausformungen, mit denen Zeit bemessen und in Genealogien, Chronologien, Kalendern oder Uhren zur Darstellung gebracht wird, große kulturelle Unterschiede auf.[26]
Nun könnte man versuchen, aufgrund solcher Einsichten und mittels verbesserter oder gar neuer Zeitmodellierungen gerade das historische Fragen neu zu justieren – allerdings immer auf die Gefahr hin, dass solche behutsamen Verschiebungen im geschichtswissenschaftlichen Alltag verschwinden. Die Auseinandersetzung mit ›der Zeit‹ – was auch immer das letztlich sein mag – ist aber zu bedeutsam, um sie einer konzeptionellen Kosmetik zu überlassen. Nötig ist daher eine geschichtswissenschaftliche Selbstbefragung, mit der das historische Projekt grundsätzlich auf andere Fundamente gestellt wird.
Denn selbst wenn man bereit ist, Zeit als Konstrukt zu verstehen, gilt es, diese Einsicht auch selbstreflexiv einzusetzen. Wenn in den Wissenschaften von der Konstruktion von Zeit die Rede ist, dann sind üblicherweise ›die Anderen‹ damit gemeint, also immer die Objekte der jeweiligen wissenschaftlichen Behandlung. Dabei wird zuweilen jedoch übersehen, dass die Wissenschaften selbst in der Beschäftigung mit der Zeit daran beteiligt sind, Konstruktionen von Zeit zu erstellen – dass sie selbst also ›die anderen Anderen‹ sind. Und wenn man sich deren Zeitentwürfe etwas näher besieht, dann fällt ein gemeinsames Merkmal auf: Zahlreiche dieser (auch theoretisch fundierten) Zeitkonzepte sind binär strukturiert, arbeiten mit Gegensätzen.[27] Die Trennlinie zwischen zwei oppositionell konzipierten Arten von Zeit hält sich als immer wiederkehrendes Moment durch: besonders häufig in Form der zyklischen und linearen Zeit, wie es seit Augustinus bei vielen Zeittheoretikern auftaucht, als sakrale und profane Zeit, beispielsweise bei Mircea Eliade,[28] als kalte und heiße Kulturen mit entsprechenden Zeitorientierungen bei Claude Lévi-Strauss,[29] als Erfahrungsraum und Erwartungshorizont bei Reinhart Koselleck,[30] als Weltzeit und Lebenszeit bei Hans Blumenberg[31] oder eben auch als A- und B-Serie der Zeit bei John McTaggart.
Wenn ich hier eine Position vertrete, die vor allem auf die Pluralität der Zeiten aufmerksam zu machen versucht,[32] dann bin ich mir selbstverständlich der Tatsache bewusst, dass es sich nicht um eine ›bessere‹ oder gar ›realitätsgetreuere‹ Sichtweise auf das kulturelle Phänomen der Zeit handelt. Aber es ist zumindest der Versuch einer anderen (wissenschaftlichen) Konstruktion von Zeit, die eine veränderte Sichtweise auf das Phänomen erlauben sollte. Mit dem Entwurf einer Vielzeitigkeit, einer Pluritemporalität, soll erstens vermieden werden, vorschnell eine Abfolge unterschiedlicher Zeitmodelle anzunehmen (z. B. die Ablösung einer zyklischen Zeit durch eine lineare), und zweitens soll die nicht hinreichend komplexe Binarität solcher Entgegensetzungen überwunden werden.[33] Dass zum Beispiel die Rede vom Ende der großen Erzählungen[34] selbst schon wieder eine große Erzählung ist,[35] hatte bereits Jean-François Lyotard selbst festgestellt. Wie aber diese andere große Erzählung nach den liberalen und marxistischen Fortschrittsgeschichten aussehen und erzählt werden könnte, ist bisher nicht wirklich klar. Ein empirisch fundierter und sozial wie kulturell ausreichend weitschweifender Blick sollte in diesem Zusammenhang zeigen können, dass es innerhalb ein und desselben Zeitraums sehr vielfältige Möglichkeiten gibt, mit Zeit umzugehen.
Daß Orlando sich ein wenig zu weit vom Augenblick der Gegenwart entfernt hatte, wird vielleicht dem Leser auffallen, der nun sieht, wie sie Anstalten macht, in ihr Automobil einzusteigen, die Augen voller Tränen und Visionen von persischen Bergen. Und in der Tat läßt sich nicht leugnen, daß die erfolgreichsten Betreiber der Kunst des Lebens, übrigens oftmals gänzlich unbekannte Menschen, es irgendwie fertigbringen, die sechzig oder siebzig verschiedenen Zeiten zu synchronisieren, die gleichzeitig in jedem menschlichen Organismus ticken, so daß, wenn es elf schlägt, der ganze Rest einstimmig einfällt und die Gegenwart weder eine gewaltsame Unterbrechung ist noch vollständig in der Vergangenheit vergessen. Von ihnen können wir mit Fug und Recht sagen, daß sie genau die achtundsechzig oder zweiundsiebzig Jahre leben, die ihnen auf dem Grabstein zugeschrieben werden. Bei den übrigen wissen wir von einigen, daß sie tot sind, obwohl sie unter uns wandeln; einige sind noch nicht geboren, obwohl sie die Formen des Lebens durchlaufen; andere sind Hunderte von Jahren alt, obwohl sie sich als sechsunddreißig bezeichnen. Die wahre Länge eines Menschenlebens ist, ungeachtet dessen, was das Dictionary of National Biography sagen mag, immer eine strittige Angelegenheit. Denn es ist ein schwieriges Geschäft – dieses Zeitmessen; nichts bringt es schneller aus der Ordnung als der Kontakt mit einer der Künste.
(Virginia Woolf: Orlando)[36]
Eine solche Aufmerksamkeit für Pluritemporalität wäre nicht einfach nur eine nette gedankliche Spielerei, um ›die Dinge auch einmal anders sehen‹ zu können, sondern wäre eine Voraussetzung dafür, dem unilinear-homogenen Zeitmodell einen gefährlichen Stachel zu ziehen. Jacques Rancière beispielsweise hat dominierende, singuläre Modelle von ›der Zeit‹ und ›der Geschichte‹ als Substitute für eine verlorene Ewigkeit kritisiert. Immer gehe es um eine Fundierung der Wahrheit in der Zeit, wobei dieses Verhältnis als ein eindeutiges vorausgesetzt werde. Die vielen beobachtbaren Zeiten und Zeitpraktiken werden immer wieder als eine einheitliche Zeit konzipiert, werden alle unter ein gemeinsames Dach einer überwölbenden Zeit gestellt. Doch damit geht laut Rancière nicht nur eine Simplifizierung der tatsächlich herrschenden Zeitverhältnisse einher, vielmehr hat dies erhebliche geschichtstheoretische Auswirkungen. Denn letztendlich wird damit ebenso vorausgesetzt, dass die Wahrheit der Geschichte der Zeit und ihrer Einheitlichkeit immanent ist. Durch die Kopräsenz der Phänomene und die unterstellte Gleichzeitigkeit des historischen Prozesses offenbart sich die historische Wahrheit in ihrer Zeitlichkeit. Damit hätten wir – folgen wir Rancière weiter – in der Tat eine säkularisierte Variante von traditionell religiösen Ewigkeitsvorstellungen vorliegen.[37]
Einheitlichkeit, Ewigkeit und Geschichte stehen also auch und gerade in neuzeitlichen historischen Konzepten immer noch im Mittelpunkt. Insofern wäre nicht nur eine Anerkennung, sondern vor allem eine Konzipierung von Vielzeitigkeit eine echte Herausforderung – nicht nur an geschichtswissenschaftliche Grundlagen, sondern an Denkmodelle und -gewohnheiten, die weit darüber hinausgehen. Es genügt also nicht, auf das Bestehen unbezweifelbarer äußerer Faktoren hinzuweisen, an denen sich ›Zeit‹ fixieren ließe – hörten diese nun auf den Namen Erdrotation, Mondumlauf, Irreversibilität oder zweiter Hauptsatz der Thermodynamik –, und davon das subjektive, innere Erleben von Zeit zu unterscheiden. Vielmehr müssen die zahlreichen Wechselwirkungen in den Blick genommen werden, die sich aus dieser – hier sehr holzschnittartig beschriebenen – Situation ergeben, um dadurch das ›Zwischen‹ thematisieren zu können. Auch und gerade die dualistische Entgegensetzung von Vergangenheit und Gegenwart kann nicht hinreichen, sondern müsste einer Behandlung der Relationierung von anwesenden und abwesenden Zeiten weichen.