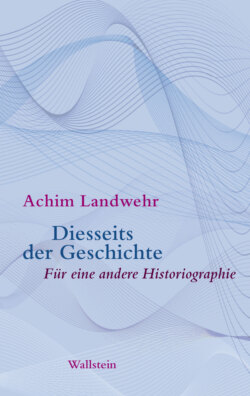Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frühe Neue Zeiten
ОглавлениеIch möchte mit einem etwas spezielleren Blick auf mein Forschungsgebiet, die so genannte Frühe Neuzeit, also die europäische Geschichte in etwa zwischen dem 15. und dem frühen 19. Jahrhundert, diese allgemeineren Ausführungen etwas konkretisieren,[41] und zwar in zwei Richtungen: Welche Formen des Zeitwissens haben sich in dieser Frühen Neuzeit etabliert und welche Perspektiven ergeben sich hieraus für eine Zeiten-Geschichte?
Mit Blick auf die Frühe Neuzeit festzuhalten, dass sich die Zeiten geändert haben, mag zunächst trivial anmuten. Schließlich sind Gesellschaften beständig damit beschäftigt, an ihren Zeitmodalisierungen zu arbeiten und diese zu verändern. Diese Umordnungen betreiben alle Kollektive beständig in einem mehr oder weniger großen Umfang. Es bestehen jedoch mehr als nur ein paar Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass sich in der Frühen Neuzeit Entscheidendes hinsichtlich der Emergenz temporaler Modalisierungen getan hat, und zwar in einer Art und Weise, die bisher noch nicht ausreichend gewürdigt worden ist.
Die standardisierte Antwort auf die Frage, warum und auf welche Weise die Frühe Neuzeit für den Wandel von Zeitwissen von Bedeutung ist, lautet, dass sich im sogenannten Zeitalter der Aufklärung – man möchte fast schon sagen: endlich! – das Modell einer offenen Zukunft entwickelt habe und man sich in Europa damit von traditionellen, vor allem religiös dominierten Zeitmodellen verabschiedet habe.[42] Ich möchte dem eine andere Hypothese entgegensetzen, die dahin geht, dass wir es im Verlauf des 17. Jahrhunderts mit einer deutlichen Aufwertung der Gegenwart zu tun haben. Diese zunehmende Bedeutung der zeitlichen Dimension Gegenwart führt in der Konsequenz dazu, dass die Autorität der Vergangenheit sank, ja, dass man sich in Form einer Historisierung von ihrer einstmaligen Übermächtigkeit abnabeln konnte und gleichzeitig die Gestaltbarkeit von Zukunft denkbar wurde. Diese Transformation – und das wäre der zweite Teil meiner Hypothese – war aber keineswegs monolithisch, sondern ging einher mit einer deutlichen Auffächerung der Zeitwissen (im Plural).[43]
Auch in anderen Hinsichten ist die Frühe Neuzeit ein neuralgischer Zeitraum für die Etablierung von spezifischen Formen des Zeitwissens. Die ungemein wirkmächtigen Medien des Kalenders[44] und der Uhr[45] erlebten ihren Aufstieg und prägten die Zeitvorstellungen in erheblichem und bis heute nicht nachlassendem Maß; die Auseinandersetzung um die Gregorianische Kalenderreform[46] wurde zu einem zentralen konfessionellen und politischen Streitpunkt; und nicht zuletzt spielte der Faktor Zeit im Rahmen der europäischen Expansion eine wichtige Rolle, wenn es beispielsweise um die Konstruktion einer entwicklungsmäßigen Vorrangigkeit, also um einen zeitlichen Vorsprung Europas vor dem Rest der Welt ging.[47]
Wenn also Zeit in einem funktionalen Sinn zu untersuchen ist, dann rückt die Frühe Neuzeit in das Zentrum des Interesses, weil hier unter anderem die Naturalisierung der Zeit, deren Zeugen und Fortführer wir heute noch sind, einen entscheidenden Anstoß erfahren hat. Diese Naturalisierung der Zeit wurde maßgeblich durch wissenschaftliche und politische Bemühungen vorangetrieben. Zeit wurde objektiviert und standardisiert, ihr instrumenteller Charakter aber zugleich weitgehend unsichtbar gemacht.
Doch ich will den Blick auf die Relevanz der Zeit in der Frühen Neuzeit nicht voreilig verengen, sondern die Untersuchungsmöglichkeiten in dreierlei Hinsicht öffnen. Erstens gilt es unter dem Stichwort der Pluritemporalität die Vielzahl der Zeiten zu bedenken, zweitens sollen die vielfältigen alltäglichen Umgangsweisen mit der Zeit angemessen in den Blick gerückt werden, bevor drittens die diskursive Ebene des Zeitwissens gewisse Syntheseleistungen deutlich werden lässt.