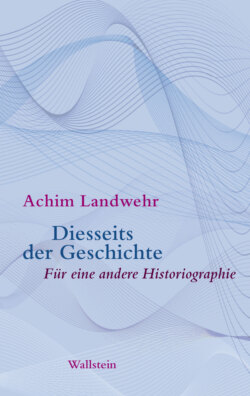Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kalenderzeit
ОглавлениеFeststellen lässt sich dies beispielsweise beim Blick auf die kalendarische Ordnung des Jahreslaufs. Die größere Ordnung des Kalenders an erster Stelle zu betrachten, hat dabei durchaus historischen Sinn, denn die Erfassung des Jahres und seine Untergliederung ist geschichtlich älter und bedeutender als die Messung von Stunde, Minute und Sekunde. Schließlich ist es in sehr vielen Kulturen, von denen wir historische Kenntnis haben, von entscheidender Bedeutung, den Lauf der Sterne zu beobachten und zu deuten.
Nun könnte man berechtigterweise einwenden, dass es sich gerade beim Kalender keineswegs um ein Konstrukt, um etwas vom Menschen Geschaffenes handele, schließlich sind Sonnen- und Mondumlauf, Tag- und Nachtwechsel, Jahreszeiten oder planetarische Konstellationen sehr konkrete und in der gegebenen Außenwelt vorfindliche Phänomene. Das ist fraglos zutreffend, und insofern hat jede Form der Zeiterfassung ihre gewissermaßen natürliche Grundlage. Keineswegs gegeben ist jedoch, was ein Kollektiv aus diesen Phänomenen macht und welche Bedeutungen es ihnen zuschreibt.[4]
Beginnen wir bei der Monatseinteilung. Die Grundlagen des europäischen Kalenders lassen sich bis zu den Babyloniern zurückführen und fanden von hier ihren Weg unter anderem in das Judentum und das antike Rom. Insbesondere anhand des Julianischen Kalenders, der unmittelbaren Vorgängerversion unseres heute noch gültigen Gregorianischen Kalenders, lässt sich zeigen, dass Fragen der Zeiteinteilung und der politischen Macht nahezu zwangsläufig eine enge Verbindung eingehen. Über die Zeitorganisation zu verfügen, ist Ausdruck und Stütze jeglicher Herrschaft.[5]
Unter Julius Cäsar wurde das Problem angegangen, dass sich zwischen dem Sonnenjahr, also der Dauer des Erdumlaufs um die Sonne, und dem bis dahin geltenden römischen Kalender eine Differenz von nicht weniger als 90 Tagen herausgebildet hatte. Eine Reform stellte einerseits ein praktisches Problem dar – war aber zugleich Ausdruck des Bewusstseins, dass ein Weltreich eine klare zeitliche Ordnung benötigte. Cäsar erkannte diese Notwendigkeit sehr wohl. Er beauftragte den Mathematiker und Astronomen Sosigenes von Alexandrien mit der Kalenderreform, die 46 v. Chr. vom Senat angenommen wurde. Zu den Prinzipien dieses Kalenders gehörte nicht nur, das Jahr am 1. Januar beginnen zu lassen, sondern es auch in 12 Monate mit jeweils 30 Tagen einzuteilen. Blieb ein Rest von fünf Tagen (mit einem weiteren Schalttag in jedem vierten Jahr), der nach dem Willen Cäsars nicht herrenlos und dem Nichtstun überlassen bleiben sollte. Also wurde dem Februar als dem bisherigen letzten Monat des Jahres ein weiterer Tag weggenommen, so dass die nun zur Verfügung stehenden sechs Tage auf jeden zweiten Monat verteilt werden konnten. Die Monate Januar, März, Mai, Juli, September und November erhielten 31 Tage, die anderen (abgesehen vom Februar) 30. Auch erhielten die Monate ihre bis heute (weitgehend) gültigen Bezeichnungen: Januarius, Februarius, Mars, Aprilis, Maia, Juno, Quintilis, Sixtilis, September, Oktober, November, Dezember. Zwei Jahre nach der Reform beschloss der Senat auf Vorschlag Marc Antons, den Schöpfer des neues Kalenders durch eine Umbenennung seines Geburtsmonats Quintilis in Julius zu ehren. Cäsars Erbe wollte dem allerdings nichts nachstehen: Kaiser Augustus benannte den Monat Sixtilis im Jahr 8 n. Chr. nach sich selbst. Um jedoch zu vermeiden, dass ›sein‹ Monat einen Tag weniger hatte als Cäsars Monat Juli, wurde dem Februar ein weiterer Tag genommen und dem August zugeschlagen, so dass auch dieser 31 Tage umfasste.[6]
Noch offensichtlicher wird die kulturelle Prägekraft hinsichtlich der Zeitorganisation bei der Kategorie der Sieben-Tage-Woche, die sich nun gerade nicht nach einem Naturphänomen richtet. Eine Wochenrhythmisierung aufgrund von sieben Tagen passt weder in das Monats- noch in das Jahresschema, so dass es hierdurch zu zusätzlichen Abstimmungsproblemen kommt. Entsprechend kennt die Geschichte der Zeiteinteilungen zahlreiche alternative Modelle von drei bis zehn Tagen. Insbesondere die Anwendung des Dezimalsystems hätte sich aufgrund einer gewissen Praktikabilität angeboten. Stattdessen setzte sich aber das Sieben-Tage-Modell durch, das uns so selbstverständlich erscheint, dass wir seine Willkürlichkeit kaum noch zu erkennen vermögen. Seine ältesten Spuren lassen sich bis zu den Babyloniern zurückverfolgen, welche die Tage nach den sieben Wandelsternen unter Einschluss von Sonne und Mond bezeichneten: Saturn, Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus. Dieses Modell verbreitete sich in der Folge nicht nur über Ägypten, Griechenland und Rom in den gesamten vorderasiatischen und europäischen Raum, sondern von dieser Einteilung beziehen die Wochentage bis heute in vielen Sprachen ihre Namen.[7]
Auch wenn der Julianische Kalender über Jahrhunderte hinweg im europäischen Kulturraum gültig blieb, erfuhr er doch erhebliche kulturelle Umdeutungen, vor allem durch das Christentum. Die Tatsache, dass die Zeit für europäische Gesellschaften eine solche Rolle spielen konnte und kann, wie es in Vergangenheit und Gegenwart zu beobachten ist, verdankt sich zweifellos dem Einfluss des Judentums und Christentums. Allein schon die Idee, sich das Werden der Menschheit als einen Vektor, als einen Zeitpfeil vorzustellen, ist zutiefst jüdisch-christlich. Da in christlich geprägten Gesellschaften das persönliche Schicksal des Religionsstifters als Präfiguration und Erfüllung des Schicksals der Menschheit gedeutet wird, muss auch die Geschichte dieser Menschheit folgerichtig als eine Biographie mit ihren Altersstufen, ihrem Wachstum und ihrem Niedergang gedacht werden.[8]
Von Zeittheorien im spezifisch europäischen Kontext kann man daher kaum sinnvoll sprechen, wenn man nicht zumindest in groben Zügen ihre christlichen Wurzeln im Auge behält. Die christliche Zeitvorstellung ist als Erbin der jüdischen Zeitauffassung ebenso wie diese geprägt durch eine charakteristische Hoffnung auf Erlösung. Die Geburt Jesu wurde dabei als zeitlicher Einschnitt verstanden, der die Geschichte nach christlicher Sichtweise in zwei Hälften teilte. Die Christen waren von Anfang an überzeugt, ihre Religion sei ein Ausdruck göttlichen Willens, weshalb ihrer Lehre auch universale Bedeutung zukommen musste. Der Kreuzigung Christi kam in diesem Zusammenhang der Status eines einmaligen und unwiederholbaren Ereignisses zu – ein Umstand, aus dem sich nahezu zwangsläufig ein lineares, nicht ein zyklisches Zeitmodell entwickeln musste. Eine solche historische Zeitauffassung mit ihrer Betonung der Unwiederholbarkeit von Ereignissen gehört zu den zentralen Bestandteilen des Christentums.[9] Neben dieser kulturellen Überformung besteht der wichtigste Beitrag des Christentums in zeitorganisatorischer Hinsicht in der Markierung der Geburt Christi als chronologischer Nullpunkt, nach dem sich die gesamte welthistorische Jahreszählung richtete. Dadurch wurde es langfristig möglich, die Zeit sowohl »vor Christus« wie auch »nach Christus« ins Unendliche zu verlängern.[10]
Die nächste entscheidende kalendarische Reorganisation verbindet sich mit dem Namen Papst Gregors XIII. Es waren einmal mehr drängende, tatsächlich über Jahrhunderte angewachsene Probleme, welche diese Kalenderreform nötig machten und die schon weit vor dem Jahr 1582 als gravierende Schwierigkeiten erkannt worden waren.[11]
Der Julianische Kalender umfasste exakt 365 Tage und sechs Stunden, war also etwas zu lang, weil das tropische Jahr, also die Zeitspanne zwischen zwei identischen Punkten im Ablauf der Jahreszeiten, nur 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden dauert. Etwas mehr als elf Minuten pro Jahr standen also zur Debatte – nicht viel angesichts der Weltgeschichte, sollte man meinen. Immerhin differierten die Gestirne und der Julianische Kalender damit nur alle 128 Jahre um einen Tag. Den Zeitgenossen bereitete dieser Umstand aber erhebliche Schwierigkeiten, so dass es während des Spätmittelalters immer wieder Berechnungen der Verschiebungen wie auch vergebliche Versuche zur Reform gab. Im späten 16. Jahrhundert belief sich die Differenz zwischen Kalender- und Sonnenjahr bereits auf zehn Tage. Das Papsttum schien die einzige länderübergreifende Institution zu sein, die dieses alle Betreffende Problem angehen konnte. Papst Gregor XIII. berief also eine Kommission ein, die sich dem Problem widmen sollte. Am 24. Februar 1582 wurde die Bulle Inter Gravissimas erlassen, die vor allem die Beseitigung der aufgelaufenen Differenz von zehn Tagen sowie eine Neuregelung der Schalttage vorsah. Die Tage vom 5. bis zum 14. Oktober 1582 haben also – in größeren Teilen Europas – niemals stattgefunden, da auf den 4. direkt der 15. Oktober folgte. Die Abweichung vom Sonnenjahr konnte erheblich abgemildert werden, indem man zwar wie bisher jedes vierte Jahr ein Schaltjahr einlegte, davon allerdings diejenigen Säkularjahre ausnahm, die nicht durch 400 teilbar sind. Demnach sind zwar die Jahre 1600, 2000 und 2400 Schaltjahre, aber nicht die Jahre 1700, 1800, 1900 und 2100. In vier Jahrhunderten umfasst daher der Gregorianische Kalender drei Tage weniger als der Julianische, wodurch die Abweichung zwischen tropischem Jahr und Kalenderjahr auf 26 Sekunden reduziert wird. Eine Abweichung von insgesamt einem Tag kommt demnach erst nach von 3323 Jahren zustande.[12]
Mathematisch und kalendertechnisch handelte es sich um eine nahezu geniale, weil einfache und elegante Lösung. In politischer und religiöser Hinsicht sah die Sache jedoch anders aus. Denn für den Zusammenhang von Zeitorganisation, Macht und Kultur ist der Gregorianische Kalender noch aussagekräftiger als andere Beispiele, wie die Geschichte seiner Rezeption belegt. In Frankreich, Spanien und Portugal wurde der Kalender Ende 1582 eingeführt, Ungarn folgte 1587. In den katholischen Territorien des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation wurde er am 5. Oktober 1583 übernommen. Die protestanischen Territorien verweigerten sich dem Kalender jedoch, da sie ihn für das Werk des Antichristen hielten. Innerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation existierten also zwischen 1583 und 1700 nebeneinander zwei um zehn Tage voneinander abweichende Kalendersysteme. Und wie der deutschsprachige Raum, so war auch ganz Europa kalendarisch getrennt zwischen einem Julianischen (mehrheitlich protestantischen) und einem Gregorianischen (mehrheitlich katholischen) Bereich.[13]
Eine weitere Kalenderreform erlebte das westliche Europa im Jahr 1700. Verkürzt wird diese Reform häufig derart beschrieben, dass es sich um die Übernahme des Gregorianischen Kalenders durch die Protestanten gehandelt habe. Eine solche Beschreibung ist nicht ganz falsch, trifft es aber nicht ganz. Denn es war, wenn man sich den konkreten Prozess der Annäherung der beiden Kalendersysteme, des katholisch-gregorianischen und des protestantisch-julianischen, näher ansieht, auch um 1700 für die protestantische Seite noch nicht möglich, das päpstlich erlassene Modell einfach zu übernehmen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es eine vermehrte Anzahl von Äußerungen und Schriften, die dafür plädierten, die beiden Kalendersysteme zu vereinigen. Auch auf mehreren Reichstagen wurde das Problem als dringlich benannt. In den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts gelang es dann den evangelischen Ständen auf dem Regensburger Reichstag, sich zu einer Verbesserung ihres bisher geltenden julianischen Kalenders durchzuringen. Diese Reform wurde nicht zuletzt dadurch nötig, dass aufgrund der unterschiedlichen Schaltjahresregelung die Differenz zwischen Julianischem und Gregorianischem Kalender im Jahr 1700 auf elf Tage anwuchs.
Zu beachten ist jedoch, wie von evangelischer Seite der Vorgang der Kalenderreform von 1700 beschrieben wurde. Es ging nämlich explizit nicht um eine Übernahme des Gregorianischen Kalenders, sondern um eine Verbesserung des weiterhin geltenden Julianischen Kalenders! Bis auf wenige Details glichen sich die beiden Kalender zwar, allerdings wurde von protestantischer Seite konsequent vom ›verbesserten Kalender‹ oder vom stilus novus gesprochen, nicht vom Gregorianischen Kalender. Nachdem also die protestantischen Stände im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, die bisher noch nicht den Gregorianischen Kalender angenommen hatten, vom 18. Februar direkt auf den 1. März 1700 sprangen, unterschieden sich die beiden Kalender vor allem noch durch eine unterschiedliche Osterberechnung, die in manchen Jahren auch tatsächlich zu voneinander abweichenden Osterfesten führen konnte.[14] Denselben Schritt vollzogen im gleichen Jahr auch Dänemark, Teile der Schweiz und die niederländischen Generalstaaten. Im Jahr 1752 folgten Großbritannien und die nordamerikanischen Kolonien, 1753 schließlich Schweden.[15]
Man muss sich die Tragweite und historische Tiefenwirkung des Gregorianischen Kalenders vor Augen halten. Seit seiner Etablierung im Oktober 1582 scheiterten alle weiteren europäisch-westlichen Versuche, die Zeitrechnung zu verbessern. Nicht nur der französische Revolutionskalender aus dem Jahr 1793, sondern auch das sowjetische Kalenderexperiment zwischen 1929 und 1940 oder Reformversuche der UNO konnten sich nicht gegen das frühneuzeitlich-päpstliche Modell durchsetzen, obwohl diese jüngeren Vorschläge rationaler und insgesamt einfacher waren.[16] Damit wurde einem europäischen Kalendersystem zu globaler Macht verholfen, das mit seinem christlichen Hintergrund eine wesentliche Besonderheit aufweist: Während die meisten Kalendersysteme von einem Ursprungsereignis ausgehen, rotiert der Gregorianische Kalender gleichsam um das Achsenereignis der Geburt Jesu. Das hat für chronologische Berechnungen den großen Vorteil, dass historische Tiefendimensionen im Prinzip bis ins Unendliche geführt werden können (auch wenn das keineswegs die Intention eines christlichen Kalendersystems war).[17]