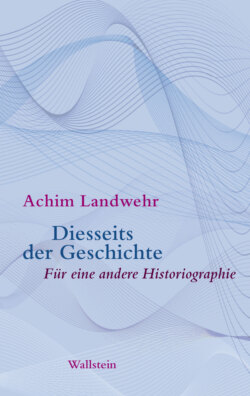Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Uhrenzeit
ОглавлениеWährend sich am Beispiel der Kalenderrechnung besonders gut zeigen lässt, wie sich kulturelle Verhältnisse der Zeitorganisation aufprägen, macht die Uhrenzeit deutlich, wie sich technische Innovationen auf die Kultur auswirken. Die Uhrenzeit zeichnet sich in ihrer spezifisch europäisch-westlichen Variante dadurch aus, die Zeit in Intervalle zu zergliedern. Eine häufig verwendete Metapher spricht zwar davon, dass die Zeit fließt. Im Fall der europäischen Uhrenzeit führt ein solches Bild jedoch in die Irre. Zeit wird vielmehr durch Uhren rhythmisiert, ja: zerhackt, und zwar mit ganz spezifischen Effekten.
Die Räderuhr mit Gewicht und Hemmung, die für die Entwicklung des Zeitverständnisses in Europa und dann schließlich auch im Rest der Welt von so einschneidender Bedeutung sein sollte,[18] lässt sich hierfür als Beispiel anführen. Es handelt sich dabei zwar nicht um die älteste bekannte Uhrenform, aber die Räderuhr spielt für die Entwicklung der Uhrenzeit eine durchaus wichtige Rolle. Sie vollführt zunächst einmal eine Bewegung im Raum, legt mit ihren Drehungen eine bestimmte Strecke zurück, um auf diese Weise Zeit sichtbar und messbar zu machen. Durch ein Gewicht wird diese Bewegung angetrieben, durch die Hemmung wird das Räderwerk – um nicht zum Opfer von Schwerkraft und Beschleunigung zu werden – immer wieder gebremst und losgelassen. Die Räderuhr mit Gewicht und Hemmung misst Zeit also nicht als etwas Fließendes, sondern stückelt sie in möglichst gleichmäßige Intervalle. Die Uhrenzeit präsentiert sich nicht als regelmäßiger Strom, sondern als springender und gebremster Rhythmus.[19]
Mit dem Takt dieses Intervalls wird Zeit fassbar und beherrschbar – und erfasst und beherrscht damit auch die Uhrenbenutzer. Diese Rhythmisierung wird nicht nur durch Uhren, sondern ebenso durch Kalender bewerkstelligt, wenn dort auf längeren Zeitstrecken Sprünge von einem Tag auf den anderen (und damit von einem Datum auf das nächste), von einer Woche zur nächsten, einem Monat oder einem Jahr zum nächsten vollzogen werden. Immer wieder wird eine bestimmte Zeitstrecke abrupt unterbrochen und wortwörtlich von einer Sekunde zur nächsten in einen anderen Zeitraum gesprungen. Wenn also die Räderuhr dazu gebaut wurde, um eine Kraft zu bremsen und wieder freizugeben, und Kalender dazu entworfen wurden, die Endlosigkeit der Zeit zu gliedern, dann führt diese Manipulation notwendigerweise zu einer Gliederung in viele gleichmäßige kleine Teilchen. Dieser Umstand erlaubt Messung, Planung, Kontrolle, Vergleich und Wertung von Zeit – aber auch durch Zeit
Erstaunlicherweise liegt diese nicht nur für die Geschichte der Zeit und der Zeitvorstellungen, sondern für die Geschichte Europas in seiner Gesamtheit wichtige Erfindung der Räderuhr mit Gewicht und Hemmung noch immer im Dunkeln – und wird dort aller Voraussicht nach auch verbleiben. Ihre Relevanz darf deswegen nicht unterschätzt werden, weil diese Uhren schlicht die besten und genauesten Zeitmessinstrumente waren, die zur Zeit ihrer Einführung im 13. Jahrhundert zur Verfügung standen. Ihr Gang war im Gegensatz zu Sonnen-, Wasser-, Räder- oder Sanduhren um ein Vielfaches gleichmäßiger und zuverlässiger, sie waren von äußeren Umständen weitgehend unabhängig (was man gerade von Sonnenuhren nicht behaupten kann) und sie boten wartungsmäßig relativ einfache Lösungen an. Das sind vornehmlich technische Argumente, die per se noch nicht begründen können, warum die Bedeutung dieser Uhr so hoch zu veranschlagen ist. Die Konstruktion der Räderuhr brachte es mit sich, dass Zeit immer präziser und in immer kleineren Einheiten erfasst werden konnte; dass ständige Verbesserungen, Vereinfachungen und Verbilligungen ermöglicht wurden; dass diese Uhren sich in relativ kurzer Zeit immer weiter ausbreiten konnten; dass, mit anderen Worten, gleichmäßig gemessene Zeit im Leben der Menschen selbstverständlich werden konnte. »Ähnlich wie später in der Geschichte der Buchdruckerkunst ab Gutenberg war hier ein technisches Prinzip gefunden worden, das es mit Ergänzung durch spätere Verbesserungen ermöglichte, einem für die abendländische Entwicklung in den letzten fünf Jahrhunderten entscheidenden Phänomen eine sich beschleunigende Verbreitung und Wirkung zu schaffen: hier dem Zeitbewußtsein, dort den Bereichen von Bildung, Wissenschaft, Unterhaltung, Information und Kommunikation.«[20]
Wer der Erfinder dieser Form der Räderuhr war, wird man wohl nie erfahren. Der Durchbruch gelang irgendwann im späten 13. Jahrhundert, in den Jahren zwischen 1270 und 1300. Möglicherweise gab es gar nicht das einzelne Genie, nach dem es unserer personalisierten Sicht auf die Vergangenheit so sehr gelüstet, möglicherweise ist der entscheidende Schritt von mehreren Menschen nahezu zeitgleich gemacht worden, möglicherweise ist die Lösung auch in mehreren Schritten gefunden worden. Dass diese Erfindung allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit in klösterlichen Mauern gemacht worden ist, kann aufgrund der Bedeutung vermutet werden, welche die Zeitdisziplin dort hatte. Ähnlich wie beim Buchdruck war auch im Fall der Räderuhr das Entscheidende die technische Verbesserung eines zuvor bereits bekannten Prinzips. Gutenberg hat nicht den Buchdruck erfunden – das hatten andere schon vor ihm erledigt –, sondern den Buchdruck mit beweglichen Lettern, der den entscheidenden Durchbruch darstellte. Im späten 13. Jahrhundert wurde nicht die Räderuhr erfunden, denn diese war in gewissen Formen bereits in der Antike bekannt, sondern die Räderuhr mit Gewicht und Hemmung.[21]
Die weitgehenden Auswirkungen der Räderuhr kommen beispielsweise bei der Frage des Zusammenhangs von Uhrenzeit und Politik zum Vorschein. Die Einrichtung von Uhren, die mit einem Stundenschlagwerk versehen und an allgemein zugänglichen, das heißt vor allem an von möglichst vielen sicht- und hörbaren Orten eingerichtet wurden, war für die Verbreitung von Stundenrechnung und Zeitdisziplin von großer Bedeutung. Es handelte sich daher bei der Errichtung solcher öffentlicher Uhren nicht nur um eine technische, sondern auch um eine soziale Innovation.[22]
Übliche Erklärungen zur Verbreitung öffentlicher Uhren seit dem 14. und 15. Jahrhundert bemühten eine ökonomisch-modernisierungstheoretische Begründung: Stundenrechnung und Schlaguhren seien zu einem Erfordernis immer komplexer werdender Lebensbedingungen in der Stadt und vor allem im Handel geworden. Beides seien Produkte des aufsteigenden Stadtbürgertums sowie der von ihm geförderten Verweltlichung der Bildung gewesen. Ohne diese Aspekte gänzlich zu negieren, ist doch ein ganzes Bündel an Faktoren anzuführen, das für die Verbreitung öffentlicher Uhren verantwortlich zu machen ist, beispielsweise eine Prestigekonkurrenz zwischen Städten bei der Anschaffung von Uhren oder der Druck der Landesverwaltungen. Die öffentliche Uhr war damit nicht mehr nur ein Element praktischer Nützlichkeit, sondern verwies auf ein geordnetes politisches Leben. Für Regierungen konnte die Uhr zu einem Sinnbild für die Qualität von Herrschaft werden.[23]
Nach Entwicklung der Räderuhr bewegten sich die Verbesserungen in der Genauigkeit von Uhren über Jahrhunderte hinweg im Bereich von Stunden und Minuten. Ein erheblicher Fortschritt gelang dann erst wieder mit der Entwicklung der Pendeluhr im Verlauf des 17. Jahrhunderts. Nachdem Galilei im späten 16. Jahrhundert den Eigenschaften der Pendelbewegung auf den Grund gegangen war, also dem Zusammenhang zwischen der Amplitude und der Dauer der Pendelschwingung, wurde im Verlauf des 17. Jahrhunderts die Pendeluhr entwickelt. Und erst mit der Exaktheit dieser Uhren wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, nicht nur genau nach der Stunde, sondern auch nach der Minute und sogar der Sekunde zu leben.[24]
Die mechanischen und technischen Verbesserungen von Uhren während des 17. Jahrhunderts vor allem durch Christian Huygens und Richard Hooke können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Verbesserung der Ganggenauigkeit führte nicht nur dazu, der präzisen Zeitmessung den Einzug in die Wissenschaft zu ermöglichen, auch auf die allgemeinen Vorstellungen der Zeit hatte sie prägenden Einfluss. Im Gegensatz zu unzuverlässigen Vorgängermodellen konnten die verbesserten mechanischen Uhren nun teils über Jahre hinweg gleichmäßig und stetig vor sich hinlaufen. Auf diese Weise wurde die Vorstellung von der Homogenität und Kontinuität der Zeit befördert. Die mechanische Uhr wurde sowohl zum Sinnbild eines mechanisch konzipierten Weltbildes wie auch der modernen Zeitauffassung. Die Genauigkeit von Uhren verbesserte sich zwischen ca. 1650 und ca. 1730 von etwa 500 Sekunden Ungenauigkeit pro Tag auf etwa 0,3 Sekunden pro Tag.[25]
Im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts kam es zu entscheidenden Neuerungen in der Zeitmessung durch den Bau von Präzisionsuhren. Diese Uhren gingen nicht nur auf die Sekunde genau, sondern zeigten diese Sekunden auch auf dem Ziffernblatt an. Diese Entwicklung schlug sich auch begrifflich bei der Bezeichnung von Zeitmessern nieder: Im Englischen wird der time-keeper seit 1686 verwendet, im Französischen das Wort chronomètre seit 1701 und im Deutschen der Chronometer seit 1735.[26] Man ist geneigt, nicht an einen Zufall zu glauben, wenn ebenfalls in diesem Zeitraum im Englischen das Wort speed auftauchte oder das Wort punctual, das zuvor eine Person beschrieben hatte, die um Detailfragen guten Benehmens besonders bemüht war, seit dem 17. Jahrhundert jemand bezeichnete, der exakt zur festgelegten Zeit erschien.[27]
Die Pendeluhren stellen auch in anderer Hinsicht einen wichtigen Baustein in der Geschichte des Verhältnisses von Mensch und Uhr dar. Diese Beziehung ist nämlich durch eine permanente Annäherung der Uhr an den Menschen gekennzeichnet. Von den öffentlichen Kirchtürmen wanderten die Uhren zunächst in die Häuser, wurden dann als tragbare Taschenuhren zum ständigen Begleiter, bevor sie sich als Armbanduhren unmittelbar an den Menschen fesselten.[28]
Man kann damit dem späten 17. Jahrhundert und insbesondere den Jahrzehnten um 1700 eine Scharnierfunktion in der europäischen Geschichte der Zeitrechnungen zuschreiben. Kalenderdrucke wurden in diesem Zeitraum endgültig zu einem Massenmedium, die Trennung von Julianischem und Gregorianischem Kalender löste sich allmählich auf und die Ganggenauigkeit von Uhren erfuhr eine deutliche Verbesserung. Doch noch wichtiger ist eine diskurs- und kulturhistorische Verschiebung, die diesen medialen und technischen Veränderungen an die Seite tritt: Um 1700 haben wir es hinsichtlich der Einstellungen zur und der Vorstellungen von Zeit mit der Umstellung von einem gegebenen Sinnsystem zu einer verfügbaren Ressource zu tun. Es wird, mit anderen Worten, um 1700 möglich, Zeit als Ressource zu nutzen, und zwar als eine per se sinnentleerte Ressource, die überhaupt erst mit Sinn gefüllt werden musste.