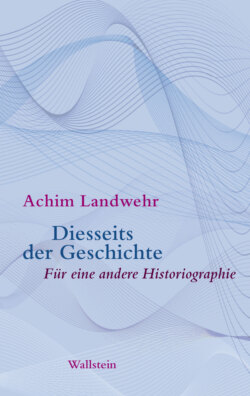Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Macht der Zeitrechnung
ОглавлениеDie unterschiedlichen Zeitrechnungen stellen Orientierung im unausweichlichen Nacheinander der Geschehnisse zur Verfügung. Zeitrechnungen sind Referenzsysteme, mit deren Hilfe Gleichzeitiges, Vorheriges und Nachfolgendes bestimmt und voneinander unterschieden werden können. Über diesen rein funktionalen Aspekt hinaus sind in Zeitrechnungsmodellen aber auch kulturelle Erfahrungen eingelagert – und sie sind in der Lage, zur Hervorbringung von Bedeutungsformen beizutragen.
Es gibt wohl nur wenige Phänomene, die so gut wie die Zeit zeigen können, dass das Selbstverständnis Europas Ergebnis recht aufwändiger Konstruktionsverfahren ist. Denn es muss schon ein wenig seltsam anmuten, das etwas zur Grundlage eines ganzen Kontinents werden kann, das keine eigene Existenzweise besitzt. Wie nicht großartig bewiesen werden muss, gibt es ›die Zeit‹ nicht. Was wir als gegeben voraussetzen können, ist das Entstehen und Vergehen von Leben, ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ist die Unumkehrbarkeit von Ereignissen – aber all das ist noch nicht ›die Zeit‹. Nicht selten behandeln wir die Zeit aber so, als käme ihr eine eigene, von den Menschen unabhängige Daseinsweise zu, als bilde sie eine eigene Dimension, als würde hoch über uns eine riesige Uhr ticken, die uns die absolute Zeit vorgibt, nach der wir uns zu richten hätten. Tatsächlich ist Zeit jedoch ein kulturelles und historisches Produkt. Ansammlungen von Menschen, unabhängig davon, wie sie sich selbst bezeichnen oder von anderen bezeichnet werden, bedienen sich bestimmter Techniken, durch die sie etwas hervorbringen, das bestimmte temporal-organisatorische Funktionen erfüllt und Zeit genannt werden kann. Medien wie Kalender oder Uhren kehren diesen Effekt aber nicht selten um, denn sie erwecken den Eindruck, als würden sie nur etwas neutral registrieren – nämlich ›die Zeit‹ –, das unabhängig von unserem Wollen und Wirken in einer eigenen Sphäre existierte. Diese Medien lassen sich mit Fug und Recht als ›Zeitmaschinen‹ bezeichnen – nicht im Sinne des gleichnamigen Romans von H. G. Wells, der darunter bekanntermaßen Apparaturen verstand, mit denen man durch ›die Zeit‹ reisen könnte, sondern im Sinne von Techniken, die Zeit nur oberflächlich zu registrieren scheinen, sie aber tatsächlich permanent hervorbringen.
Um also gesellschaftliche Tätigkeiten im Fluss des Geschehens fixieren zu können, werden Naturabläufe verwendet, durch welche die Position und Dauer von Ereignissen bestimmbar wird.[1] Aber astronomische oder meteorologische Phänomene sind noch nicht ›die Zeit‹. Zeit ›entsteht‹ vielmehr erst als kulturelle Ordnungsleistung in der Wechselwirkung zwischen Beobachtungen der Außenwelt und dem, was Kulturen daraus machen. Und genau um dieses ›Zwischen‹ geht es. Wenn also beispielsweise eine soziokulturelle Formation die Abläufe und Bewegungen am Himmelszelt erkannt und deren regelmäßige Wiederkehr verstanden hat, drängt sich zwangsläufig die Frage auf, wer oder was für dieses eindrückliche Spektakel verantwortlich zeichnet. Kein Wunder also, dass in der Folge die Zeit oft als göttliches Phänomen verstanden wurde, denn seit jeher hat sich die menschliche Zeitrechnung an Himmelsphänomenen ausgerichtet. Zeitrechnung ist also zu wesentlichen Teilen eine religiöse Angelegenheit – und nicht nur eine religiöse, sondern ebenso eine politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche.
Diese alle Lebensbereiche betreffende und durch alle Lebensbereiche beeinflusste Zeitrechnung kann in ihrer Wirkmächtigkeit kaum hoch genug eingeschätzt werden – und die Tatsache, dass wir davon im Alltag kaum mehr etwas bemerken, ist kein Argument gegen, sondern ein Beleg für die Macht von Zeitrechnung. Die Uhren- und Kalenderzeit, wie man diese ihrem Ursprung nach europäische Form der Zeitrechnung nennen kann, ist einer der erfolgreichsten Exportschlager der westlichen Welt.[2] Die europäische Uhren- und Kalenderzeit hält die Welt zwar nicht in Bewegung, reguliert und koordiniert aber ihre Bewegungen. Unabhängig davon, ob es sich um Menschen, Güter oder Informationen handelt: Nahezu alles wird mit einer genauen Datierung versehen. In Abwandlung von Adam Smith könnte man sagen, dass die Uhren- und Kalenderzeit tatsächlich eine unsichtbare Hand ist, aber nicht nur eine unsichtbare Hand von Wirtschaftsmärkten, sondern ebenso von Staaten, Gesellschaften, Kulturen, Religionen und allen anderen menschlichen Organisationsformen.
Das Beeindruckende an der Uhren- und Kalenderzeit ist ihre Simplizität und Ubiquität. Ihre Symbole und Präsentationsformen sind verhältnismäßig leicht zu verstehen, können schon von Kleinkindern erlernt werden, und die technischen Apparaturen zur Übertragung dieser Symbole sind überall zu finden: als öffentliche Uhren oder Armbanduhren, in Smartphones und Computern, im Radio und Fernsehen, in Kalendern und Tagebüchern.
Und obwohl die technischen Möglichkeiten, die Uhren- und Kalenderzeit zu verbreiten und verfügbar zu halten, beständig anzuwachsen scheinen, ist das Prinzip der Zeitrechnung, das sich dahinter verbirgt, unverändert geblieben. Der Blick auf das Tagesdatum oder die Uhrzeit erscheint uns üblicherweise als die mehr oder minder technische Repräsentation basaler und daher auch neutraler Informationen von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Tatsächlich führt uns aber jeder Blick in den Kalender oder auf das Smartphone in die Untiefen der europäischen Kulturgeschichte.[3]