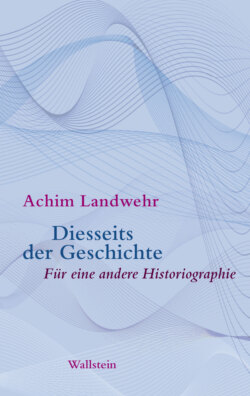Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Europäische Zeit als globale Zeit
ОглавлениеDer Zeitraum um 1700 darf auch insofern für sich in Anspruch nehmen, für die Geschichte der Zeitrechungsmodelle und Zeitkonzepte von besonderer Bedeutung zu sein, als erstmals abendländisch-christliche Zeitvorstellungen ihren engeren Ursprungsbereich verließen, um einen Siegeszug um die Welt anzutreten. Sicherlich waren europäische Modelle der Zeitrechnung zuvor bereits den kolonisierten Gebieten aufoktroyiert worden – um 1700 geschah jedoch etwas qualitativ Neues.
Am deutlichsten lässt sich dies am Beispiel des russischen Zarenreiches zeigen, denn es hat wohl nur selten eine rabiatere Reform des Kalenders gegeben als im frühen 18. Jahrhundert unter Zar Peter I. in Russland. Als Pjotr Alexejewitsch kehrte er in der letzten Augustwoche, kurz vor der Jahreswende des Jahres 7207, aus dem Westen Europas nach Moskau zurück. Er nannte sich nun bürgerlich-niederländisch Piter und machte sich unverzüglich an den Umbau der Moskauer Rus. Am Anfang seiner Bemühungen stand die Erneuerung der Zeitrechnung. Der Jahresbeginn wurde von September auf den 1. Januar verlegt, und die byzantinische Zeitrechunung wurde abgeschafft. Somit folgte auf den 31. Dezember des Jahres 7208 nach Erschaffung der Welt – ein Jahr, das gerade einmal vier Monate gedauert hatte – der 1. Januar des Jahres 1700 nach Christi Geburt. Diese Umstellung war – gemeinsam mit den weiteren grundlegenden Reformen Peters I. – für die Untertanen des Zaren ein Kulturschock. Peter I. wurde in der Folge als Antichrist bezeichnet und mit Aufständen konfrontiert. Einzelne Gruppen orthodoxer Altgläubiger (die Raskolniki) sahen gar das Ende der Welt nahen.[29]
Auch für andere Kulturen außerhalb des lateinisch-christlichen Abendlandes mag die Konfrontation mit dieser spezifischen Form der Zeitrechnung als Schock gewirkt haben – wenn es auch üblicherweise nicht zu so heftigen Reaktionen kam wie in Russland. Die Auflistung einiger Daten mag an dieser Stelle genügen, um nur den Siegeszug des Gregorianischen Kalenders um die Welt zu dokumentieren: Nachdem ab 1582 das katholische Europa diesen Kalender weitgehend übernommen hatte und sich seit 1700 das protestantische Europa mit eigenen Verbesserungen des Julianischen Kalenders dem Gregorianischen so weit angenähert hatte, dass kaum noch Unterschiede zu erkennen waren, folgten Mitte des 18. Jahrhunderts die britischen Inseln und Schweden, Japan 1873, Bulgarien 1916, Russland 1918 beziehungsweise 1922, Griechenland 1923, die Türkei 1926 und China 1912 beziehungsweise 1929.[30]
Gemeinsam mit den jeweiligen europäischen Ländern wurden die entsprechenden Zeitrechnungsmodelle auch in den Kolonien eingeführt, so dass man davon sprechen kann, dass seit dem 18. Jahrhundert europäische Zeitrechnungsmodelle tatsächlich zu einem globalen Phänomen wurden. Wesentlich subtiler und daher historisch auch deutlich schwerer auszumachen verlief die Ausbreitung der Uhr nach europäischem Maßstab und damit auch die Einteilung des Tages nach diesem Modell. Was sich jedoch mit Blick auf die Tageseinteilung und Stundenzählung als markant herausstellt und vor allem auch als europäisch-westliches Modell beschrieben werden muss, das dem Rest der Welt aufgezwungen wurde, ist die Einführung der Weltzeit. Der Anlass dafür war ein vordergründig praktisches Problem: Mit Ausbreitung der Eisenbahnen wurde offenbar, wie zersplittert Europa in zeitlicher Hinsicht war, da jede Eisenbahngesellschaft für ihre Fahrpläne die Ortszeit ihres jeweiligen Hauptsitzes zugrunde legte. Innerhalb des deutschen Kaiserreichs wurde noch in den 1870er Jahren nach zahlreichen, regional unterschiedlichen Ortszeiten gerechnet, in den USA gab es 1873 71 verschiedene Eisenbahnzeiten. Der Kanadier Sandford Fleming machte den Vorschlag, die 360 Längengrade des Erdumfangs in 24 Zeitzonen einzuteilen, die jeweils eine Stunde Zeitunterschied voneinander aufweisen, aber die identischen Minuten und Sekunden haben sollten. Auf der Washingtoner Meridian-Konferenz von 1884 konnte sich dieser Vorschlag durchsetzen, und die englische Sternwarte in Greenwich wurde zum Meridian erhoben. Die Uhrzeit der gesamten Welt wurde damit kaum zufällig nach der größten Kolonialmacht des 19. Jahrhunderts organisiert.[31]
Die Uhren- und Kalenderzeit hat also von ihrem Ursprungsort Europa aus einen epidemischen Weg durch sämtliche Kulturen angetreten. Und es scheint keine Möglichkeit des Widerstandes dagegen zu geben. Ja, man hat auch nicht den Eindruck, dass es ernsthafte Versuche des Widerstands gibt, dass sich beispielsweise eine Bewegung des Chronoklasmus ausmachen ließe. Ikonoklasmen finden sich immer wieder, in Europa wie im Rest der Welt. Aber die willentliche Zerstörung von Uhren, Kalendern und anderen Hilfsmitteln der Zeitrechnung scheint kein Phänomen zu sein, das erhöhten Energieaufwand rechtfertigen könnte.[32] Diese tendenzielle Unaufmerksamkeit gegenüber der Allmacht der Uhren- und Kalenderzeit hängt wohl nicht zuletzt mit ihrem ephemeren Charakter zusammen. Bilder oder auch Landkarten als Ziele ikonoklastischer Gewalt drängen sich mit all ihren Aussagen und Botschaften deutlich unittelbarer auf. Aber die Zeit begegnet uns in sehr abstrahierten Symbolisierungen, deren kultureller Gehalt nicht unmittelbar zu erschließen ist. Das kennzeichnet die Macht einer spezifischen Form der Zeitrechnung (und in diesem Fall der europäischen Uhren- und Kalenderzeit): Sie ist immer und überall präsent, aber niemand scheint sie zu bemerken.
Der große Vorteil, den die europäische Uhren- und Kalenderzeit hinsichtlich weltweiter Verbreitungsmöglichkeiten bietet, besteht in ihrer Autonomie. Als Zeiterfassungssystem ist sie nicht an bestimmte, genaue festgelegte Ereignisse gebunden. Sie ist von spezifischen Erfahrungen des Menschen und lokalen Gebundenheiten unabhängig, kann also auf beliebige Ereignisse, Systeme, Zeitspannen etc. angewendet werden. Dieser Umstand war (und ist) sicherlich nicht unwichtig für die Ermöglichung der teils massiven Veränderungen, die Gesellschaften Europas und des atlantischen Westens sowie auf der gesamten Welt seit dem 18. Jahrhundert und insbesondere seit der Industrialisierung durchlaufen haben. Denn mit umfassenden wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Transformationen geht üblicherweise auch ein Wandel der Zeitkonzepte und der Zeitmessungssysteme einher. Das war im Kontext von Industriegesellschaften nicht nötig, da sie bereits ein abstraktes und autonomes System der Zeitrechnung zur Verfügung hatten, das sich problemlos den neuen Gegebenheiten anpassen ließ. Während Zeitsysteme ansonsten relativ zählebige, schwer wandelbare Bestandteile von Kulturen sind und somit in ihrer Traditionalität durchaus eine Gegenkraft zu Impulsen des Wandels darstellen können, war und ist dies bei der europäisch-westlichen Uhren- und Kalenderzeit nicht der Fall. Durch ihre Flexibilität lässt sie sich entsprechenden Transformationen nicht nur problemlos anpassen, sondern befördert diese Veränderungen auch. Und dieses an den Naturwissenschaften orientierte, aber nichtsdestotrotz sozial fundierte Zeitsystem ist auf zahlreiche andere Kulturen übertragbar.[33]
Ein weiterer Aspekt darf als typisch gelten für die europäische Uhren- und Kalenderzeit, und zwar ihr Abstraktionsgrad. Zahlreiche kalendarische Modelle operieren mit herausragenden Ereignissen oder der Regierungszeit von Dynastien, um zeitliche Bezugspunkte herzustellen. Von diesen Fixierungen aus kann Gleichzeitiges, Vorheriges und Nachheriges bestimmt werden. Die Reichweite solcher Zeitschemata ist allerdings begrenzt, da sie sich nicht in andere Kontexte übersetzen lassen. Das 17. Jahr in der Herrschaft des Königs Ichweißnichtwer hat nichts zu tun mit dem 437. Jahr nach Erscheinen des Gottes Soundso. Nicht selten kommt als weiteres Manko hinzu, dass die Kalenderberechnung mit jedem neuen Herrscher wieder von vorne beginnt.[34]
Die europäische Uhren- und Kalenderzeit ist selbstverständlich nicht frei von solchen Elementen, immerhin lässt sie die Zählung der Jahre mit der (vermeintlichen) Geburt Jesu Christi beginnen. Darüber hinaus zeichnet sie sich jedoch mit ihrer Art und Weise der Datierung durch einen hohen Grad der Verallgemeinerung aus – der sich mit der Zählung vor Christi Geburt vor allem auch in beide Richtungen, in die Zukunft wie in die Vergangenheit endlos fortsetzen lässt. Jahre und Jahrhunderte werden ebenso stur durchgezählt wie Monate und Tage. Dadurch lässt sich ein rein numerisches Datierungssystem entwickeln, das sehr anpassungsfähig ist und seine eigenen kulturellen Wurzeln schnell vergessen macht.
Solche abstrakten Modelle der Zeitrechnung werden dann nötig und auch erfolgreich, wenn Unbekanntes zeitlich geordnet werden muss, wenn man also mit Ereignissen umgehen will, deren Zeitstelle noch unbestimmt ist. Kulturen, die in solcher Art und Weise bestrebt oder gezwungen sind, mit dem Unbekannten umzugehen, müssen für alles, was überhaupt vorkommen kann, Synchronisierbarkeit gewährleisten.[35] Die verwirrende Vielfalt unterschiedlicher Zeitvorstellungen (Arbeitszeit, Freizeit, Familienzeit, Wahltermine, Olympiaden, Lohnverhandlungen …) »läßt die Bedeutung der Uhr- und der Kalenderzeit deutlich hervortreten. Die abstrakten oder an astronomischen Phänomenen orientierten Zeitangaben sind die Brücke zwischen den verschiedenen Zeitvorstellungen; sie synchronisieren das soziale Leben, denn sie erlauben die Übersetzung einer Zeiteinteilung in eine andere. Heute ist die Überschreitung nationaler Grenzen durch solche Übersetzungen die Norm, so daß der von Sorokin für die Uhrzeit geprägte Begriff ›universal Esperanto‹ angebracht erscheint.«[36]
Dass sich das Modell der Sieben-Tage-Woche oder die Bezeichnung der Monate spezifisch europäischen kulturellen Vorgaben verdankt, wird in der alltäglichen Praxis kaum noch zur Kenntnis genommen. Die europäische Uhren- und Kalenderzeit wird samt ihrer Datierungsweise – nicht zuletzt auch innerhalb Europas – vor allem als eine abstrakte Ansammlung von Zahlen (und wahlweise Monatsnamen) angesehen.
Dieser Aspekt war nicht zuletzt ausschlaggebend für den weltweiten Erfolg dieses Zeitmessungssystems, denn es lässt sich relativ unkompliziert in anderen Kulturen implementieren – zumindest, wenn man gewillt ist, die Kröte der jüdisch-christlichen Tradition zu schlucken, die diesem Zeitmessungssystem inhärent ist. Trotzdem sollte man nicht der Illusion erliegen, dass es vor allem die Qualität oder Abstraktionsfähigkeit der europäischen Uhren- und Kalenderzeit war, die zu ihrer weltweiten Ausbreitung geführt hat. Diese Qualitäten haben den Zeit-Export unterstützt, maßgeblich dafür verantwortlich war jedoch die europäische Kolonisierung der Welt.