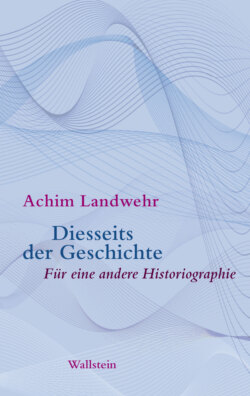Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ist heute Mittwoch oder Dezember?
ОглавлениеVon Pluritemporalität zu sprechen, ist keineswegs nur eine akademische Verstiegenheit, kein abstraktes Gedankengebäude ohne jegliche Bodenhaftung. Zum einen lässt sich mittels individueller Selbstbeobachtung unschwer ausmachen, dass man nicht nur in einer Zeit lebt, sondern recht unterschiedlichen temporalen Rhythmen folgt. Zum anderen hat das Thema auch die Politik erreicht – wenn ihm auch noch nicht die große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit zuteilgeworden ist. Im Herbst 2010 erließ der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats eine Resolution für eine zukünftige Zeitpolitik in den europäischen Städten und Gemeinden. Ausgangspunkt der Resolution ist die Überlegung, dass Zeit ein Schlüsselelement für die Sicherstellung der Lebensqualität und für den Abbau sozialer Ungleichheit ist. Daher haben bereits einige Kommunen ›Zeitplanungsbüros‹ eingerichtet, die als Äquivalent zu Raumplanungsinstitutionen zu sehen sind. Der Kongress empfiehlt, die anfänglichen Bemühungen auszuweiten und entsprechende Büros in ganz Europa zu installieren. Zeit wird dabei nicht nur explizit als Ressource und als kulturelles Medium verstanden, sondern in der Resolution wird ebenfalls die Forderung formuliert, zukünftig »the right to time«, also das individuelle Recht, sich selbst zu ›zeiten‹, ernster zu nehmen.[38]
Man tut aber gerade im Zusammenhang der Rede von Pluritemporalität gut daran, die allseits beliebte rhetorische Geste eines radikalen Bruchs zu vermeiden. Denn weder stellt die Beschreibung von Vielzeitigkeit einen solchen Bruch auf der Beobachtungsebene dar, noch sollen durch Pluritemporalität vornehmlich solche fundamentalen Einschnitte thematisiert werden. Pluritemporalität bedeutet vielmehr, dass alte Zeitformen nicht einfach verschwinden, neue Zeitformen nicht einfach alles überlagern. Elemente älterer Strategien überdauern, weswegen die Vorstellung eines epistemischen Bruchs in die Irre führt.[39] Es finden sich immer Bestandteile, die anscheinend nicht ›in eine Zeit passen‹, veraltet und ›ungleichzeitig‹ wirken.[40] Aber gerade in solchen Zusammenhängen sollte das Stichwort der Pluritemporalität seine Qualitäten ausspielen und eben diese Vielfalt der Zeiten zum Thema machen.
In diesem Sinn hat Michel Serres davon gesprochen, dass die pluralen Zeiten nicht nur in ein und derselben Gleichzeitigkeit existieren, sondern dass Menschen diese unterschiedlichen Zeiten auch leben, dass der Mensch also Pluritemporalität geradezu verkörpert. Denn der Mensch ist zur gleichen Zeit lebendig und sterblich, beständig und unbeständig, wiederholend und ständig Neues hervorbringend. Lebende Systeme sind insofern komplexe Synchronismen, die beständig verschiedene Zeiten miteinander in Einklang bringen. Sie sind, so Serres, multitemporal, polychron und baden in einem Fluss zahlreicher Zeiten.[41] Und was für die verkörperten Zeiten des Individuums gilt, so Serres, trifft auch auf die historischen Zeiten zu, die ebenfalls als eine Syrrhese verstanden werden müssen, als ein Zusammenfluss unterschiedlicher Strömungen,[42] den wir noch nicht einmal annähernd verstanden haben.
Die Dauer, die Länge, die Kürze, die Schnelligkeit oder die Langsamkeit der Zeit sind Bereiche, an denen sich die Vielzahl der Zeiten exemplifizieren lässt. Das Verhältnis von anwesenden und abwesenden Zeiten ist ein anderes. Die Differenz von Jetzt und Nicht-Jetzt gehört mit all ihren ausgefeilten Modalisierungen, wie sie mit der Trias von Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft in unserem kulturellen Repertoire eingemeißelt ist, zu den grundlegenden temporalen Bestimmungen des Menschen. Die Fähigkeit, sich auf Dinge und Geschehnisse beziehen zu können, die entweder schon längst vergangen oder noch gar nicht eingetreten sind, sollte man nicht allzu voreilig als eine Selbstverständlichkeit annehmen. Aus dieser Fähigkeit ergeben sich Möglichkeiten zur Bestimmung von Zeit, die sich differenztheoretisch fassen lassen – um im Anschluss wieder relationierend begriffen werden zu können.
Beginnen wir mit dem differenzierenden Zugriff und der Fähigkeit, mit und durch Zeit Unterscheidungen treffen zu können. Laut Elena Esposito ist es das, was Zeit überhaupt ausmacht, nämlich eine spezifische Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft zu markieren, die eine Gegenwart jeweils für sich trifft. Eine solche Differenzierung vorzunehmen, ist kein gewissermaßen natürlicher Vorgang, sondern besitzt seine historischen und sozialen Eigenheiten. Spezifische Zeitverständnisse sind also nicht immer einfach schon, sondern werden erst im Lauf der Zeit, und zwar durch jeweils unterschiedliche Gruppen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Dies führt zu einer Mehrzahl differenter Zeiten, jede mit ihrer eigenen sozialen und historischen Verortung. All diese unterschiedlichen Zeiten werden koordiniert durch eine Chronologie, die für alle gleich ist, die aber gerade aufgrund ihrer Abstraktheit auch für alle leer geworden ist. Die neuzeitliche Form der Datierung sagt nichts mehr aus über die Inhalte oder den Sinn von Ereignissen. Jede soziale Gruppe kann daher ein Ereignis in eine Zeit einfügen, die immer nur seine Zeit bleiben wird.[43]
Man kann und muss also die Frage stellen, wie an den jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Orten bestimmte Zeitformen diskursiv hervorgebracht werden, wie Vergangenheiten und Zukünfte als kollektive Projektionen auf abwesende Zeiten erzeugt werden. Denn diese temporalen Orientierungen ins Kommende und ins Gewesene sind immer Entwürfe einer Gegenwart, die darum bemüht ist, sich auch mit ihrer zeitlich abwesenden Umwelt auseinanderzusetzen.[44]
Nun ist es gerade diese Qualität und auch Aufwertung der Gegenwart, die die Geschichte der europäischen Neuzeit entscheidend prägt.[45] Beobachtet man die historischen Veränderungen im Umgang mit Zeit und Zeithorizonten, so gewinnt die Frage an Relevanz, wann und warum sich die Modalisierungen von Zeit in die Richtung verschoben haben, die wir in unserer eigenen Gegenwart für angemessen halten. Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass Kollektive sich an der eigenen aktuellen Gegenwart mit ihren jeweiligen Unterscheidungen und Bezügen hinsichtlich Vergangenheit und Zukunft orientieren. Es ist jedoch die Einsicht vorhanden, dass genau diese Orientierungen auf abwesende Zeiten in der Vergangenheit schon einmal anders waren und zukünftig auch anders sein werden. Ein Kollektiv kann sich also darauf einrichten, zukünftig mit anderen Zeitdifferenzierungen zu operieren und damit auch andere Entscheidungen zu treffen.[46]
Es war der Drehspiegel, der sich als zu schwer erwies. Der junge Bonthorp konnte trotz seiner Muskeln das verfluchte Ding nicht länger herumschleppen. Er blieb stehen. Und das taten sie alle – Handspiegel, Blechbüchsen, Bruchstücke von Küchenglas, Glas aus der Geschirrkammer und reich bossierte Silberspiegel – alle blieben stehen. Und die Zuschauer sahen sich selbst, zwar keineswegs ganz, zumindest aber stillsitzend.
Die Uhrzeiger waren im gegenwärtigen Augenblick stehengeblieben. Es war das Jetzt. Wir selbst.
Das also hatte sie im Schilde geführt! Uns bloßzustellen, so wie wir sind, hier und heute. […]
Aber bevor sie alle zu einem gemeinsamen Entschluß gekommen waren, setzte sich eine Stimme durch. Wessen Stimme das war, wußte niemand. Sie drang aus dem Gebüsch – eine megaphonische, anonyme Erklärung aus dem Lautsprecher. Die Stimme sagte:
Bevor wir uns trennen, meine Damen und Herren, bevor wir gehen … ( Jene, die schon aufgestanden waren, nahmen wieder Platz) … reden wir in einsilbigen Worten, ohne Schnörkel, Füllsel oder Drumherum. Durchbrechen wir den Rhythmus und vergessen wir den Reim. Und betrachten mit Ruhe uns selbst. […] Betrachtet euch selbst, meine Damen und Herren! Danach die Wand; und fragt euch, wie soll diese Wand, die große Wand, die wir nennen kurzerhand, vielleicht zu Unrecht, Zivilisation, von Schnipseln, Fetzen und Fragmenten, wie wir’s sind (hier blinkten und blitzten die Spiegel auf ), erbaut werden?
(Virginia Woolf: Zwischen den Akten)[47]
Vergangenheit und Zukunft erweisen sich als Projektionsräume jeweiliger Gegenwarten, die vielfach miteinander verknüpft sind. Die Vergangenheit bietet gerade aufgrund der Tatsache, dass sie bestimmt zu sein scheint, Raum für unterschiedliche Projektionen in Form alternativer Möglichkeiten oder der Selektion und Interpretation von Ereignissen – und wird dadurch wieder unbestimmt. In die nicht feststehende Zukunft mit all den Unsicherheiten, die mit ihr einhergehen, werden hingegen offene Möglichkeiten projiziert, von denen man noch nicht weiß, wie sie sich realisieren.
Die Komplexität wächst aber noch, weil alle drei Zeithorizonte wechselseitig aufeinander Bezug nehmen – und damit ist der relationierende Teil der Zeitverhältnisse eröffnet. Für die Gegenwart sind sowohl Vergangenheit als auch Zukunft inaktuell, können also auch immer auf der Basis dessen gestaltet werden, was die aktuelle Gegenwart ist. Die Zukunft wirkt vor diesem Hintergrund beispielsweise auf die Vergangenheit ein, indem sie laufend durch die realisierten Ereignisse und auch projizierten Erwartungen revidiert wird. Neue Zukunftsentwürfe benötigen also eine entsprechend angepasste Vergangenheit. Die Vergangenheit beeinflusst ihrerseits die Zukunft durch Angabe der Differenzierungen, die bei der Beobachtung zu verwenden sind. Erfahrungen aus der Vergangenheit beeinflussen also die Zukunftsentwürfe. »Berücksichtigt man auch, dass die Vergangenheit alle Zukünfte der vergangenen Gegenwarten einschließt, während die Zukunft die Vergangenheiten und die Zukünfte der kommenden Gegenwarten einbezieht, versteht man, welches Netzwerk von Konditionierungen sich daraus ergibt, und auch welche Komplexität von Verbindungen gleichzeitig in jeder Gegenwart existiert.«[48] Es ist nicht zuletzt dieses Geflecht, das die Paradoxie der Zeit ausmacht, nämlich die Einheit von Aktualität und Inaktualität zu organisieren.
Wenn sich Zeitvorstellungen aus der Unterscheidung ergeben, die eine Gegenwart mit Blick auf die beiden Zeithorizonte Vergangenheit und Zukunft für sich trifft, dann wird auch erklärlich, weshalb Zeit zu einer wichtigen Dimension der Bestimmung von Sinn werden kann. Denn im Falle eines Ereignisses ereignet sich laut Niklas Luhmann nicht nur das Ereignis selbst, sondern damit werden zugleich Vergangenheit und Zukunft neu formiert. Der Fall der Berliner Mauer 1989 veränderte nicht nur die Zukunft Deutschlands und Europas in ganz erheblicher Weise, sondern ebenso die Vergangenheit der deutschen Geschichte (im Falle der DDR auf besonders dramatische Weise), die nun in einer neuen Sinnperspektive gesehen wurde.[49] Der Aufbau von Komplexität heißt demnach in temporaler Hinsicht, dass jeder im Zuge dieses Aufbaus vollzogene Schritt »der Vergangenheit etwas Neues hinzufügt und damit das Vergangene ändert in etwas, das eine Folge hat; und zugleich müßte jeder Schritt eine Zukunft ermöglichen, die vorher (also: als Zukunft des jetzt Vergangenen) nicht möglich war. In diesem Sinne wäre die Konsequenz eine Gesamtreproduktion der Zeit in jedem Moment.«[50]