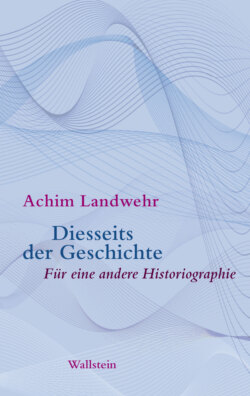Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wann ist Jetzt?
ОглавлениеVor diesem Hintergrund lohnt sich – nicht zuletzt für die geschichtswissenschaftliche Diskussion – eine erhöhte Aufmerksamkeit für die ansonsten eher stiefmütterlich behandelten Begriffe der Gleichzeitigkeit und der Gegenwart. Luhmanns diesbezüglicher Ausgangspunkt ist eine These, die denkbar trivial anmutet, bei konsequenter Umsetzung aber weitreichende Folgen zeitigt: Alles was geschieht, geschieht gleichzeitig. »Gleichzeitigkeit ist eine aller Zeitlichkeit vorgegebene Elementartatsache.«[51] Anders formuliert: Nimmt man irgendein Geschehen als Referenzpunkt, können andere Geschehnisse nur gleichzeitig, nicht aber in der Vergangenheit oder in der Zukunft vonstattengehen. Systemtheoretisch gesprochen kommt diese Form der Gleichzeitigkeit mit und durch die Unterscheidung von System und Umwelt zustande. Da bekanntermaßen alles Beobachten ein Unterscheiden erfordert, müssen beide Seiten einer solchen Unterscheidung durch eine Grenze getrennt und damit auch gleichzeitig vorhanden sein. Beide Seiten der Unterscheidung sind demnach zwangsläufig gleichzeitig gegeben – aber sie sind nicht gleichzeitig benutzbar. Denn der Übergang von der einen zur anderen Seite erfordert Zeit. Man kann sich nicht gleichzeitig hüben und drüben befinden. »Die beiden Seiten sind gleichzeitig und in einem vorher / nachher Verhältnis gegeben. Als Unterscheidung sind sie gleichzeitig aktuell, als Referenz einer Bezeichnung nur nacheinander.«[52] Auch hier erweist sich Zeit als in hohem Maße paradox, denn jede differenzstiftende Grenze erzeugt eine Form, welche die unterschiedenen beiden Seiten enthält und als gleichzeitig fixiert. Damit geht aber auch die Möglichkeit des Kreuzens dieser Grenze und einer zeitlichen Verlagerung einher.
Folgt man diesem Gedankengang, kann es im Gleichzeitigen für den Beobachter kein Vorher und kein Nachher geben. Vergangenheit und Zukunft sind demnach als Elemente der Zeitlichkeit nicht per se gegeben. Vielmehr können Vergangenheit und Zukunft nur als Ergebnisse einer Differenzierung relevant werden, denn als komplementäre Zeithorizonte sind auch sie nur gleichzeitig gegeben. Auch hierbei handelt es sich um eine Trivialität, jedoch um eine, die immer noch nicht ausreichend bedacht wird und daher zuweilen für Aufregung sorgen kann. Wenn es sich bei Vergangenheit und Zukunft immer um Horizonte der Gegenwart handelt, kann es nur eine gegenwärtige Zukunft und eine gegenwärtige Vergangenheit geben (was insbesondere mit Blick auf die Vergangenheit immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten führt). Die Gegenwart fungiert dabei als Trennlinie.[53]
Wie aber kann es sein, dass es kein Vorher und Nachher geben soll, wir aber in unserem Alltag völlig selbstverständlich mit diesen Kategorien umgehen? Nun eben, weil es Kategorien sind: Insbesondere im Fall der Differenzierung von Vorher und Nachher handelt es sich um die elementarste Zeitunterscheidung, die eine Gegenwart für sich trifft. Diese Unterscheidung ist sogar so dominant, dass die Gleichzeitigkeit zwischen ihren beiden Seiten Vorher und Nachher verschwindet. Der Standpunkt des Unterscheidens (die Gleichzeitigkeit) kommt also in der Unterscheidung von Vorher und Nachher selbst nicht mehr vor.[54]
Wenn Zeit das Konstrukt eines Beobachters ist[55] und in dieser Beobachtung Zeit definiert werden kann als »Interpretation der Realität im Hinblick auf eine Differenz von Vergangenheit und Zukunft«,[56] dann ergibt sich daraus nicht nur die grundlegende Paradoxie, dass Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges immer nur gleichzeitig erlebt werden können, sondern dann widerspricht ein solches Verständnis von Zeit auch der geschichtswissenschaftlichen Standardauffassung. Vergangenheit ist dann nicht mehr vorrangig dasjenige, was nicht mehr ist, und Zukunft ist auch nicht derjenige Zeitraum, der noch nicht ist. Es bedarf kaum einer ausgefeilten philosophischen Argumentation, um die Fehler dieser Auffassung aufzudecken: Was nicht mehr ist, ist nicht mehr, kann also auch keine Vergangenheit für uns mehr sein; und was noch nicht ist, lässt sich als Zukunft für uns auch nicht thematisieren. Die Bezeichnungen ›Vergangenheit‹ und ›Zukunft‹ müssen vielmehr einen unausweichlichen Gegenwartsbezug haben. Diese Paradoxie der Gleichzeitigkeit der Zeiten wird alltagspraktisch dadurch abgemildert, dass man Vergangenes und Zukünftiges in eigens dafür vorgesehene Zeitdimensionen verschiebt, die sich bezeichnen und beispielsweise mit Hilfe des Modells des Zeitstrahls auch vorstellen lassen. Mit dieser Verschiebung von Gleichzeitigem in Vergangenheit und Zukunft geht jedoch zumeist auch eine Ontologisierung einher; diesen Dimensionen wird also ein Eigenleben zugeschrieben, das im Nachhinein argumentativ erst wieder mühsam dekonstruiert werden muss. Denn es handelt sich bei Vergangenheit und Zukunft nicht um unterschiedliche temporale Seinsweisen, sondern um Zeitmodalisierungen. Indem man jedoch die vielen Gleichzeitigkeiten verschiebt und in die Zukunft beziehungsweise in die Vergangenheit auslagert, wird der Paradoxie die Spitze genommen und ihre Zumutungen werden unsichtbar gemacht.[57]
Nichtsdestotrotz ist das Leben angenehm, ist das Leben erträglich. Dienstag folgt auf Montag; dann kommt Mittwoch. Der Geist setzt Ringe an; die Identität wird robust; Schmerz wird vom Wachstum aufgesogen. Auf und zu, auf und zu, mit anschwellendem Summen und wachsender Widerstandskraft, werden Hast und Fieber der Jugend in die Pflicht genommen, bis unser ganzes Wesen sich wie die Triebfeder einer Uhr zusammenzuziehen und auszudehnen scheint. Wie schnell fließt der Strom von Januar bis Dezember! Wir werden mitgerissen von der Sturzflut der Dinge, die uns so vertraut geworden sind, daß sie keinen Schatten werfen. Wir treiben dahin, wir treiben dahin …
[…]
Doch ein gewisser Zweifel blieb, ein fragender Tonfall. Es überraschte mich, wenn ich eine Tür öffnete, Leute bei ihren Beschäftigungen anzutreffen; ich zögerte, wenn mir eine Tasse Tee gereicht wurde, ob man Milch oder Zucker sagte. Und wenn das Licht der Sterne auf meine Hand fiel, wie es jetzt fällt, nachdem es Jahrmillionen gereist war – das konnte mir einen Augenblick lang einen kalten Schock versetzen – mehr aber nicht, meine Phantasie ist zu schwach. Aber ein gewisser Zweifel blieb. Ein Schatten flatterte durch meinen Geist, wie Falterflügel zwischen Stühlen und Tischen in einem Zimmer am Abend. Als ich beispielsweise in jenem Sommer nach Lincolnshire fuhr, um Susan wiederzusehen, und sie mir quer durch den Garten mit der trägen Bewegung eines halb geblähten Segels entgegenkam, mit der schaukelnden Bewegung einer Frau, die ein Kind erwartet, dachte ich, ›Es geht immer weiter; aber warum?‹
(Virginia Woolf: Die Wellen)[58]
Warum geschieht das? Warum ist die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen Aktuellem und Inaktuellem nötig, wenn doch alles gleichzeitig geschieht? Dieser Umgang mit unterschiedlichen Zeitdimensionen hat einerseits eine entlastende Funktion (man muss sich nicht mit allen Zeiten gleichzeitig beschäftigen) und eröffnet andererseits erhebliche Möglichkeitshorizonte. Denn im Spiel der unterschiedlichen Zeiten lassen sich immer wieder neue Welten entwerfen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können auf immer neue Weise miteinander kombiniert werden, man kann immer neue Geschichten von ›der Geschichte‹ erzählen und immer neue Utopien oder Dystopien aus der Taufe heben. Die Aufspaltung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirkt also nicht nur entlastend, sondern weltenschöpfend.[59]
Allerdings führt diese Aufspaltung – nicht nur, aber auch und gerade im geschichtswissenschaftlichen Zusammenhang – zu dem Effekt, Zeit als eine gegebene Sinnbestimmung der Welt erscheinen zu lassen und ihren Charakter als gemachte Sinnbestimmung zu verdecken. Zeit und damit auch die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gewinnen ein Eigenleben, werden naturalisiert und ontologisiert (nicht zuletzt aufgrund von ›Zeitmessgeräten‹). Zeit wird zu einem Abstraktum, das sich von den konkreten Ereignissen ablöst, um ein geradezu Ehrfurcht einflößendes Eigenleben zu gewinnen, so dass es sogar schließlich möglich erscheint, Zeit als etwas ›dort draußen‹ zu begreifen, das unabhängig von menschlichem Wollen und Tun vonstattengeht.[60]