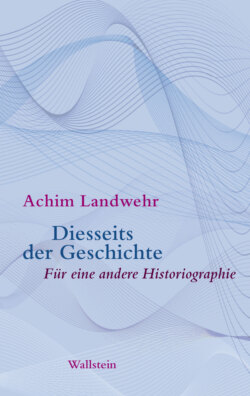Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Jetzt der Zeiten Offiziell geschnittene Zeit
ОглавлениеBei nachlassender Aufmerksamkeit und unzureichender Hinterfragung könnte man zu der Ansicht gelangen, die allfällige Präsenz von Uhren und Kalendern sei nicht nur mit der Zeit an und für sich gleichzusetzen, sondern man habe sich das Ablaufen der Zeit auch so vorzustellen, dass es gänzlich ohne unser Zutun vonstattenginge. Augustinus’ bekannte paradoxale Bemerkung, dass man nur solange gänzlich selbstverständlich wüsste, was die Zeit sei, solange man nicht danach gefragt würde, hat auch 1600 Jahre nach ihrer ersten Formulierung nichts an Gültigkeit eingebüßt.[1] Wir sind üblicherweise der nicht reflektierten, unterschwelligen Überzeugung, die Zeit sei eine vorgegebene Struktur, ein Korsett, in das wir uns einzupassen hätten und nach dem wir uns richten müssten.[2] Tatsächlich handelt es sich – und auch das lässt sich anhand von Uhr und Kalender belegen – um Bewegungsabläufe, die als Symbole so gestaltet sind, dass sie gesellschaftliche Koordination und Orientierung ermöglichen. Mit anderen Worten: Es sind Menschen, die Zeit machen.[3] Wie man die Arten und Weisen gestaltet, mit denen man sich auf die alltäglichen Erfahrungen von Intervall, Rhythmus, Wiederholung, Unumkehrbarkeit, Verfall, Vergangenem oder Zukünftigem bezieht, kann dabei höchst unterschiedliche Formen annehmen.[4] Die Uhren- und Kalenderzeit[5] ist nur eine Möglichkeit, wenn auch sicherlich eine inzwischen global dominierende. Schließlich bietet sie den unabweisbaren Vorteil der Synchronisierung unterschiedlicher, räumlich parallel zueinander ablaufender Vorgänge, wie sie insbesondere in den Bereichen des Wirtschaftlichen, Politischen oder Militärischen unverzichtbar geworden sind.[6] Insbesondere eine globale Ökonomie ist ohne eine weltweit gleichmäßig getaktete Zeit nicht mehr vorstellbar.
Schnitzelnd und schneidend, teilend und unterteilend, nagten die Uhren der Harley Street an dem Junitag, rieten zur Unterwerfung, stützten die Autorität und hoben im Chor die erhabenen Vorteile des Sinnes für Proportion hervor, bis die Aufhäufung der Zeit so weit verringert war, daß eine Ladenuhr über einem Geschäft in der Oxford Street fröhlich und brüderlich, als wäre es den Herren Rigby und Lowndes ein Vergnügen, diese Auskunft unentgeltlich zu erteilen, verkündete, es sei halb zwei.
Blickte man hoch, so sah man, daß jeder Buchstabe ihrer Namen eine der Stunden bezeichnete; unbewußt war man Rigby und Lowndes dankbar, daß sie einem die offizielle Greenwich-Zeit angaben; und diese Dankbarkeit (sinnierte Hugh Whitbread, während er vor dem Schaufenster herumtrödelte) führte dann natürlich dazu, bei Rigby und Lowndes Socken oder Schuhe einzukaufen.
(Virginia Woolf: Mrs. Dalloway)[7]
Die Frage, wie man denn sinnvoll über die Zeit reden könne, ist ja durchaus berechtigt. Eine häufig gewählte Antwort (oder eher: Ausflucht) besteht darin, die Zeit zu vergegenständlichen, indem man sich auf ein entsprechendes Messgerät bezieht. Der bestimmte Artikel suggeriert ja, dass sich ›die Zeit‹ ähnlich behandeln ließe wie ›der Tisch‹ – was im Falle der Zeit aber offensichtlich unsinnig ist, denn wir können uns höchstens auf periodische oder getaktete Vorgänge beziehen, auf den Lauf der Sonne, das Rieseln von Sandkörnen durch ein Glas oder die Bewegung eines Zeigers auf einem Ziffernblatt. Auf ›die Zeit‹ beziehen wir uns dabei aber sicherlich nicht. Man muss aber noch einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, was entsprechende Apparaturen eigentlich messen. Messen sie überhaupt etwas? Der Ausdruck ›Zeitmessgeräte‹ führt ja in die Irre, denn wenn es schon nicht gelingt, dass wir uns auf ›die Zeit‹ beziehen können, dann können es diese Geräte schon gar nicht, weil auch ihnen kein privilegierter Zugang zu dieser geheimnisvollen Dimension gewährt ist. Die Frage nach dem Referenten von Medien wie Uhren und Kalendern drängt sich daher unweigerlich auf. Worauf beziehen sie sich, wenn sie sich nicht auf ›die Zeit‹ beziehen?
Eine Uhr ist zunächst einmal nichts anderes als ein Produzent von geregelten und möglichst gleichförmigen Bewegungen. Die entscheidenden Eigenschaften dieser Uhren ergeben sich nicht aus ›der Zeit‹, sondern aus den technischen Herstellungsnormen, denen sich dieser Apparat verdankt. Die Eigenschaften der Uhr kommen ihr nicht gewissermaßen ›von Natur aus‹ zu, sondern ergeben sich einzig aus den Zwecken, für die sie erbaut wurde. Die Gleichförmigkeit und Unerbittlichkeit des zeitlichen Ablaufs, die wir mit der Uhr in Zusammenhang bringen, entstehen daher auch nicht aufgrund der Beziehung zwischen Apparat und Zeit, sondern aufgrund der Verbindungen zwischen Apparat und Apparat.[8] Wenn eine Uhr vor- oder nachgeht, dann nicht weil sie mit ›der Zeit‹ nicht übereinstimmen würde, sondern weil die Taktung mit anderen Apparaten, im Zweifelsfall der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, nicht mehr im Einklang steht.
Die Materialität der Zeit-Medien ermöglicht ein Wechselspiel, durch welches das Symbolische einer kalendarischen Zeit sehr reell werden kann (man denke nur an die Auswirkungen von Fristsetzungen), die aber umgekehrt auch das Reelle und Materielle einer mechanischen Uhr flugs ins Symbolische umschlagen lässt. Daher gilt der Satz von Wolfgang Hagen: »Im Abendland generieren Medien die Zeit und ihren Begriff – und nicht die Zeit die Medien.«[9] Es ist unabweislich, die Verfügung über Raum und Zeit immer an die jeweiligen medialen Möglichkeiten gebunden zu sehen. Insofern ist die Geschichte der Medien immer auch eine Geschichte wachsender (oder schrumpfender) Zugriffsmöglichkeiten über ferne Zeiten oder andere Räume.[10] Vielleicht ist auch hier ein Grund für den Umstand zu suchen, dass im geschichtswissenschaftlichen Kontext die Zeit eher zurückhaltend zum Gegenstand gemacht wird – weil dadurch die Medialität des Historischen überdeutlich würde und gern gehegte Konzepte von ›geschichtlicher Realität‹ oder ›historischer Wahrheit‹ noch mehr in Zweifel gezogen würden, als es ohnehin schon geschieht.
Dabei wäre eine größere geschichtswissenschaftliche Aufmerksamkeit für die Zeit allein schon deswegen notwendig, weil man von Zeittheorien kaum sinnvoll sprechen kann, wenn man nicht auch deren historische Dimension angemessen berücksichtigt. Denn Zeitvorstellungen, mit denen wir selbstverständlich umgehen und die wir theoretisch abstrahieren, basieren unweigerlich auf den Formen ihrer historischen Ausprägung. So lässt sich bei Krisenselbstbeschreibungen der jüngeren Zeit gar nicht übersehen, wie sich in ihnen erhebliche zeitliche Verwirbelungen manifestieren. Sämtliche Diskurse um Postmoderne, das Ende großer Erzählungen, Beschleunigungserfahrungen, Nostalgiebestrebungen, konservative Beharrungen, Posthistoire und vieles andere mehr lassen sich nur als Indizien dafür begreifen, dass man sich in einer Zeit wähnte, in der nicht mehr sicher zu sein schien, was einem die Zeit eigentlich sagen wollte und sollte.
Solche temporalen Turbulenzen anzusprechen, darf einen aber nicht übersehen lassen, wie sich damit gleichzeitig sehr langfristig stabile Formen des Zeitwissens verbinden, die bei aller Verunsicherung ihre nur schwerlich zu bezweifelnde Gültigkeit bewahren. Von Zeittheorien im spezifisch europäischen Kontext kann man beispielsweise kaum sinnvoll sprechen, wenn man nicht zumindest in groben Zügen ihre jüdisch-christlichen Wurzeln im Auge behält. Die christliche Zeitvorstellung ist als Erbin der jüdischen Zeitauffassung ebenso wie diese geprägt durch die charakteristische Hoffnung auf Erlösung. Die Geburt Jesu wird dabei als zeitlicher Einschnitt verstanden, der die Geschichte nach christlicher Sichtweise in zwei Hälften teilt. Die Christen waren von Anfang an davon überzeugt, ihre Religion sei ein Ausdruck göttlichen Willens, weshalb ihrer Lehre auch universale Bedeutung zukommen müsse. Der Kreuzigung Christi gilt dabei als einmaliges und unwiederholbares Ereignis – ein Umstand, aus dem sich ein linear dominiertes und nicht mehr ausschließlich zyklisches Zeitmodell entwickeln ließ. Eine solche historische Zeitauffassung mit ihrer Betonung der Unwiederholbarkeit von Ereignissen gehört zu den zentralen Bestandteilen des Christentums – und bildet auch das (meist unhinterfragte) Fundament historischer Zeitmodelle.[11]
Die religiöse Basis von Zeitkonzepten zu unterstreichen, heißt aber nicht, sie in irgendwelchen uralten historischen Schichten wurzeln zu lassen und damit gewissermaßen zu mythologisieren. Von der religiösen Basis der Zeit zu sprechen, unterstreicht vielmehr ihren gesellschaftlichen Charakter – religiöse Zeit ist soziale Zeit. Émile Durkheim hat das unmissverständlich deutlich gemacht: »Man stelle sich zum Beispiel vor, was der Begriff der Zeit wäre, wenn wir das abziehen, womit wir sie einteilen, messen und mit Hilfe von objektiven Zeichen ausdrücken, eine Zeit, die keine Folge von Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, Stunden wäre! Das wäre etwas fast Unvorstellbares. Wir können die Zeit nur begreifen, wenn wir in ihr verschiedene Augenblicke unterscheiden. Wo liegt aber der Ursprung dieser Unterschiedlichkeit? […] Es ist nicht meine Zeit, die auf diese Weise organisiert ist; es ist die Zeit, wie sie von allen Menschen einer und derselben Zivilisation gedacht wird. Das allein genügt schon, um deutlich zu machen, daß eine derartige Organisation kollektiv sein muß. In der Tat macht die Beobachtung klar, daß diese unumgänglichen Fixpunkte, auf die alle Dinge zeitlich ausgerichtet sind, dem sozialen Leben entnommen sind. Die Einteilung in Tage, Wochen, Monate, Jahre usw. entspricht der Periodizität der Riten, der Feste, der öffentlichen Zeremonien. Ein Kalender drückt den Rhythmus der Kollektivtätigkeit aus und hat zugleich die Funktion, deren Regelmäßigkeit zu sichern.«[12]
Wenn die Zeit in diesem Sinne Menschenzeit ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Modelle von den großen Zusammenhängen der historischen Zeit, vom Zeitstrahl, vom Anfang und Ende, vom unabwendbaren Niedergang oder vom unaufhaltsamen Fortschritt, nicht nur eine religiöse, sondern ebenso eine biographische und körperliche Wurzel haben. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wurden etablierte Modelle historischer Zeit nicht zuletzt aus (auto-)biographischen Modellen extrapoliert. Wir sehen und verstehen unser Leben in zeitlicher Hinsicht als eine Linie von Anfang bis Ende, von der Geburt bis zum Tod – und scheinen dieses Modell und dieses Narrativ auf unsere Vorstellungen von Zeit und Geschichte übertragen zu haben.
Dabei ist dieses Leben, wie man kaum großartig begründen muss, sondern wie sich leichthin aus alltäglichen Erfahrungen nachvollziehen lässt, bestimmt durch das ständige Bemühen um Synchronisierung. Es besteht die Notwendigkeit, unterschiedliche Zeitformen und Zeitwissen (im Plural) nicht nur biographisch, sondern geradezu körperlich miteinander in Einklang zu bringen. Die unterschiedlichen Zeiten haben im Leben jedes Einzelnen ihre Spuren hinterlassen und müssen beständig miteinander kombiniert werden. Dementsprechend muss eine Erforschung der Zeit aber darauf bedacht sein, die Pluralität der Zeiten nicht durch den Singular der Synchronie zu verdecken. Stattdessen wären die vielen historischen Zeiten und Gleichzeitigkeiten sichtbar zu machen.[13] Ein solches Modell historischer Zeit wäre natürlich immer noch vom menschlichen Leben extrapoliert – wie könnte es auch anders sein, wo doch ›Geschichte‹ ein zutiefst menschliches und kulturelles Gebilde ist. Aber es wäre eine andere, eine komplexere Art der Zeitvorstellung.[14]
Aber leider hat die Zeit, obwohl sie Tiere und Pflanzen mit erstaunlicher Pünktlichkeit blühen und vergehen läßt, keine derart einfache Wirkung auf den menschlichen Geist. Überdies wirkt der menschliche Geist mit gleicher Seltsamkeit auf den Körper der Zeit ein. Eine Stunde kann, sobald sie sich im wunderlichen Element des menschlichen Geistes eingenistet hat, auf das Fünfzig- oder Hundertfache ihrer Uhrenlänge gedehnt werden; andererseits kann eine Stunde auf dem Zeitmesser des Geistes akkurat durch eine einzige Sekunde wiedergegeben werden. Diese außergewöhnliche Diskrepanz zwischen der Zeit auf der Uhr und der Zeit im Geist ist weniger bekannt, als sie es sein sollte, und verdiente ausführlichere Untersuchung.
(Virginia Woolf: Orlando)[15]
Überträgt man solche Überlegungen auf die Zeitmodellierung in den Geschichtswissenschaften, dann scheint es, als müsste man zwangsläufig deren Perspektive in einem bestimmten, möglicherweise sogar in mehreren Punkten verschieben. Um Zeit als historisches Phänomen angemessen zu fassen, ist es dann weniger ratsam, sie als eine durchgehende Linie zu begreifen, an der sich die historischen Veränderungen und Phänomene wie an einer Schnur aufreihen, um sich anschließend den Anfangs- und Endpunkten dieser Linie zu widmen und die Frage zu stellen, wie sich ›die Geschichte‹ dazwischen verhalten hat. Stattdessen wäre die Aufmerksamkeit auf jeweils synchron zueinander bestehende Zentren sozialen Lebens zu richten, um dort ausfindig zu machen, mit welchen Reichweiten temporalen Denkens operiert, welche Geschwindigkeiten angelegt und welche Taktungen der Zeitlichkeit vorausgesetzt wurden.[16]
Nun stellt es zugegebenermaßen eine Überwindung eingefahrener Denkweisen dar, unterschiedliche und vor allem vielfältige Formen der Verzeitung zu thematisieren, die nicht mit unbarmherziger Regelmäßigkeit, »schnitzelnd und schneidend, teilend und unterteilend«, wie Virginia Woolf sagt, die Zeit takten. Geschichtswissenschaftlich wird aber immer noch diese kalendarische Zeit als fixer und gleichmäßiger temporaler Maßstab herangezogen, ohne andere Möglichkeiten angemessen in Betracht zu ziehen. Aber wie schon George Kubler formulierte: »Die Anzahl der Möglichkeiten, die für die Dinge besteht, Zeit einzunehmen, ist wahrscheinlich nicht stärker begrenzt als die Anzahl der Möglichkeiten, die für die Materie besteht, Raum einzunehmen. Die Schwierigkeit, abgrenzende Kategorien für die Zeit zu finden, hat stets darin bestanden, eine angemessene Beschreibung für die Dauer zu finden, die sich immer den Ereignissen entsprechend verändern wird, während man diese nach einer festgesetzten Skala mißt. Die Geschichte verfügt nicht über ein Periodensystem der Elemente und ebensowenig über eine Klassifizierung nach Arten und Gattungen; sie verfügt nur über das Meßsystem der Sonnenzeit und einige herkömmliche Methoden, Ereignisse zu gruppieren. Sie verfügt jedoch nicht über eine Theorie der zeitlichen Struktur.«[17] Und insbesondere der letzte Satz hat an Gültigkeit bis zum heutigen Tag nichts eingebüßt.
Ein in zeittheoretischen Debatten regelmäßig anzutreffendes Modell, um Vielzeitigkeit zu thematisieren und die Fragen zu behandeln, ob Zeit relational oder absolut sei, ob es sich um eine vom Beobachter unabhängige Entität handele oder ob sie im Gegenteil von diesem Beobachter gerade nicht zu trennen sei, ist die Unterscheidung von A- und B-Serien der Zeit. Eingeführt wurde diese Einteilung erstmals 1908 (in Buchform dann nochmals 1927) von dem Philosophen John McTaggart.[18] McTaggart entwickelte diese Differenzierung mit dem Ziel, die Nicht-Existenz von Zeit zu beweisen. Seine Unterscheidung ist insofern hilfreich, als sie nicht nur die Zeittheorie stark beeinflusst hat, sondern weil sie die häufig anzutreffenden dichotomischen Entgegensetzungen in Diskussionen zur Zeit auf den Punkt zu bringen vermag.
Man könnte die Unterscheidung von A- und B-Serien der Zeit übersetzen als subjektive beziehungsweise objektive Auffassungen von Zeit. Die A-Serie (oder subjektive Perspektive) bezeichnet den Umstand, dass wir Zeit als einen permanenten Prozess der Veränderung und Bewegung wahrnehmen. Die Zeit ›fließt‹ (um diese vielfach verwendete heraklitische Metapher zu bemühen), Ereignisse geschehen und gehen vorüber, die Gegenwart wird zur Vergangenheit und die Zukunft zur Gegenwart. Die B-Serie (oder objektive Perspektive) beschreibt demgegenüber die temporale Ordnung des Vorher und Nachher, reiht Ereignisse mittels Datierung und historischer Zuordnung in ihre jeweiligen Beziehungen zueinander. Diese Ordnung ist fixiert, kann nicht umgekehrt werden und etabliert auf diese Weise eine stabile Zeitschiene.[19]
Mit Blick auf den geschichtswissenschaftlichen Umgang mit Zeit fällt auf, dass sie gemäß dieser Unterscheidung vornehmlich als B-Serie oder als Zeitleiste verstanden wird. Begreift man Zeit in diesem objektivistischen Sinn, lassen sich dadurch zwei Effekte erzielen: Die Zeit kommt einerseits dem geschichtswissenschaftlichen Bedürfnis entgegen, eindeutige Datenreihen zu etablieren, und erzeugt andererseits den Eindruck, sich in einem quasi naturwissenschaftlichen, weil objektiv vorgegebenen Rahmen zu bewegen.
Einem solchen objektivistischen Schema zu folgen, birgt jedoch Probleme. Vor allem wird dadurch Zeit zu einer unproblematisierten Voraussetzung, zu etwas Gegebenem, zu einem – im wörtlichen Sinn – ›Datum‹. Das ist unter anderem deswegen problematisch, weil ja auch die historischen Akteurinnen und Akteure, mit denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen, ihre jeweiligen Zeitkonzepte besaßen, die unter Umständen erheblich von denjenigen abweichen, mit denen wir ganz selbstverständlich umgehen.[20]